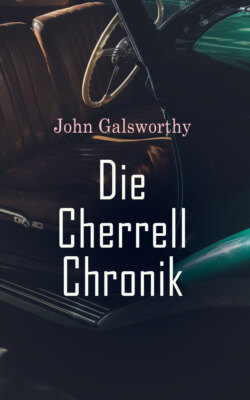Читать книгу Die Cherrell Chronik - John Galsworthy - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Die seltsam unregelmäßige Bauart, die für altenglische Landsitze so charakteristisch ist, trat bei Schloß Lippinghall besonders deutlich zutage – kein Zimmer glich dem andern. Wenn die Gäste ein Zimmer betraten, war es, als wollten sie sich dort häuslich niederlassen, und während ihres Aufenthalts atmeten sie in jedem dieser Zimmer eine andre Atmosphäre, fanden ganz andre Möbel als in den Nachbarräumen. Auch fühlten sie gar nicht die Verpflichtung, sie beim Weggehen so zurückzulassen, wie sie die Zimmer beim Kommen vorgefunden, wußten auch kaum mehr, wie sie damals ausgesehn. Wertvolle Antiquitäten standen mitten unter gewöhnlichen Möbeln herum, die dem Gebrauch oder der Behaglichkeit dienten. Altersbraune oder gelbliche Ahnenbilder hingen noch braunern, noch gelbern holländischen oder französischen Landschaften gegenüber, hie und da gab es einen entzückenden alten Kupferstich und anmutige Miniaturen. Mindestens in zwei Zimmern befanden sich schöne alte Kamine mit Gittern, auf denen man bequem sitzen konnte. Im Dunkel kam unerwartet hier und dort eine Treppe zum Vorschein. Die Gäste konnten sich nur schwer merken, wo ihre Schlafzimmer lagen, und hatten es bald wieder vergessen. In einem solchen Zimmer stand etwa ein äußerst kostbarer alter Kleiderschrank aus Kastanienholz, ein prachtvoll stilechtes Himmelbett, eine Fensterbank mit Kissen, und an den Wänden hingen ein paar französische Kupferstiche. An jedes dieser Wohnzimmer schloß sich ein Schlafraum mit schmalem Bett und ein kleines Badezimmer, in dem man stets Badesalz vorfand. Einer der Monts war Admiral gewesen; drum lauerten in den Winkeln der Korridore seltsame alte Landkarten, deren Meer drachenschwänzige Galionen durchkreuzten. Ein andrer, Sir Lawrences Großvater, der siebente Baronet, hatte eine Leidenschaft für Wettrennen, noch jetzt konnte man an den Wänden die Anatomie des vorbildlichen Rassepferds und den Jockey seiner Zeit studieren. Der sechste Baronet, der älter geworden war als seine Väter, ein Diplomat, hatte Stiche aus der frühviktorianischen Epoche hinterlassen, die Bilder seiner Frau und Töchter in Krinolinen, sein eigenes mit langen Bartkoteletten. Von außen wies das Schloß den Stil der Epoche Karls des Ersten auf, hie und da gemahnte eine Einzelheit an die Zeiten Georgs des Dritten und Vierten, ja sogar an die viktorianische Periode – der sechste Baronet hatte ab und zu seiner Neuerungssucht die Zügel schießen lassen. Das einzige Moderne an dem ganzen Haus waren die Licht- und Wasserleitungen.
Als Dinny Mittwoch des Morgens zum Frühstück herabkam – die Jagdgesellschaft sollte um zehn Uhr aufbrechen – saßen schon drei der Damen und alle Herren außer Hallorsen beim Frühstück oder holten sich eben ihr Essen von den Buffettischen. Sie glitt in einen Stuhl neben Lord Saxenden; er erhob sich ein wenig und sagte: «Morgen!»
«Dinny», rief Michael von der Anrichte her, «Kaffee, Kakao oder Ingwerbier gefällig?»
«Kaffee und Brathering, Michael.»
«Brathering ist keiner da.»
Lord Saxenden blickte auf. «Was, kein Brathering?» und wandte sich wieder der Wurst auf seinem Teller zu.
«Schellfisch?» fragte Michael. – «Nein, danke.»
«Und was willst du, Tante Wilmet?»
«Indisches Risibisi.»
«Kein Risibisi da. Nieren, Speck, Rührei, Schellfisch, Schinken, kalte Rebhuhnpastete.»
Lord Saxenden erhob sich. «Ah! Schinken!» und ging zur Anrichte hinüber.
«Also, Dinny?» fragte Michael.
«Nur ein wenig Jam, bitte.»
«Stachelbeer-, Erdbeer-, Johannisbeer- oder Orangenjam?»
«Stachelbeer.»
Lord Saxenden kam mit einem Teller Schinken auf seinen Platz zurück und begann während des Essens einen Brief zu lesen. Dinny konnte aus seinem Gesichtsausdruck nicht recht klug werden, er hielt den Blick gesenkt, und den Mund hatte er ganz voll. Saxenden war rotbackig, die blonden Haare und der Schnurrbart spielten ins Graue; vierschrötig saß er bei Tisch da. Plötzlich wandte er sich an Dinny: «Verzeihn Sie, daß ich jetzt lese. Ein Brief von meiner Frau. Sie liegt krank.»
«Wie traurig!»
«Scheußlich! Armes Weib!»
Er steckte den Brief in die Tasche, schob einen Happen Schinken in den Mund und sah Dinny an. ‹Blaue Augen hat er›, stellte sie fest, ‹die Brauen sind etwas dunkler als das Haar, sehn wie Angelhaken aus.› Siegessicher glotzte er drein, als wollte er sagen: ‹Bin ein fescher Kerl!› In diesem Augenblick sah Dinny Hallorsen eintreten. Einen Moment stand er unschlüssig da, dann gewahrte er sie und trat auf den leeren Stuhl neben ihr zu.
«Miß Cherrell», fragte er mit einer Verbeugung, «darf ich hier Platz nehmen?»
«Selbstverständlich. Dort drüben steht das Essen, falls ein Mann wie Sie ans Essen denkt.»
«Wer ist der Bursche?» fragte Lord Saxenden, als Hallorsen Futter holen ging. «Wohl ein Amerikaner?»
«Professor Hallorsen.»
«Ach so, der! Verfasser des neuen Buches über Bolivien, wie?»
«Jawohl.»
«Sieht nicht übel aus.»
«Ein männlicher Mann.»
Saxenden warf ihr einen überraschten Blick zu. «Versuchen Sie doch diesen Schinken. Mir scheint, ich kenne einen Ihrer Onkel von unsrer Studienzeit in Harrow her.»
«Onkel Hilary? Er hat mir davon erzählt.»
«Einmal wettete er mit mir um drei Portionen Erdbeercreme gegen zwei bei einem Wettlauf vom Hügelhang bis zur Turnhalle.»
«Und haben Sie gewonnen, Lord Saxenden?»
«Nein; aber bezahlt hab ich Ihrem Onkel die Wette nie.»
«Warum nicht?»
«Er verstauchte sich den Knöchel, ich verrenkte mir das Knie. Er humpelte noch bis zum Tor der Turnhalle, ich aber konnte keinen Schritt mehr tun. Wir mußten beide bis zum Ende des Semesters das Bett hüten, dann verließ ich die Anstalt.» Lord Saxenden kicherte. «Ich schulde ihm die drei Portionen Erdbeercreme noch immer.»
Hallorsen kam an seinen Platz zurück und meinte: «Ich war der Ansicht, wir Amerikaner hielten viel auf ein ausgiebiges Frühstück. Aber im Vergleich zum englischen heißt das unsre gar nichts.»
«Kennen Sie schon Lord Saxenden?»
«Lord Saxenden», wiederholte Hallorsen und verneigte sich leicht.
«Sehr angenehm», murmelte der Lord. «Solche Rebhühner wie bei uns gibt's bei euch in Amerika wohl nicht, wie?»
«Nein, glaube kaum. Bin auf diese Rebhuhnjagd schon sehr neugierig. Ein herrlicher Kaffee, Miß Cherrell.»
«Jawohl», sagte Dinny, «Tante Emily ist aber auch stolz auf ihren Kaffee.»
Lord Saxenden setzte sich noch vierschrötiger hin. «Versuchen Sie doch diesen Schinken», riet er. «Ihr Buch hab ich nicht gelesen.»
«Gestatten Sie, daß ich es Ihnen übersende. Ich werde stolz darauf sein, wenn Sie es lesen.»
Lord Saxenden aß weiter.
«Sie sollten es wirklich lesen, Lord Saxenden», erklärte Dinny. « Ich sende Ihnen ein andres über dasselbe Thema.»
Lord Saxenden glotzte sie an. «Zu nett von Ihnen beiden», meinte er. «Ist das Erdbeerjam?», und er langte schon danach.
«Miß Cherrell», bat Hallorsen leise, «lesen Sie doch, bitte, mein Buch und bezeichnen Sie mir die Stellen, die Ihrer Ansicht nach Ihrem Bruder unrecht tun. Als ich es schrieb, war ich schwer verstimmt.»
«Glauben Sie, das kann jetzt noch nützen?»
«Bei der zweiten Auflage könnte ich diese Stellen auf Ihren Wunsch streichen.»
«Sehr liebenswürdig von Ihnen», gab Dinny eisig zurück, «aber, Professor, das Übel ist nun einmal geschehn.»
«Ich bin wirklich trostlos, daß ich Sie gekränkt habe», erklärte Hallorsen noch leiser.
‹Keinen Pfifferling machst du dir draus!› hätte Dinny gern gerufen, über und über erglühend vor Zorn, Triumph, Eifer und Lachlust.
«Meinen Bruder haben Sie verletzt, nicht mich.»
«Vielleicht ließe sich das durch eine Aussprache wieder gutmachen.»
«Kaum.» Und Dinny erhob sich.
Hallorsen stand gleichfalls auf und verneigte sich, als sie fortging.
‹Furchtbar höflich›, dachte sie.
Den Vormittag verbrachte sie mit dem Tagebuch auf einem zwischen Eibenbäumen ganz versteckten Fleck des Gartens. Die Sonne schien hier so warm, um die Cinerarien, Maßliebchen, Dahlien, Stockrosen und Astern summten Bienen; alles wirkte beruhigend. In diesem abgeschiednen Gartenwinkel überkam sie neuerdings heftiger Widerwille davor, Huberts geheimste Gefühle aller Welt zu enthüllen. Das Tagebuch enthielt freilich kein sentimentales Gewinsel; doch es gab Huberts seelische und körperliche Wunden so schonungslos preis, wie man sie nie und nimmer vor fremden Augen entblößen soll. Aus einiger Entfernung vernahm sie immer wieder Schüsse, stützte sich mit den Ellenbogen auf die Eibenhecke und sah über die Felder nach der Richtung, aus der die Schüsse kamen.
«Da bist du ja!» rief eine Stimme.
Hinter ihr stand die Tante in einem Riesenstrohhut, der ihr bis auf die Schultern reichte, und hinter der Tante standen zwei Gärtner, die sie nach dem Dioskurenpaar ‹Boswell und Johnson› nannte.
«Jetzt komm ich zu dir, Dinny. Boswell und Johnson, ihr könnt gehn. Am Nachmittag wollen wir dann den Portulak besichtigen.» Sie hob den Kopf und lugte unter der geschweiften Riesenkrempe ihres Gartenhuts hervor. «Ein Strohgeflecht aus Majorca», erklärte sie, «schützt so gut vor der Sonne.»
«Boswell und Johnson? Was bedeutet das, Tantchen?»
«Boswell hatten wir schon länger, dann gabelte dein Onkel auch Johnson auf, und nun läßt er sie immer zusammen arbeiten. Fleur muß meine Gartenschere verkramt haben. Was hast du denn da, Dinny?»
«Huberts Tagebuch.»
«Deprimierend?»
«Jawohl.»
«Ich habe mir diesen Professor Hallorsen angeschaut – den müssen wir noch kleinkriegen.»
«Versetz ihm eins, Tantchen.»
«Hoffentlich schießen sie ein paar Hasen», meinte Lady Mont. «Junger Hase ist auf dem Speisezettel immer willkommen. Wilmet und Henrietta Bentworth stimmen schon wieder in einem Punkt überein: daß sie in keinem Punkt übereinstimmen.»
«So? Worüber sind sie denn verschiedner Ansicht?»
«Ich konnte mich nicht so eingehend damit befassen – sie stimmen ja nie überein. Henny ist so lang Hofdame gewesen, du weißt ja.»
«Wirkt das so verhängnisvoll?»
«Henny ist eine liebe Frau, ich kann sie gut leiden. Aber sie gackert wirklich wie eine alte Henne. Was hast du mit diesem Tagebuch vor?»
«Ich will es Michael zeigen und ihn um Rat fragen.»
«Gib nichts auf seinen Rat», sagte Lady Mont, «er ist ein lieber Kerl, aber gib lieber nichts darauf. Er kennt übrigens eine Menge komischer Leute – Verleger und so weiter.»
«Drum möcht ich mich ja an ihn wenden.»
«Wende dich lieber an Fleur, die hat einen hellen Kopf. Habt ihr in Condaford auch solche Cinerarien? Mir scheint, Adrian ist ein wenig übergeschnappt.»
«Aber Tante!»
«Geht herum wie ein Mondsüchtiger; man kann gar nicht an ihn herankommen. Ich dürfte es ja natürlich nicht vor dir sagen, Kind, aber ich denke, er sollte sie kriegen.»
«Das mein ich auch, Tantchen.»
«Er will aber nicht.»
«Oder sie will nicht.»
«Keins von beiden will; ich weiß wahrhaftig nicht, wie man das einfädeln könnte. Sie ist vierzig.»
«Wie alt ist denn Onkel Adrian?»
«Unser Nestküken, der Jüngste außer Lionel. Ich bin neunundfünfzig», erklärte Lady Mont entschlossen. «Ich bin wirklich schon neunundfünfzig, dein Vater sechzig. Deine Großmutter muß sich sauber mit uns geschunden haben, als sie sich mit unsrer Produktion so beeilte. Was hältst denn du vom Kinderkriegen?»
«Na, bei Eheleuten mag es noch angehn», murmelte Dinny. «Mit Maß natürlich.»
«Bei Fleur soll ein zweites kommen – im März. Ein ungünstiger Monat. Unvorsichtig von den beiden! Wann wirst denn du heiraten, Dinny?»
«Wenn meine Liebe zu grünen anfängt – eher nicht.»
«Sehr vernünftig. Aber nimm nur ja keinen Amerikaner.»
Dinny wurde rot und fragte mit seltsam gefährlichem Lächeln: «Zum Kuckuck, warum sollt ich denn grade einen Amerikaner heiraten?»
«Man kann nie wissen», meinte Lady Mont und pflückte eine welke Aster; «es hängt schließlich davon ab, wer sich um dich bemüht. Vor unsrer Hochzeit hat sich Lawrence so um mich bemüht!»
«Heut doch auch noch, Tantchen. Ist das nicht wunderbar?»
«Still, Gelbschnabel!» Und Lady Mont versank hinter ihrem Riesenhut in Träume.
«Weil du just vom Heiraten redest, Tante Emily, ich wollt, ich fände ein Mädchen für Hubert. Er müßte unbedingt Ablenkung haben.»
«‹Laß das durch eine Ballettratte besorgen›, würde dein Onkel sagen», meinte Lady Mont.
«Vielleicht weiß Onkel Hilary eine, die er uns warm empfehlen könnte.»
«Bist ein schlimmes Mädel, Dinny, ich hab das immer geahnt. Aber laß mich nachdenken. Da war doch ein Mädchen – nein, sie hat geheiratet.»
«Na, vielleicht ist sie jetzt schon geschieden.»
«Nein, sie will sich erst scheiden lassen, glaub ich, aber das geht nicht so geschwind. Ein entzückendes kleines Geschöpf.»
«Glaub's gern. Denk doch weiter nach, Tantchen.»
«Diese Bienen», erwiderte Lady Mont, «gehören Boswell. Italienische Rasse. Lawrence nennt sie immer Fascisten.»
«Aha! Schwarze Hemden und leere Köpfe. Sie schwirren tatsächlich überaus geschäftig herum.»
«Und ob! Sie fliegen beständig umher und stechen einen, wenn man sie reizt. Mir gegenüber benehmen sie sich übrigens sehr nett.»
«Da sitzt eine auf deinem Hut, Tantchen. Soll ich sie herunterholen?»
«Laß!» rief Lady Mont, warf den Kopf zurück und vergaß den Mund zu schließen. «Ah, da fällt mir etwas ein, eine junge Dame für Hubert – Jeanne Tasburgh, die Tochter unsres Pfarrherrn – aus sehr guter Familie. Natürlich kein Geld.»
«Gar keins?»
Lady Mont schüttelte den Kopf, daß ihr Hut ins Schwanken geriet. «Arm wie eine Kirchenmaus. Aber hübsch ist sie – erinnert an eine Leopardin.»
«Dürft ich sie einmal besehn? Ich kenne Huberts Antipathien so ziemlich.»
«Ich werd sie zum Dinner laden. Zu Haus kriegen sie einen Schlangenfraß. Eine Tasburgh hat einmal in unsere Familie geheiratet, mir scheint, zur Zeit König Jakobs, also ist sie eure Base – allerdings eine sehr entfernte Verwandte. Ein Sohn ist auch da, glattrasiert, springlebendig, dient bei der Marine. Jetzt ist er, glaub ich, daheim im Pfarrhaus auf Urlaub. Bitte, sei so lieb und nimm mir die Biene vom Hut!»
Dinny fing mit ihrem Taschentuch die kleine Biene von dem großen Hut herunter, hielt sie ans Ohr und bemerkte: «Ich hör die kleinen Dinger noch immer so gern summen!»
«Den lad ich auch ein», sagte ihre Tante. «Alan heißt er, ein hübscher Junge.» Ihr Blick fiel auf Dinnys Haar. «Welch hübsche Haarfarbe! Mispelfarben. Hat Aussichten, hör ich, ich weiß nur nicht, welche. Wurde im Krieg in die Luft gesprengt.»
«Und kam hoffentlich wieder heil und ganz herunter, Tantchen?»
«Jawohl. Er hat dafür irgendeine Auszeichnung erhalten. Jetzt, sagt er, ist es bei der Marine furchtbar fad. Nichts als Winkelmessen, Räderwerk und Gestank. Frag ihn nur selber.»
«Und das Mädchen, Tante Emily? Warum hast du sie vorhin mit einer Leopardin verglichen?»
«Wenn sie dir ins Gesicht schaut, glaubst du, ein Leopard springt dich an. Ihre Mutter ist tot. Sie führt das Kommando über die ganze Pfarre.»
«Mit Hubert würde sie dann wohl auch herumkommandieren?»
«Mit jedem, der sich erdreistet, ihr zu befehlen.»
«Hm! Soll ich vielleicht deine Einladung in den Pfarrhof bringen?»
«Ich werd Boswell und Johnson senden», erwiderte Lady Mont. «Doch halt!» rief sie dann und blickte auf die Armbanduhr, «die sind gewiß schon zum Mittagessen gegangen; ich richte meine Uhr immer nach ihnen. Begeben wir uns selbst hin, Dinny, es ist nur ein paar hundert Schritt weit. Soll ich einen andern Hut nehmen?»
«Keine Idee, Liebe.»
«Gut, dann gehn wir gleich hier hinaus.» Unter den Eibenbäumen schritten sie ans andre Ende des Parks, stiegen ein paar Stufen hinab und kamen auf einem grasbewachsenen Weg durch eine Zauntür zum Pfarrhaus. Dinny blieb in der mit Schlinggewächsen umrankten Vorhalle stehn und hielt sich hinter dem Hut ihrer Tante verborgen. Die Tür stand offen, die dämmrige, getäfelte Halle roch nach dürren Rosenblättern und altem Holz und wirkte einladend. Von innen rief eine Frauenstimme: «A-lan!»
Eine Männerstimme rief zurück: «Hallo?»
«Macht es dir was aus, wenn wir kalten Lunch haben?»
«Klingel ist keine da» erklärte Lady Mont, «am besten, wir klopfen.» Beide klopften.
«Was zum Kuckuck ist los?» Im Türrahmen erschien ein junger Mann in grauem Flanellanzug. Er hatte ein breites braunes Gesicht, dunkles Haar und tiefliegende graue Augen, die grade und offen blickten.
«Oh!» rief er. «Lady Mont! … Hallo, Jeanne!» Dann begegnete er hinter Lady Monts Hut einem Blick aus Dinnys Augen und lächelte, wie nur ein Schiffsleutnant lächelt.
«Alan, könnten Sie heut abend mit Jeanne zum Dinner kommen? Dinny, das ist Alan Tasburgh. Alan, wie gefällt Ihnen mein Hut?»
«Ein Prachtexemplar, Lady Mont.»
Da kam federnden Schritts ein schlankes, prächtig gebautes Mädchen herbei. Sie trug einen rehbraunen, ärmellosen Jumper und gleichfarbigen Rock, Arme und Wangen waren fast ebenso braun. Dinny verstand jetzt den Vergleich der Tante. Sie hatte breite Backenknochen, ein spitz zulaufendes Kinn, grünlichgraue, ziemlich tiefliegende Augen unter langen schwarzen Wimpern. Die funkelnden Augen blickten grade; die Nase war feingeformt, die Stirn breit und niedrig, das kurzgeschnittene Haar dunkelbraun. ‹Ob das die Richtige für ihn ist?› dachte Dinny. Das Lächeln des Mädchens wirkte so seltsam prickelnd.
«Das ist Jeanne», erklärte Lady Mont. «Meine Nichte Dinny Cherrell.»
Mit festem Druck umschloß eine schlanke braune Hand Dinnys Rechte.
«Wo ist Ihr Vater?» fragte Lady Mont.
«Fort. Bei irgendeinem Pfarrkonzil. Ich habe ihn gebeten, mich mitzunehmen, doch er ist lieber allein gefahren.»
«Dann ist er vermutlich in London und geht ins Theater.»
Dinny sah, wie das Mädchen der Tante einen raschen Blick zuwarf, sich dann drauf besann, daß sie Lady Mont vor sich habe, und lächelte. Der junge Mann lachte hell auf.
«Ihr kommt doch beide zum Dinner. Schön! Also um viertel neun. Dinny, wir müssen zum Lunch zurück. Schwalbenschwanz!» klang es noch unter Lady Monts Hutrand hervor, dann verschwand sie durch die Tür.
«Sie haben Gesellschaft im Haus», erklärte Dinny dem jungen Mann, der die Brauen emporzog. «Sie meint Frack und weiße Krawatte.»
«Ach so!» erwiderte Alan. «Jeanne, wirf dich in Staat!»
Die Geschwister standen Arm in Arm in der Halle. ‹Ein anziehendes Geschöpf!› dachte Dinny.
«Nun?» fragte die Tante auf dem grasbewachsnen Weg.
«Hm! Wahrhaftig, eine Leopardin! Schön ist sie freilich, aber mir scheint, man muß sie an der Leine halten.»
«Da ist Boswell und Johnson!» rief Lady Mont, als handle es sich um eine Person. «O Gott! – da muß es zwei Uhr vorbei sein.»