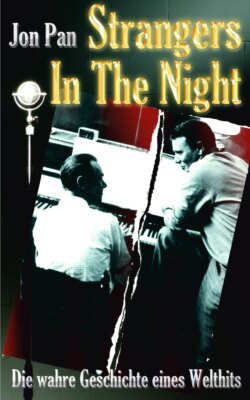Читать книгу STRANGERS IN THE NIGHT - Jon Pan - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gib dem Menschen eine Uniform ...
ОглавлениеHerbert Rehbein, geboren am 15. April 1922 in Hamburg, wuchs in einer bürgerlichen Umgebung auf, liebevolle Mutter, Vater Polizeibeamter, ein jüngerer Bruder. Schon früh hatte er den Wunsch, ein Instrument zu spielen. Ein Klavier, das er gerne gehabt hätte, war zu teuer. Er bekam eine Geige. Die Auflage lautete: Schule an erster Stelle, dann erst die Musik! Rehbein schaffte prompt das Abitur nicht. Dafür erhielt er ein Stipendium und fing im Vogtschen Konservatorium in Hamburg ein Musikstudium an.
Damit war der Weg zur brotlosen Kunst eingeschlagen. Für Rehbein gab es ohnehin nur Musik, also dachte er nicht an Brot. Er sang zusätzlich im Kirchenchor, die Matthäuspassion in der St.-Michaelis-Kirche. Dann kam die Hitlerjugend.
Er schummelte sich durch, ließ diejenigen machen, die es machen wollten. Einer der Jungen, der ihn mochte, stellte sich schützend vor ihn. Rehbein quittierte mit kleinen Gefälligkeiten. Sämtliche Ideologien stießen ihn ab, so dachte er schon in jungen Jahren: »Gib dem Menschen eine Uniform, und du lernst ihn erst wirklich kennen!« Für diese Welt war er nicht gemacht.
In der Welt der Musik hingegen fühlte er sich wohl. Das entsprach seinem Wesen. Er übte täglich Geige, oft bis zu zehn Stunden. Alles oder nichts. Zusätzlich nahm er Privatunterricht bei Professor Gerstekamp, einem Mann aus der Philharmonie. Rehbeins Begabung blieb dem Professor nicht verborgen. Die beiden mochten sich. Gerstekamp verstand, wie er mit Rehbein umzugehen hatte. Kein Zwang, sondern subtile Förderung der Begabung.
Draußen zog eine Fratze am Horizont auf: Krieg! Zehntausend Geigen hätten dem Donnern der Gewalt nicht standhalten können. Die Nazis wüteten schon lange, Hitler schürte eine Krankheit, die sich bald über ganz Europa, bis hin nach Afrika, ausbreiten sollte. Der Klang der Geige verstummte. Wehrmacht hieß es für Rehbein. Junge, unverbrauchte Männer waren gefragt. Rehbein wollte zum Musikkorps. Als Geiger hatte er da natürlich keine Chance, also stieg er für diesen Zweck auf Klarinette um. Er musste in Lübeck einrücken. Kasernendrill. Die Ausbildung ging schnell. Rehbein kam nach Kreta
Der Krieg tobte. Kreta blieb vorerst verschont. Rehbein verschrieb sich auch dort voll und ganz der Musik. Doch die Strenge der Klassik ließ ihm zu wenig Raum, engte ihn ein, obwohl er das Orchestrale liebte. Er gründete ein Tanzorchester, dem er als Kapellmeister und Geiger vorstand. Sehr schnell machte er sich unter den Soldaten einen Namen. Er brauchte diese Sonderstellung, um zu überleben.
Aus einem Brief eines ehemaligen Kriegskameraden an Rehbein:
»Die 22. I. D., bzw. das 16. Infanterie-Regiment, lag mit seiner Stabskompanie auf Kreta in den Ortschaften Rethimnon, zuletzt in Neapolis. Unser Kommandeur war Oberstleutnant Haag und später Major Bruns. Ich z.B. war im Zugtrupp des Pak-Zuges bei Leutnant Giesel und Sie in der Regimentskapelle, die mit ihrem Tanzorchester an so manchem Abend im Soldatenheim für Stimmung sorgte. Wie oft habe ich zu Hause von dieser Zeit gesprochen und dabei von der Eroberung der italienischen Instrumente und Noten erzählt. Kamen dabei doch so tolle Sachen wie der › Schwarze Panther ‹ und › Mary Lou ‹ zum Vorschein. Was waren das für schöne Stunden, als Sie als Kapellmeister mit dem Tanzorchester diese beiden Hits immer wieder spielen mussten. Den Alltag auf Kreta verbrachten Sie oft bei uns im Pak-Zug, und dadurch lernten wir uns näher kennen. Sie sprachen damals schon von moderner Musik und meinten, dass man sich eines Tages damit auseinandersetzen müsste. Sie spielten in der Regimentskapelle schon eine besondere Rolle.«
Eines Nachts musste Kreta Hals über Kopf geräumt werden. Flug nach Athen. Von dort aus folgte ein Gewaltsmarsch durch Jugoslawien, der »Wandernde Kessel« genannt. Eine ganze Division bewegte sich mühsam vorwärts, über Pässe, ständigen Angriffen und Überfällen von Partisanen, russischen Bombern und Tieffliegern ausgesetzt. Sämtliche Musikkorps waren aufgelöst worden. Aus Rehbein wurde »Schütze Rehbein«.
Die Musikinstrumente des Unterhaltungsorchesters reisten mit, versteckt in einem Küchenwagen. Die Soldaten litten immer mehr. Irgendwann kamen sie nicht mehr weiter, harrten wochenlang in den Wintermonaten bei Schnee und Eis in den Bergen aus, kämpften sich endlich durch.
Am 15.5.1945, nach neun Monaten Fußmarsch, erreichte sie in der Nähe von Celje, etwa vierzig Kilometer vor der österreichischen Grenze, die Kapitulation. Die Division, der Rehbein angehörte, hatte ganz Jugoslawien hinter sich gelassen, von Griechenland aus bei Cevgelija über die Grenze, auf Skopje zu, an Pristina vorbei nach Sarajevo, von dort aus nach Luka, weiter nach Zagreb.
Titos Partisanen gingen mit den »Schwabos« nicht zimperlich um. Die Gefangenen wurden entwaffnet. Essen gab es keines. In der Nacht versuchten einige Deutsche zu fliehen, wollten hinüber ins nahe liegende Österreich, um sich von den Amerikanern gefangen nehmen zu lassen. Die Schüsse verrieten, was mit ihnen geschah. Nur wenigen gelang die Flucht. Auf all die anderen, einschließlich Rehbein, wartete eine unbeschreibliche Tortur.
Der Zug der Gefangenen setzte sich in Richtung Belgrad in Bewegung. Bis auf eine wässerige Suppe hatte es in den letzten Tagen nichts zu essen gegeben. Jetzt konnten sich die Partisanen endlich an dem verhassten Feind rächen. Sie trieben die Gefangenen mit Gewehrkolben voran. Männer wurden grundlos erschossen. Endloser Hass regierte.
Rehbein steckte mitten drin. Wer noch gute Schuhe hatte, musste sie abgeben. Also zerschnitten die Gefangenen ihre noch guten Schuhe mit Rasierklingen, präparierten sie geschickt. Die Schuhe sahen danach völlig kaputt aus, ließen sich aber noch tragen. Längst mussten sich viele Männer Lumpen um die Füße wickeln. Auch Rehbein. Der Hunger wurde immer schlimmer. Die Gefangenen rissen Blätter von den Bäumen, stopften sie sich in den Mund, knieten sich hin, fraßen Gras. Krankheiten breiteten sich aus, vor allem die Ruhr mit schleimigblutigen Durchfällen. Die Folge waren nicht selten Darmdurchbrüche und Bauchfellentzündungen. Die Kranken, von rasenden Leibschmerzen gequält, mussten sich immer wieder an den Straßenrand hocken. Sie schissen sich dort fast die Därme aus dem Bauch. Wer nicht mehr mitkam, wurde erschoßen oder niedergeknüppelt und liegen gelassen.
Wochen vergingen. Die Partisanen trieben die »Schwabos« unbarmherzig voran. Der lange Zug, »Hungermarsch« genannt, bot ein Bild des Entsetzens. Ausgemergelte Gesichter, zerlumpte Gestalten, frierend oder im Fieberwahn, mit Läusen übersäht, die ganze Trauben bildeten, voran, auf Belgrad zu ...
Die Bevölkerung von Belgrad erwartete sie mit Spott, Hohn und Verachtung. Im Laufschritt wurden die Gefangenen durch die Straßen gejagt, bespuckt und mit Steinen beworfen. Jetzt erreichte der angestaute Hass seinen Höhepunkt. Als sie endlich die Donau erreichten, war der Spuk noch lange nicht vorbei.
Im Banat angekommen, begann das große Sterben. Es gab wieder zu essen – Suppen mit Fett –, und gerade darin verbarg sich der Tod. Gift für die ausgehungerten, von Krankheiten geschwächten Mägen der Gefangenen. Die Entlausung war für Rehbein eine Tortur gewesen. Jetzt stand er wieder da, nackt und noch verletzlicher als vorher. In den Baracken wimmelte es von Wanzen und Ratten. Nichts war vor ihnen sicher.
Im September 1945 hieß es für Rehbein, der sich mitunter etwas erholt hatte: Maishacken!
Im Banat hatten Volksdeutsche Landwirtschaft betrieben. Jetzt war alles in jugoslawischer Hand: Partisanen aus Titos Gefolgschaft, harte Naturburschen, die jahrelang gekämpft und in den Bergen überlebt hatten. Sie trugen stolz das Partisanenkäppi mit dem Sowjetstern. Ihre Gesichter zeigten wenig Mitgefühl mit ihren ehemaligen Feinden – den »Schwabos«, die sie allesamt für Hitlers Faschisten hielten. Sie hatten sich in den großen Gutshöfen eingenistet und hausten dort teilweise unter seltsamen Umständen. Rehbein sah, wie in einem der häuslich eingerichteten Zimmer eine Feuerstelle auf dem Parkettboden errichtet wurde, dazu ein Loch in der Decke, damit der Rauch abziehen konnte. Wo früher tausend Schweine gemästet worden waren, hielten sich die Eroberer jetzt ein Schwein und eine Kuh. Eine andere Lebensform war ihnen nicht bekannt, sie hätten auch gar nicht damit umgehen können.
Das Maishacken war eine harte Arbeit. Wochenlang musste auch Rehbein diese Anstrengung aushalten. Dann wurde er ins Lazarett im Lager Pancevo abkommandiert.
Die Luft in den Baracken mit den Kranken war unerträglich. Täglich starben viel zu viele Gefangene. Der beißende Gestank von Urin, Kot und Eiter hing stickig in den Räumen. Rehbein gab sein Bestes. Die Männer hier waren seine Kumpels. Das wollte er sie spüren lassen. Und trotzdem war er manchmal weit weg von allen.