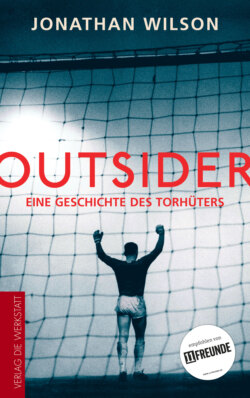Читать книгу Outsider - Jonathan Wilson - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 2
Lew Jaschin und seine Nachfolger
In der Welt der Torhüter steht ein Name über allen anderen: Lew Jaschin. Ob er der beste Torhüter aller Zeiten war, sei dahingestellt. Doch mit Sicherheit wurde keiner so viel gepriesen wie er, und auch an seinen Kultstatus kommt bis heute kein Torhüter heran. Ganz und gar in Schwarz gekleidet, was ihm den Spitznamen „Schwarzer Panther“ einbrachte (oder „Schwarze Spinne“, je nachdem, in welchem Land er sich gerade aufhielt), wurde er für das Publikum im Westen zum Sinnbild minimalistischen sowjetischen Schicks. In seiner Heimat war er ein Nationalheld, zurückhaltend, gewissenhaft und mutig. „Alles, was Jaschin tat, war vom Feinsten“, sagte sein großer englischer Zeitgenosse Gordon Banks. „Er hielt vorzüglich, konnte Flanken abfangen und war außerdem ein echter Gentleman. Bei der Weltmeisterschaft 1966 rettete er einen Ball vom Fuß eines Kerls, der ihm dabei fast den Kopf abgehauen hätte. Gleich danach stand er auf, um sich zu vergewissern, dass es dem Burschen, der ihn fast weggetreten hatte, gut ging.“
Jaschin fehlte die Extravaganz vieler anderer großer Spieler, und er übte auch ganz offen scharfe Kritik an den Ausschweifungen von Eduard Strelzow, der zeitweise sein Nationalmannschaftskollege war. Unbestritten besaß Jaschin jedoch großes Charisma. Sein Name steht bis heute für ganz großes Torwartspiel. So sagt man über einen Torhüter, der es in der russischen Liga auf 100 Spiele ohne Gegentreffer bringt, dass er es in den Jaschin-Klub geschafft habe. Und die FIFA zeichnet bei jeder Weltmeisterschaft den besten Torhüter mit dem Lew-Jaschin-Preis aus. Doch sein Vermächtnis ist für die nachfolgenden Torhütergenerationen seit jeher auch eine Last. Denn genauso, wie man jeden vielversprechenden jungen Allrounder im englischen Cricket sofort als den neuen Botham tituliert, gilt auch jeder hoffnungsvolle junge Torhüter in Russland als der nächste Jaschin, als ob sich seine Genialität von Generation zu Generation vererben müsse.
Kein Land vergöttert seine Torhüter so sehr wie Russland. Zwar lassen sich solche Dinge schwer in Zahlen ausdrücken, aber es scheint doch so zu sein, dass die meisten britischen Schulkinder am Anfang immer vorne spielen und Tore schießen wollen, um so den ganzen Ruhm einzuheimsen, während die Schulkinder in Russland lieber der letzte Mann in dem andersfarbigen Trikot sind. Das Ansehen von Jaschin hat selbstverständlich seinen Teil zu diesem Phänomen beigetragen. Der kleine Billy Casper in dem Spielfilm Kes hätte in einer russischen Version des Films am Ende wohl kaum im Angriff gespielt, und der Sportlehrer hätte sicherlich nicht nach dem roten Trikot mit der Nummer neun, also dem von Bobby Charlton, gegriffen, sondern nach dem schwarzen Jersey mit der Eins.
Genau genommen war Jaschins Trikot allerdings gar nicht schwarz. „Es war ein sehr dunkles Blau – ein Wollpullover mit einer auf den Rücken genähten Eins“, verriet seine Witwe Walentina Timofejewna Jaschina. „Ich denke mal, dass damals alle Tormänner dunkle Kleidung getragen haben. Als ich im Jahr 2000 in Lews Namen den Preis für den Tormann des Jahrhunderts überreicht bekam, hat Sepp Maier gesagt: ‚Früher haben alle Torhüter Schwarz getragen, damit man sie nicht mit jemand anders verwechseln konnte. Heute sind sie rot, gelb, blau – wie die Papageien.’“
Und weiter: „Lew hat immer in dieser Farbe gespielt. In 20 Jahren hat er sein Trikot nur zwei- oder dreimal gewechselt, wenn die Ärmel schon ganz löchrig waren. Dann hat er immer eins in der gleichen Ausführung genommen. Die Plätze waren besonders im Frühjahr und Herbst matschig, und auf einer dunklen Kluft ist der Schmutz nicht so aufgefallen. Wenn er seine Spielkleidung mit nach Hause brachte, wurde das ganze Badezimmer schwarz und überall war Sägemehl – damit hat man die Strafräume eingestreut, damit die Tormänner nicht im Schlamm versanken.“
Er zog auch bei wärmstem Wetter nichts anderes an. „Seine Kleidung hat verhindert, dass er sich verletzte“, erklärte Walentina. „Und er hat immer wattierte Hosen drunter gehabt. Er ist sauer auf Mannschaftskameraden geworden, die keine getragen haben. ‚Glaub mir’, hat er immer gesagt, ‚ohne kann man nicht spielen. Man kann sich die Oberschenkel verletzen. Blaue Flecken kriegt man garantiert, die Muskeln werden reißen, und dann hat man beim nächsten Mal Angst, zu Boden zu gehen. Und wie soll man dann im Tor spielen, wenn man Angst hat?‘“
Walentina besitzt immer noch einen Kühlschrank, den Jaschin dank seines Ansehens als Fußballspieler bekommen hatte, dafür hat sie – und das ist bemerkenswert – keines der legendenumwobenen dunklen Trikots mehr. „Zur damaligen Zeit musste man alles zurückgeben“, erzählte sie dem Journalisten Igor Rabiner. „Sogar nach Lews Abschiedsspiel 1971 hat Dynamo ihm eine Aufforderung geschickt, die Spielkleidung zurückzugeben – sogar die Handschuhe, die er selbst genäht hatte, wenn sie aufgerissen waren. Wir haben darüber gelacht, aber er hat alles zusammengesucht und zurückgegeben. Er hat kein einziges Dynamo-Trikot behalten. Es war jedes Jahr die gleiche Geschichte: Am Ende der Saison musste ich seine ganze Ausrüstung durchwaschen, damit wir sie in gutem Zustand abgeben konnten.
Er hat nur ein Trikot behalten, und das war ein gelbes mit der Nummer 13, kein schwarzes mit der Eins. Er hatte es bei dem berühmten Spiel mit der Weltauswahl gegen England getragen, bei dem er vor den Augen der ganzen Welt zu null spielte. Keiner wollte die Dreizehn tragen, aber Lew sagte: ‚Alles klar, her damit – stört mich nicht.’ Er hat ein tolles Spiel gemacht und die Dreizehn hinterher als seine Glückszahl betrachtet.“
Neben seinen Trikots war Jaschins Markenzeichen seine Mütze. Wenn er es mit einer hohen Flanke zu tun bekam, nahm er gelegentlich sogar die Mütze ab, köpfte den Ball weg und setzte die Mütze dann wieder auf. „Das ist oft vorgekommen“, sagte Walentina, „aber nur, wenn keiner in der Nähe war. Zu der Zeit waren die Strafräume ja noch nicht so voller Leute wie heute.“ Zunächst jedoch hatte Jaschin die Bälle noch mit aufgesetzter Mütze weggeköpft. „Als er das zum ersten Mal gemacht hatte, kam er in die Umkleide und ließ seinen Kopf hängen“, erzählte Walentina. „Er dachte, dass [Dynamos Trainer Michail] Jakuschin ihn kritisieren würde, der konnte nämlich manchmal ganz schön bissig sein. Aber er sagte nichts. Lew fragte: ‚Stimmt was nicht?’ ‚Nein, alles prima’, hat ihm Jakuschin geantwortet. ‚Aber du musst die Mütze abnehmen.’ Die Fans fanden das toll und reagierten jedes Mal mit einem Jubelsturm. Ein paar Mal hat er den Ball noch ohne die Mütze geköpft, aber dann hat er damit aufgehört, weil das Spiel schneller und härter wurde.“
In der Sowjetunion, also in einer Uniformität verlangenden kommunistischen Gesellschaft, war die Individualität und das Außenseitertum des Torhüters natürlich etwas Besonderes. Der Gedanke liegt nahe, dass das Torhüten eine der seltenen Möglichkeiten bot, die eigene Individualität zum Ausdruck zu bringen, losgelöst vom Kollektiv, und dass genau deshalb diese Position so beliebt war. Aber auch wenn daran etwas dran ist, war Jaschin doch kein Dissident, und das Torwartspiel besaß auch schon vor der Revolution von 1917 eine herausgehobene Stellung in Russland.
Wladimir Nabokow, 1899 in St. Petersburg in eine Aristokratenfamilie hineingeboren und nach der Revolution aus Russland geflohen, schrieb in seiner Autobiografie Erinnerung, sprich, dass er als junger Mann „mit Begeisterung Torwart“ gewesen sei. Tatsächlich scheint Fußball zu den wenigen Dingen zu gehören, an die er sich im Zusammenhang mit seinem Studium in Cambridge unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg noch gut erinnern konnte. Es gab die „hellen, heldischen Tage“, an denen ihm „die geglückte Abwehr“ gelang und deren „lange anhaltendes Prickeln“ er in seinen Handflächen spürte. Doch es gab auch die Partien unter „trostlosem Himmel“, wenn „der Boden um das Tor herum zu schwarzem Schlamm aufgeweicht war, der Ball fettig wie ein Plumpudding“, wenn sich der Nebel sammelte und „die ramponierten Krähen“ um eine „entblätterte Ulme“ krächzten und er „den Ball glücklos verfehlte“. In seiner Vorliebe für die Position sah sich Nabokow als typisch für sein Land. Er schrieb:
„In Russland und in den romanischen Ländern ist jene Kunst immer von der Aura eines beispiellosen Glanzes umgeben gewesen. Erhaben, einsam, unbeteiligt, so schreitet der Held des Fußballtores durch die Straßen, verfolgt von hingerissenen kleinen Jungs. Er wetteifert mit dem Matador und Flieger-Ass als ein Gegenstand verzückter Verehrung. Sein Pullover, seine Schirmmütze, seine Knieschoner, seine Handschuhe, die aus der Gesäßtasche seiner kurzen Hosen ragen, heben ihn von der übrigen Mannschaft ab. Er ist der einsame Adler, der Geheimnisvolle, der letzte Verteidiger. Fotografen, ein Knie ehrwürdig gebeugt, knipsen ihn, wenn er sich mit einem spektakulären Kopfsprung quer über die Öffnung des Tores wirft, um mit den Fingerspitzen einen niedrigen, blitzartigen Schuss abzuwehren, und beifällig brüllt das ganze Stadion, während er in dem unversehrten Tor noch einen Augenblick der Länge nach liegenbleibt, wie er fiel.“
Die englische Mentalität kam dem Torhüter laut Nabokow nicht gerade zugute: „Der nationale Horror vor aller Angeberei und eine zu humorlose Vorliebe für solide Teamarbeit [waren] der Entwicklung der exzentrischen Art des Torwarts immer abträglich.“ Umso bemerkenswerter ist es, dass so viele der begabten britischen Torhüter der Anfangsjahre oft ganz bewusst ein besonders skurriles Verhalten an den Tag legten.
Die russische Liebe zum Torhüter zeigte sich auch am Erfolg des Filmes Wratar, einem Singspiel unter der Regie von Semjon Timoschenko. Hauptdarsteller war der russische Leinwandbeau Grigori Pluschnik in der Rolle des Anton Kandidow. Kandidow verdient sich sein Geld damit, Wassermelonen auf einen Karren zu stapeln. Er ist so gut darin, die herunterfallenden Melonen aufzufangen, dass er einem Talentspäher auffällt, der ihn in seine Mannschaft holt. Der Höhepunkt des Films ist schließlich, wie Kandidow nach einer Reihe von Glanzparaden gegen eine tourende baskische Mannschaft über den gesamten Platz rennt und in der letzten Minute das Siegtor schießt. Für den Fall, dass jemand die politische Botschaft dahinter nicht verstand, hieß es in dem bekanntesten Lied des Films: „Hey, Keeper, mach dich bereit für den Kampf. / Du bist der Wachposten im Tor. / Stell dir vor, hinter dir ist eine Grenze.“
Der Film basierte auf Lew Kassils 1936 erschienenem Roman Wratar Respubliki („Der Torwart der Republik“), der wesentlich düsterer ist als das Singspiel. In dem Buch schließt sich der riesengroße, „impulsive“ Kandidow der Gemeinde Gidraer an, um in ihrer Fußballmannschaft im Tor zu spielen. Dann aber geht er zu dem namhafteren Team von Magneto, das bald zu einer Reise durch Europa aufbricht. Dort wird er von seinen neuen Freunden und fremden Einflüssen verdorben. Nach seiner Rückkehr verliert Magneto gegen Gidraer, „wegen ihres fehlenden Zusammenhalts und vor allem wegen Kandidows unüberlegter, individualistischer Entscheidung, seinen Platz zwischen den Pfosten in einem entscheidenden Spielmoment zu verlassen“, wie Keith A. Livers in einem Aufsatz in der Fachzeitschrift The Russian Review feststellte. Tief beschämt geht Kandidow in sich und bringt sich versehentlich beinahe um, als er seinen Gashahn nicht abdreht. Doch am Ende kehrt er wieder zu Gidraer zurück. Im Kern ist das Ganze eine kommunistische Variante der Parabel vom verlorenen Sohn. Auch hier ist die politische Botschaft eindeutig, und auch hier ist es offenkundig von großer Bedeutung, dass der Torhüter der Ausgestoßene, der Alleingelassene ist, der wieder eingegliedert werden muss, um sich seine Erlösung zu verdienen.
Wratar Respubliki war nicht der erste russische Roman, in dem es um Fußball ging. Den Höhepunkt in Juri Oleschas Roman Zavist, auf Deutsch unter dem Titel Neid erschienen, bildet ein Fußballspiel zwischen einer sowjetischen und einer deutschen Mannschaft. Held der Partie ist Torhüter Wolodja Makarow, dem das Hemd in Fetzen gerissen wird bei seinen Versuchen, dem Angriff der Deutschen zu widerstehen, die in der ersten Halbzeit mit starkem Rückenwind spielen. „Wolodja fing den Ball selbst dann, wenn es mathematisch unmöglich schien. […] Der Schiedsrichter setzte im Laufen die Pfeife an die Lippen, um ein Tor zu pfeifen. […] Wolodja fing den Ball nicht, er riss ihn aus seiner Bahn, und da er gegen die Physik verstieß, musste er sich der betäubenden Wirkung der empörten Naturkräfte unterwerfen. Er flog zusammen mit dem Ball, er drehte sich, er schraubte sich fast auf ihn zu, er nahm den Ball mit dem ganzen Körper, mit Knien, Bauch und Kinn, er warf sein Gewicht der Geschwindigkeit des Balles entgegen, wie wenn man einen Lappen auf einen glimmenden Funken wirft. Die gebremste Geschwindigkeit des Balles schleuderte Wolodja zwei Meter seitwärts, er fiel wie eine Bombe aus Papier.“
Deutschlands Star Getzke, ein Stürmer, wird als selbstsüchtiger Individualist dargestellt. Demgegenüber ist Wolodja der engagierte Mannschaftsspieler, der Kandidow in Kassils Roman erst noch werden muss. „Wolodja war ein Sportler, der andere ein Berufsspieler. Wolodja war der allgemeine Verlauf des Spiels wichtig, der allgemeine Sieg, der Ausgang –, Getzke strebte nur danach, seine Kunst zu zeigen.“ An anderer Stelle wird Wolodja als der ideale moderne Sowjetmensch charakterisiert. Der gesamte Roman beschäftigt sich mit der Beziehung des Einzelnen zur Gesellschaft und zeigt sowohl die Schwächen des kommunistischen wie auch des bürgerlichen Modells auf. Wolodja ist ein Individuum, das für die Mannschaft alles gibt. Es wird deutlich, dass die Position des Torhüters ideal für Einzelgänger ist: Auch wenn der Torhüter immer abseits seiner Mannschaftskameraden steht, ist sein Einsatz, sein Können doch darauf gerichtet, das Beste für das Kollektiv herauszuholen. Damit dient der Torhüter womöglich als Vorbild für alle eigenwilligen Individuen, ja Künstler in einem sozialistischen System.
Besonders spannend in Bezug auf Wratar ist die Geschichte von Nykolaj Trussewitsch, des ukrainischen Torwarts, der zumindest teilweise als Vorlage für Kandidow diente. Er war groß und dunkelhaarig und machte sich in den 1930er Jahren, als man erstmals eine Landesmeisterschaft austrug, einen Namen als einer der besten Torhüter der UdSSR. Seine Karriere begann er in Odessa bei Pischtschewik, wechselte 1929 zu Dynamo Odessa und 1935 schließlich zu Dynamo Kiew, der Mannschaft der lokalen Geheimpolizei. Es war das Jahr, in dem Kassil seinen Roman vorbereitete. Dynamo unternahm damals eine Gastspielreise nach Frankreich und hatte gegen die erfahreneren Gegner einige Probleme. Trussewitsch war die zweite Wahl hinter Anton Idzkowski, der jedoch kurz vor einer Partie gegen Red Star Olympique in Paris erkrankte. Man erwartete einen ungefährdeten Sieg von Red Star, doch nach seiner überraschenden Berufung machte Trussewitsch ein ganz großes Spiel, und Dynamo Kiew gewann 6:1 – auch wenn Trussewitsch nicht selbst traf wie Kandidow in Wratar.
Trussewitsch kehrte als Held zurück. Sein Ansehen nahm dank seiner flotten Kleidung und seines guten Humors noch zu, auch wenn es durch seine gelegentlich etwas impulsive Art etwas beschädigt wurde. Nach einem 9:1-Sieg gegen eine tourende türkische Mannschaft versuchte er beispielsweise, die betretenen Gäste durch den bald so genannten „Tanz des Torhüters“ wieder aufzuheitern. Dazu ahmte er seine Bewegungsabläufe auf dem Platz nach, fiel immer wieder nach vorne und drückte sich dann im letzten Moment mit den Händen wieder nach oben.
In Wratar hatte die Kunst noch das Leben imitiert. Nach dem Überfall Nazideutschlands im Jahr 1941 wurde Trussewitsch dann tatsächlich zum Sinnbild für die zentrale Botschaft des Romans. Nicht wenige Ukrainer sahen die Invasion als Möglichkeit, das sowjetische Joch abzuschütteln, und kollaborierten mit den Deutschen. Trussewitsch jedoch war ein überzeugter Kommunist. Nachdem er seine jüdische Frau und seine Tochter nach Odessa geschmuggelt hatte, kämpfte er auf der Seite des Widerstands. Kurz vor dem Fall Kiews bekam er einen Schuss ins Bein, wurde gefangengenommen und in ein Lager bei Darnyzia gesperrt. Nachdem er einen Treueeid unterzeichnet hatte, wurde er wieder entlassen. Offenbar kehrte er danach zu seiner Wohnung zurück und fand sie zerstört vor. Somit war er gezwungen, auf der Straße zu leben, gepeinigt von der Trauer um seine Stadt. Dazu kamen die Schuldgefühle, weil er sich der deutschen Herrschaft unterworfen hatte. Als er einige Monate später an einem Café vorbeiging, sah ihn ein Bäckereileiter namens Josef Kordyk.
Der dicke, rosahäutige Kordyk war ein Tscheche aus Mähren, der während des Ersten Weltkriegs auf deutscher Seite gekämpft hatte. Die sowjetischen Behörden hatten ihm die Rückkehr in die Heimat zunächst nicht erlaubt, und so war er nach dem Waffenstillstand von 1918 in der Ukraine gestrandet. Während er um seinen Platz im Leben kämpfte, wurde Fußball sein liebstes Vergnügen und er selbst ein begeisterter Anhänger von Dynamo. Doch obwohl er heiratete und eine Tochter bekam – wohl auch der Grund, weshalb er nach der Aufhebung des Heimkehrverbotes in der Ukraine blieb –, scheint er nachtragend gegenüber den Sowjets gewesen zu sein. Für ihn war die deutsche Invasion deshalb eine Chance. Mit der Lüge, gebürtiger Österreicher zu sein, beanspruchte er den Status eines Volksdeutschen und wurde mit der Leitung einer Bäckerei betraut.
Kordyk erkannte Trussewitsch wieder und stürzte aus dem Café, um mit ihm zu reden. Nachdem er sich Trussewitschs Geschichte angehört hatte, bot er ihm einen Arbeitsplatz und ein Bett für die Nacht in der Bäckerei an. Als er erfuhr, dass noch weitere Spieler mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten, besorgte er auch ihnen Arbeitsplätze.
Da die Deutschen sehr darauf aus waren, das Leben in der Stadt wieder zu normalisieren, gestatteten sie im Frühjahr 1942, dass wieder Fußball gespielt werden durfte. Da inzwischen einige ehemalige Dynamo-Spieler für ihn arbeiteten, lag es nahe, dass auch Kordyk eine Mannschaft meldete. Sie firmierte unter dem Namen „Start“. Anfangs war Trussewitsch dagegen, in einem Wettbewerb der Deutschen mitzuspielen. Man konnte ihn aber davon überzeugen, dass sie, wenn sie erfolgreich spielten, zum Sammelbecken für die Opposition werden konnten, zudem man auch noch einen Posten roter (und damit kommunistisch anmutender) Trikots ausfindig gemacht hatte.
Start schlug alles, was ihnen vor die Rohre kam. Man zerpflückte ein ungarisches Garnisonsteam mit 6:2 und eine rumänische Truppe mit 11:0. Da Start immer berühmter wurde, kamen immer mehr Zuschauer. Am 17. Juli 1942, einem Freitag, wurden erste Anzeichen von Unbehagen auf Seiten der Behörden erkennbar, nachdem die deutsche Garnisonsmannschaft PGS mit 0:6 verloren hatte. Erstmals erschien in der Zeitung Nowo Ukrainski Slowo ein Spielbericht, und zwar von einem Schreiber, der sich „RD“ nannte. Er versuchte, die Niederlage mit dem rumänischen Schiedsrichter und dem holprigen Platz zu entschuldigen, und wies darauf hin, dass PGS Trainingsrückstand hatte. Außerdem sei Start zehnmal im Abseits gestanden, die Deutschen dagegen überhaupt nicht.
Zwei Tage darauf gewann Start mit 5:1 gegen MSG, ebenfalls eine ungarische Garnisonsmannschaft. Ihr gehörten allerdings auch ehemalige Profispieler an, die das Training durchaus ernst nahmen. Dieses Mal konzentrierte sich der Bericht von RD besonders auf die Tatsache, dass die Ungarn bereits frühzeitig einen Mann wegen Verletzung verloren hatten und den Großteil des Spiels deshalb mit nur zehn Mann bestreiten mussten. In der Woche darauf kam es zu einem Revanchespiel, das offenbar vom Kapitän der Ungarn organisiert worden war. Start legte rasch eine 3:0-Führung vor, bekam dann aber noch zwei Gegentore. Es scheint ein tolles Match gewesen zu sein, und die Ungarn geizten nach dem Spiel auch nicht mit Lob für Start.
Am gleichen Tag kickte die Flakelf, eine Luftwaffenmannschaft mit einer Reihe ehemaliger Profis, gegen Ruch, ein Team aus ukrainischen Nationalisten, die große Sympathien für das neue Regime hegten. Dabei handelte es sich wohl um ein Trainingsspiel vor der Partie gegen Start, in der die Überlegenheit der Deutschen gegenüber dem slawischen „Untermenschen“ wiederhergestellt werden sollte.
Am 28. Juli gab Stalin als Reaktion auf den Verlust von Rostow am Don den Befehl Nr. 227 aus, auch bekannt als „Keinen Schritt zurück“: „Panikmacher und Feiglinge sind auf der Stelle zu vernichten. […] Die Rückzugsstimmung der Truppe muss bedingungslos unterbunden werden. […] Armeekommandeure, welche ein eigenmächtiges Verlassen der Stellungen […] dulden, sind sofort ihrer Posten zu entheben und vor ein Kriegsgericht zu stellen.“ Der Befehl wurde von Widerstandsgruppen in Kiew verbreitet, und mit Sicherheit werden ihn auch die ehemaligen Fußballspieler in der Bäckerei gelesen haben.
Start spielte am 6. August, einem Donnerstag, gegen die Flakelf. Trotz erhöhter deutscher Präsenz auf den Zuschauerrängen war die Menschenmenge im Zenitstadion kleiner als gewöhnlich, wahrscheinlich, weil das Spiel unter der Woche stattfand. Start siegte mit 5:1, allerdings erschien in der Nowo Ukrainski Slowo kein Bericht, und weitere Einzelheiten sind nur schwer herauszufinden. Am nächsten Tag tauchten Plakate in Kiew auf, die auf Deutsch und Russisch Werbung für eine „FUSSBALL SPIEL REVANCHE“ am 9. August machten.
Dieses Mal war das Stadion bis auf den letzten Platz besetzt, und auf Seiten der Deutschen war man fest entschlossen, nicht zu verlieren. Die vielen Legenden zu durchdringen, die sich um das Spiel ranken, ist unmöglich. Es scheint aber, dass der Schiedsrichter ein Deutscher war. Ob er aber wirklich ein zur Glatze neigender SS-Offizier mit fließenden Russischkenntnissen war, wie von manchen behauptet wird, ist äußerst ungewiss. Es heißt, dass er die Start-Spieler vor dem Anpfiff warnte, auch ja den Hitlergruß zu zeigen. Die sollen das ignoriert und stattdessen die Hand aufs Herz geschlagen und „Fizkult-Hurra!“ gerufen haben, den traditionellen Ausruf sowjetischer Sportler. „Fizkult“ ist eine Abkürzung für „Fizitscheskaja kultura“, was so viel bedeutet wie „Körperkultur“, während „Hurra!“ deutlich aggressiver besetzt ist als im Deutschen und auch der Schlachtruf sowjetischer Truppen auf dem Weg in den Kampf war.
Ein Plakat kündigt das Match an, das später als „Todesspiel“ in die Geschichte eingehen sollte.
Doch selbst dieser Vorfall ist umstritten. Noch schwieriger ist es, den Spielverlauf nachzuvollziehen. Nach Kriegsende scheinen die sowjetischen Behörden zunächst so getan zu haben, als ob die Partie überhaupt nicht stattgefunden habe. Sie waren besorgt, dass Dynamo-Spieler womöglich an etwas teilgenommen hatten, das man als Kollaboration auslegen könnte. Bald aber wurde das Spiel zu einem Propagandainstrument, wobei die Kommunistische Partei und unzufriedene ukrainische Nationalisten zwei unterschiedliche Versionen des Geschehens verbreiteten. Als Sporthistoriker Mitte der 1990er Jahre schließlich die Originalquellen zu überprüfen begannen, waren die meisten Augenzeugen bereits tot. Bei den noch Lebenden war die Erinnerung vielfach längst durch die verschiedenen „offiziellen“ Versionen verzerrt worden.
Im Folgenden kann also nur vermutet werden, wie das Spiel abgelaufen sein muss. Anscheinend trat die Flakelf aggressiver auf als in der ersten Begegnung. Mehrere böse Angriffe, insbesondere gegen Trussewitsch, blieben ungeahndet. Die Flakelf ging in Führung, aber Start kam zurück und lag zur Pause mit 3:1 vorn. So viel ist im Großen und Ganzen unumstritten.
In der Pause soll Start dann angeblich zwei Besuche in der Umkleide bekommen haben, und zwar von einem anderen Spieler, einem Nationalisten und Kollaborateur, sowie vom Schiedsrichter. Beide warnten vor den ernsthaften Konsequenzen, sollte Start am Ende gewinnen. Trussewitsch, so heißt es, hielt eine mitreißende Ansprache und forderte seine Mannschaftskameraden eindringlich auf, nichts auf die Drohung zu geben. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit lässt sich am schwersten rekonstruieren. Sicher scheint jedoch, dass jeweils zwei Tore auf beiden Seiten fielen, auch wenn die Reihenfolge strittig ist.
Als Start schließlich vier Minuten vor Schluss mit 5:3 führte, soll der jugendliche Stopper Oleksij Klymenko von hinten angerannt gekommen sein und den Torhüter umkurvt haben. Dann sei er mit dem Ball bis zur Torlinie gelaufen und habe ihn von dort nicht etwa ins Tor, sondern zurück ins Feld gedroschen. Der Schiedsrichter, der sich der Demütigung bewusst war, soll flugs das Spiel unterbrochen haben. Unter den Zuschauern sei es zu Handgemengen zwischen Deutschen und Ukrainern gekommen. Deutsche Würdenträger sollen auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen geschubst worden sein, und Soldaten hätten ihre Hunde losgelassen, um die Menge zu zerstreuen.
In einer Version der Geschichte sollen die Spieler von Start noch auf dem Platz mit Maschinengewehren niedergemäht worden sein, das ist aber mit Sicherheit nicht geschehen. Tatsache ist, dass man am Sonntag darauf gegen Ruch antrat, die Mannschaft der Nationalisten, und diese mit 8:0 besiegte. In der Woche nach dieser Partie wurden die Spieler dann einer nach dem anderen ins Büro der Bäckerei bestellt und verhaftet. Man brachte sie zum Gestapo-Hauptquartier in der Korolenko-Straße und verhörte sie. Sie sollten zu Geständnissen gebracht werden, Saboteure oder Diebe zu sein. Doch keiner knickte ein, und mit Ausnahme des Flügelstürmers Mykola Korotych brachte man die Spieler in das Gefangenenlager Syrez nahe Babyn Jar, der Schlucht, in der 1941 Tausende von Juden einem Massaker zum Opfer gefallen waren. Korotych war zehn Jahre zuvor aktiver Offizier beim NKWD gewesen, dem Vorgänger des KGB. Als man das herausfand, wurde er weitaus härter behandelt als die anderen. Er starb nach 20 Tagen Folter.
Die Gefangenen in Syrez, deren Speiseplan pro Tag nur 150–200 Gramm Brot vorsah, das normalerweise mit einer Suppe aus Eicheln verabreicht wurde, setzte man als Zwangsarbeiter ein. Als einer von ihnen die Flucht wagte, wurde seine gesamte Arbeitseinheit, die aus 18 Leuten bestand, erschossen. Da die Spieler körperlich in besserer Verfassung waren als die meisten anderen Inhaftierten, überlebten sie zunächst den Winter. Doch am 23. Februar 1943, dem Jahrestag der Gründung der Roten Armee, unternahm der Widerstand eine Serie von Bombenangriffen auf deutsche Ziele und zerstörte dabei einen Reparaturbetrieb für Motorschlitten. Einen Tag später folgte die Vergeltungsaktion. Beim Zählappell stellte man die Gefangenen in Reihen auf. Jeder dritte Mann wurde zu Boden geprügelt und erschossen. Iwan Kusmenko, der im zweiten Spiel gegen die Flakelf mindestens einen, wahrscheinlich aber sogar zwei Treffer erzielt hatte, wurde als Erster der Kicker getötet. Klymenko war der Zweite. Als Dritter und Letzter kam Trussewitsch an die Reihe, dessen Heldenmut den von Kandidow weit übertroffen hatte.
Die Geschichte inspirierte einige Filme. Am bekanntesten, zumindest beim westlichen Publikum, ist sicherlich der amerikanische Film Escape to Victory, der in Deutschland unter dem Titel Flucht oder Sieg in die Kinos kam. Er basierte seinerseits auf dem 1961 gedrehten Film Két félidő a pokalban des ungarische Regisseurs Zoltán Fábri (deutscher Titel: Zwei Halbzeiten in der Hölle). Eigenartigerweise findet sich auch eine Variation der Geschichte in dem angeblich autobiografischen Essay des russischen Dichters Jewgeni Jewtuschenko über seine Beziehung zum Sport, der 1966 in Sports Illustrated erschien. Genau wie Albert Camus sah auch Jewtuschenko den Fußball als Metapher. „Allegorische Verse“, so schrieb er, „sind wie das Dribbeln und Antäuschen beim Fußball: eine List, um die Verteidiger in die Irre zu führen, so dass man den Ball ins Tor des Gegners schießen kann.“ Auch er selbst spielte regelmäßig Fußball, anfangs mit „einem Knäuel aus Lumpen“ oder „einer Blechdose“, später dann aber „mit dem echten Ding aus Leder“.
„Ich schwänzte die Schule, um mich auf irgendeiner Freifläche mit meinen Freunden zu treffen“, notierte er, „und wir spielten dann stundenlang ohne Unterbrechung, bis wir erschöpft waren. Die Tore bauten wir uns meist aus einem Haufen Schultaschen, in denen die Übungshefte nutzlos herumlagen.“ Jewtuschenko spielte immer im Tor, wo ihm, wie er versicherte, eine große Zukunft vorherbestimmt gewesen sei, bis er im Alter von 16 Jahren seine ersten Verse veröffentlichte und sich fortan ausschließlich der Poesie widmete.
Er beschreibt etwas genauer ein Spiel „gegen ein Team aus Marjina Roschtscha, einer für seine Raufbolde bekannten Vorstadt von Moskau. Unsere Gegner waren stabil gebaute Kerle mit flacher Stirn und modischen Haarschnitten. Sie hatten beeindruckende Tätowierungen mit Sprüchen wie ‚Vergiss niemals die Mutter’ und ‚Tod den Nazis’ und dazu Abbildungen grinsender Totenköpfe und bärtiger Meerjungfrauen. Auf ihren Körpern trugen unsere Gegner, so stolz, als wären sie eine Zierde, die Narben unzähliger Schlachten.“ Sie waren bekannt als die „Zerstörer“, und es gab Gerüchte, dass sie Messer in ihren Stutzen trugen.
„Wir spielten auf einem großen, brachliegenden Feld hinter einer Wodkabrennerei, wo wir uns Tore aus rostigen Eisenbahnschienen gebaut hatten“, erinnerte sich Jewtuschenko. „Es hatten sich mehrere hundert Zuschauer versammelt, darunter auch die Fans von Marjina Roschtscha, die man anhand ihrer düster-verschwörerischen Ausstrahlung unschwer erkennen konnte. Angeführt wurden diese Claqueure von einem einäugigen Typen um die 30, genannt Billy Bones. Von Beruf war er Lumpensammler, von seinen Vorlieben her allerdings Säufer und Bandit.“ Wie erwartet spielten die Zerstörer äußerst ruppig. Sowohl der Mittelstürmer als auch der beste Verteidiger in Jewtuschenkos Mannschaft wurden verletzt. Das gleiche Schicksal widerfuhr schließlich auch dem Torhüter, der aber tapfer weitermachte:
„Gegen Ende der Begegnung waren unsere Spieler allesamt mit blauen Flecken und Schrammen übersät. Doch noch hatte es kein Tor gegeben. Die Zerstörer waren beinahe verrückt vor Wut. In einer heiklen Situation war einer unserer Verteidiger dann töricht genug, den Ball mit der Hand zu stoppen. Das führte zu dem schlimmstmöglichen Moment für einen Torwart – einem Strafstoß. Der Kapitän der Zerstörer wirbelte den Ball in seinen Händen, klatschte ihm auf die Seiten, spuckte darauf und legte ihn auf den Elfmeterpunkt. Ich machte mich bereit.
Genau in dem Augenblick machte Billy Bones seinen Leuten mit den Fingern ein Zeichen, und ich spürte einen stechenden Schmerz in meinem Gesicht, dann einen zweiten und einen dritten. Die Anhänger der Zerstörer schossen mit Schleudern kleine Steine auf mich. Alles passierte nach bester südamerikanischer Art und Weise. Ich war halbblind vor Schmerz und konnte praktisch nichts mehr sehen, außer dem ganz ruhig daliegenden Ball. Vielleicht hat mir das geholfen.
Der Kapitän der Zerstörer machte sein grimmigstes Gesicht, lief an und schoss. Ich habe keine Ahnung, wie es passierte, aber der Ball gelangte in meine Hände. Billy Bones war fuchsteufelswild. Der Kapitän der Zerstörer kam mit einem zuckersüßen Lächeln auf mich zu und streckte seine Hand aus, um mir zu gratulieren. Ich war zwar ein wenig überrascht angesichts dieser wundersamen charakterlichen Wandlung bei den Zerstörern, reichte aber in der Schlichtheit meines Herzens meine Hand zurück. Während er weiterhin zuckersüß lächelte, quetschte der Kapitän der Zerstörer unbeobachtet von den in der Nähe stehenden Leuten meine Hand daraufhin schmerzhaft zusammen, bis sie böse knackte, und drehte sie dann noch ein wenig. Gleichzeitig versuchte er, mit seinem Fuß den Ball aus meiner anderen Hand zu treten.“
Allein das wäre schon Stoff genug für eine Heldensaga gewesen und vielleicht auch noch glaubhaft, aber Jewtuschenko setzte noch einen drauf:
„Zornig, wie ich war, geriet ich in dem Moment in eine Art Trance. Ich riss mich los und rannte mit dem Ball am Fuß nach vorne. Ich sprang über ausgestreckte Beine von Gegenspielern, die mich zu Fall bringen wollten. Ein Fetzen meines Trikots blieb in den Händen von einem Zerstörer zurück, der vergeblich versucht hatte, mich mit allen möglichen Mitteln aufzuhalten. Ich wurde wie wild mit Steinen beschossen, fühlte aber keinen Schmerz mehr. Nachdem ich schließlich das gesamte Feld überquert hatte, schlüpfte ich auch noch am Torhüter der Zerstörer vorbei. Aus einem sadistischen Rachegefühl heraus schoss ich aber nicht sofort das Tor. Ich stoppte den Ball auf der Torlinie und drehte mich um, so dass mein Rücken zum Tor zeigte und ich sehen konnte, wie die Zerstörer mit verzerrten, angespannten Gesichtern auf mich zurannten. Ich stand da wie in Habachtstellung, beugte meinen Kopf leicht vor und wartete ab. Als die Zerstörer mich erreicht hatten, schob ich den Ball ganz sachte mit meiner Hacke ins Netz. Die Pfeife des Schiedsrichters ertönte und verkündete das Ende des Spiels wie auch unseren Sieg.“
Die Zerstörer bildeten einen Kreis um Jewtuschenko, schlugen ihn zu Boden und zogen ihre Messer. Doch da kam auf einmal Billy Bones, augenscheinlich von der Tapferkeit des Torwarts überwältigt, und befahl, ihn in Ruhe zu lassen. Das Ende dieser Episode kombiniert den Schluss von Wratar mit dem Ende des Todesspiels, so dass man nur schlussfolgern kann, dass Jewtuschenko hier etwas zu dick aufgetragen und Dichtung und Wahrheit vermischt hat. Dennoch sagt es viel darüber aus, wie verbreitet die Vorstellung des heldenhaften Torhüters in der UdSSR war.
Wratar bereitete den Boden für Jaschin. Doch bevor er in Erscheinung trat, gab es noch einen Vorgänger aus dem echten Leben – einen Torwart, von dem viele bis heute meinen, er sei der beste, den Russland jemals hervorgebracht hat, und der bei Dynamo Moskau so unumstritten war, dass sein Vertreter Jaschin sich beinahe vom Fußball verabschiedet und aufs Eishockey konzentriert hätte. Sein Name war Alexei Chomitsch.
Chomitschs Qualitäten als Torhüter wurden erstmals offenbar, als er während des Zweiten Weltkriegs seinen Armeedienst im Iran absolvierte. Auch wenn er nur 1,73 Meter maß, was selbst zur damaligen Zeit klein für einen Torwart war, besaß er eine gewaltige Sprungkraft, weshalb ihn die Offiziere „Tiger“ nannten. Chomitsch war sehr sportlich und auch ein hervorragender Turner, Schwimmer und Turmspringer, zudem spielte er auf sehr ordentlichem Niveau Volleyball und Schach. Er arbeitete hart an seiner Leistung und widmete sich voll und ganz dem Training, dachte aber auch über das Spiel nach und entwickelte unter anderem neue Varianten für den Abwurf von hinten heraus.
Chomitsch war 25 Jahre alt, als er sein Debüt bei Dynamo gab, galt aber schon bald als bester Torhüter des Landes. Auch wenn er allgemein als zurückhaltend, ja fast schon introvertiert beschrieben wird, besaß er doch einen gewissen Charme. Auf Dynamos Gastspieltournee durch Großbritannien 1945 wurde er zur Kultfigur, ungeachtet eines Fauxpas beim Willkommensempfang für die Mannschaft in London. Wegen eines Films über die Geliebte von Lord Nelson, der sich im damaligen Moskau gerade großer Beliebtheit erfreute, geriet er etwas durcheinander und begann seine Rede mit den Worten „Meine Damen und Hamiltons …“. Doch sein Können als Torwart hinterließ Eindruck. „Er ist ständig in Bewegung, sehr behände, schwer zu überwinden“, sagte Chelseas damaliger Trainer Billy Birrell.
So sehr wurde Chomitsch verehrt, dass der Daily Express anlässlich einer Tour der Glasgow Rangers durch Russland Anfang der 1960er Jahre den Journalisten James Sanderson bat, ihn zu interviewen. Nach einem halbherzigen Versuch, Chomitsch aufzuspüren, steckte Sanderson dessen Honorar in die eigene Tasche und dachte sich den Artikel einfach aus. Danach terrorisierten ihn wochenlang Rangers-Spieler mit Telefonanrufen, in denen sie sich als sowjetische Funktionäre ausgaben und rechtliche Schritte wegen der falschen Darstellung eines Genossen androhten. Da war Chomitsch allerdings längst ersetzt worden, sowohl bei Dynamo als auch in der öffentlichen Gunst – nämlich durch Jaschin.
Jaschin wurde 1929, neun Jahre nach Chomitsch, geboren. Als er sechs Jahre alt war, starb seine Mutter an Tuberkulose. Fünf Jahre später marschierte Deutschland in die UdSSR ein. So kam es, dass er neben der Schule auch seinen Beitrag zum Krieg leisten musste. Gemeinsam mit seinem Vater arbeitete er in einer Fabrik, die im Militärproduktionskomplex Krasnij Bogatir (Roter Held) in Tuschono nahe Moskau Flugzeugteile herstellte. Schon damals legte Jaschin die Großzügigkeit und Bescheidenheit an den Tag, für die er später so bekannt werden sollte – sagt zumindest Walentina. „Die zweite Frau seines Vaters erzählte mir, dass er während des Krieges immer einen Jungen namens Isja mit nach Hause brachte, der mit einer großen Familie in Mietskasernen in der Nähe wohnte. Lew erzählte ihr, dass sie nichts zu essen hätten, und da haben sein Vater und seine Stiefmutter ihn durchgefüttert. Einmal hat er seinen Pullover ausgezogen und Isja gegeben. Seinen Eltern hat er gesagt: ‚Die haben so viele Kinder in ihrer Familie, und die haben nichts anzuziehen.‘“
Nicht, dass Jaschins Familie besonders wohlhabend gewesen wäre. Vielmehr bekam er durch die schlechte Qualität der Lebensmittel, die er damals aß, ein Magengeschwür. Mit 16 Jahren wurde er für eine Weile zur Kur ans Schwarze Meer geschickt. „Das harte Training tat das Seine dazu, vor allem, weil Lew wie ein Verrückter arbeitete. In seiner ganzen Karriere ist er nie zu spät zum Training gekommen. Er war immer pünktlich und forderte das Gleiche auch von anderen. Nach jeder Trainingseinheit blieb er im Tor und bat jemanden, Schüsse auf ihn abzugeben. Ich habe mir das einmal angeguckt und konnte danach nie wieder dabei zusehen. 30 oder 40 von den ganz harten Schüssen hat mein Mann in seinen Bauch bekommen. Mir kam es so vor, als wenn seine komplette Bauchhöhle herausgeprügelt würde. Lew erklärte mir, dass seine Bauchmuskeln sehr stark seien und er den Ball ohnehin mit seinen Händen abgefangen hätte, der Ball also seinen Bauch gar nicht berührt hatte. Aber ich habe gesehen, dass er das sehr wohl tat.
Nach einem Sieg bin ich mal Jakuschin im Savoy-Restaurant begegnet. Er rief mich zu sich und fragte, ob sich Lew über ihn beklagt hätte. Ich sagte Nein und fragte, was denn passiert sei. ‚Ich glaube, er war verletzt’, sagte Jakuschin. ‚Er hat beim Training vor dem Spiel gesagt, dass er Bauchschmerzen habe und sich nicht nach dem Ball werfen kann, aber ich habe ihn aufgefordert, es einmal zu tun. Er ist kaum wieder hochgekommen und ist im Schneckentempo in die Kabine zurückgekehrt. Aber am nächsten Tag ist er wieder ganz normal gesprungen und gehechtet […]‘.
Er hatte ständig Magenschmerzen – und am Ende ist er ja an Magenkrebs gestorben. Weil sein Magen sehr viel Säure produzierte, trug er stets Natron bei sich und, wenn möglich, auch Wasser. Sein Sodbrennen war sehr stark – wenn er kein Wasser hatte, konnte er nicht davon ausgehen, schnell genug einen Becher Wasser zu finden, um einen Teelöffel Natron darin aufzulösen. Manchmal hat er das Natron aus einem Papierbeutel in seine Handfläche geschüttet, direkt in den Mund getan und sich dann verzweifelt nach etwas Flüssigem umgeschaut, mit dem er es runterschlucken konnte.“
Erst 1944, als nach dreijähriger Unterbrechung wieder Fußball in Moskau gespielt wurde, begann Jaschin, sich ernsthaft dieser Sportart zu widmen, und versuchte sich bei der Werksmannschaft. Im Gegensatz zu vielen seiner Landsmänner war er nicht versessen darauf, im Tor zu stehen. „Wie alle Kinder in Moskau hatte auch ich zunächst auf der Straße gekickt“, sagte er. „Meine frühesten Erinnerungen sind die an verrückte Spiele. Ich hätte wirklich gerne als Stürmer gespielt, weil ich es liebte, Tore zu schießen, aber wegen meiner Größe und Sprungkraft war ich dazu bestimmt, Torwart zu sein. Die Chefs der Mannschaft haben mir diese Entscheidung aufgedrückt.“
Als Jaschin 1947 zum Wehrdienst einberufen wurde, stationierte man ihn in Moskau. Nachdem er dort auf seiner neuen Position gleich vielversprechende Auftritte gezeigt hatte, begann er, für den Dynamo Sportklub in der Stadtratsmeisterschaft zu spielen. Im Juli 1949 fiel er Arkadi Tschernischew auf, dem später weltweit bekannten Eishockey-trainer. Der lud ihn ein, sich der Jugendabteilung von Dynamo Moskau anzuschließen. Im Herbst des gleichen Jahres sorgte Dynamos Nachwuchsmannschaft dann für helle Aufregung, als sie die eigene Herrenmannschaft – inklusive Chomitsch – im Halbfinale des Moskauer Pokals mit 1:0 besiegte. Jaschins gute Leistung fiel auf, und im darauffolgenden März wurde er anlässlich einer Tour durch den Kaukasus in die Herrenmannschaft befördert. Dort war er zunächst Reservespieler für Chomitsch und dessen üblichen Vertreter Walter Sanaja.
Bei einem Freundschaftsspiel gegen Traktor Stalingrad (heute Rotor Wolgograd) im Jahr 1950 erhielt er seine Chance, doch es hätte kaum schlechter laufen können. Er erlebte eine dieser Situationen, die einem Torhüter die ganze Karriere über nachhängen können. Ein starker Wind trug einen langen Befreiungsschlag des gegnerischen Keepers bis in seinen Strafraum. Jaschin kam heraus, um den Ball abzufangen. Die Augen nur auf den Ball gerichtet, bemerkte er jedoch seinen Verteidiger Jewgeni Awerianow nicht, der zur Kopfballabwehr heranstürmte. Die beiden prallten zusammen, gingen zu Boden, und der Ball hüpfte ins Netz. Jaschin erinnerte sich später zurück, wie er auf dem Boden lag und erleben musste, wie berühmte Mannschaftskameraden wie Konstantin Beskow und Wassili Karzew ihn auslachten. „Ich hörte, wie sie fragten, wo um alles auf der Welt man diesen Torwart aufgetrieben hätte“, sagte er.
Jaschins erstes Pflichtspiel am 2. Juli des gleichen Jahres lief kaum besser. Dynamo führte eine Viertelstunde vor dem Ende mit 1:0 gegen Spartak, als Chomitsch sich verletzte. Also wurde Jaschin für ihn eingewechselt. Drei Minuten vor dem Abpfiff schlug Alexei Paramonow eine Flanke in den Strafraum. Jaschin ging hin, stieß wiederum mit einem Verteidiger zusammen – dieses Mal mit Wsewolod Blinkow – und legte Nikolai Parschin den Ball so vor, dass dieser nur noch abzustauben brauchte. War sein Patzer beim Freundschaftsspiel in Wolgograd noch weitgehend unbemerkt geblieben, erlangte dieser nun schmerzhafte Bekanntheit. Nach dem Spiel platzte ein NKWD-General in den Umkleideraum und forderte, dass „dieser Idiot gefälligst aus der Mannschaft entfernt wird“.
Dynamos Trainer beachteten den Mann nicht weiter, doch wirkte ihr Vertrauen in Jaschins Fähigkeiten irgendwie fehl am Platze, wenn man sich seinen dritten Einsatz noch im selben Herbst auswärts bei Dynamo Tiflis ansieht. Dynamo Moskau gewann zwar mit 5:4, Jaschin aber hatte bei seinem zehnminütigen Kurzeinsatz vier Bälle passieren lassen. Seine Karriere schien damit beendet. Einen weiteren Einsatz in der Saison bekam er nicht, ebenso wenig in der nächsten und übernächsten. Doch Jaschin übte sich in Geduld, trainierte beharrlich weiter und bereitete sich nach bestem Gewissen darauf vor, eine eventuelle vierte Chance auf jeden Fall zu nutzen. „Hätte ich ihnen in dieser Phase meinen Abschied angekündigt, glaube ich kaum, dass sie viel Zeit darauf verwendet hätten, mich vom Gegenteil zu überzeugen“, sagte er. „Aber ich konnte mir ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Ich habe weiter hart gearbeitet, und zu meiner Überraschung haben sie mich nicht abgesägt.“
Jaschin half dabei auch, dass er sich in der Eishockeyabteilung des Vereins als patenter Schlussmann zeigte. Dort stellte er hervorragende Reflexe unter Beweis und entwickelte sein Stellungsspiel weiter. Er war Teil der Dynamo-Mannschaft, die 1953 den sowjetischen Pokal holte, und wurde 1954 für das WM-Team der UdSSR nominiert. Diese Einladung schlug Jaschin jedoch aus. Seiner Meinung nach konnte man unmöglich zwei Sportarten gleichzeitig auf höchstem Niveau betreiben.
Chomitsch, mittlerweile vermutlich zu alt, verließ 1953 den Verein und ging zunächst zu Spartak Minsk. Danach betätigte er sich als Sportfotograf und fuhr mit zu den Weltmeisterschaften 1970, 1974 und 1978. Auf einmal bekam Jaschin eine neue Chance. Dieses Mal nutzte er sie. Er absolvierte im Laufe der Saison 13 Ligaspiele und verhalf Dynamo zum Pokalsieg, auch wenn er im Finale wegen einer Verletzung in der zweiten Halbzeit nicht bis zum Ende auf dem Platz stand. Vor die Wahl zwischen Fußball und Eishockey gestellt, entschied er sich für den Fußball. Wäre Chomitsch noch ein Jahr länger geblieben, hätte die Entscheidung allerdings auch gut andersrum ausfallen können.
Obwohl auch Chomitsch immerhin zwei Meisterschaften gewonnen hatte, fielen die goldenen Jahre von Dynamo in Jaschins erste glorreiche Phase. Zwischen 1954 und 1959 holte man viermal den sowjetischen Titel und wurde zweimal Vizemeister. Trotzdem blieb Jaschin zunächst noch umstritten. Auch wenn er später zu einem Musterbeispiel von Redlichkeit werden sollte, flog er im sowjetischen Pokalfinale 1955 nach einem Faustschlag gegen ZSKA-Stürmer Wladimir Agapow noch vom Platz. Jaschins Temperament köchelte jederzeit dicht unter der Oberfläche. Dynamo verlor mit 1:2, und für viele war Jaschin der Schuldige. Die Vereinszeitung von Dynamo druckte einen Cartoon, der den Torwart mit Boxhandschuhen zeigte, und untertitelte diesen mit: „Der Pokal hätte ganz sicher uns gehört … wäre Genosse Jaschin nicht gewesen.“
Dennoch war Jaschin da bereits ein großer Star, der 1954 zu seinem ersten Länderspiel berufen worden war. Die Nationalmannschaft hatte damals zwei Jahre lang gar nicht gespielt. Nach einer politisch peinlichen Niederlage gegen Jugoslawien bei den Olympischen Spielen 1952 war das Team aufgelöst worden. Eine Niederlage im ersten Spiel nach der Reform durfte es also nicht geben, obwohl der Gegner Schweden hieß, 1950 immerhin WM-Dritter. Doch die UdSSR zeigte eine ihrer besten Vorstellungen überhaupt und fuhr einen lockeren 7:0-Sieg ein.
Zum Jahresende war Jaschin die unumstrittene Nummer eins der UdSSR, und zwei Jahre später erlangte er auch weltweit Ruhm. Bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne präsentierte er sich in bestechender Form, ließ nur zwei Tore in vier Partien zu und wurde im Finale gegen Jugoslawien zum Matchwinner. Als die sowjetische Mannschaft die lange Zugreise zurück nach Moskau antrat, nachdem das Schiff in Wladiwostok festgemacht hatte, strömten überall die Fans zusammen, um Jaschin zu sehen. Die Partei verlieh ihm den Orden des Roten Banners der Arbeit, und im weiteren Verlauf des Jahres wurde er Fünfter bei der von France Football veranstalteten Wahl zu „Europas Fußballer des Jahres“.
Bei der WM 1958 hinterließ Jaschin kaum weniger Eindruck, und 1960 sollte noch ein Titel hinzukommen, als die UdSSR die erste EM überhaupt gewann, die damals noch „Europapokal der Länder“ hieß. Der Bericht in France Football pries Jaschins „außerordentliche Präzision“ beim Halbfinalsieg gegen die Tschechoslowakei, während der Erfolg im Endspiel gegen Jugoslawien „dem Feuer Jaschins und dem Kopf Ponedelniks“ zu verdanken gewesen sei. Jaschin hätte „bewiesen, dass er auf jeden Fall der beste Torwart der Welt ist“.
L’Équipe war ähnlich beeindruckt und lenkte besondere Aufmerksamkeit auf Jaschins „Klasse und Umsicht“ bei der Abwehr zweier Chancen durch Bora Kostić. Er sei nicht nur Meister seines Strafraumes, sondern bewies ebenso hervorragende Reflexe auf der Linie. Nur seine Ausflüge aus dem Tor hielt man für bedenklich. „Gleichwohl kam ihn seine Verwegenheit beinahe teuer zu stehen“, hieß es im Bericht. Es folgte eine detaillierte Schilderung, wie Jaschin in der zweiten Halbzeit von Dragoslav Šekularacs Heber fast kalt erwischt worden wäre und schnell den Rückzug antreten musste, um den Ball noch aus der Gefahrenzone zu bekommen. „Seine Abwehraktionen“, hielt eine Analyse von sowjetischer Seite fest, „waren sensationell.“
Der einzige Wermutstropfen war, dass seine berühmte Mütze beim Platzsturm nach dem Abpfiff geklaut wurde. „Tausende von Leuten rannten auf den Platz“, sagte Walentina. „Damals gab es noch keine so guten Sicherheitsvorkehrungen wie heute. In dem Chaos nahm ein Fan die Mütze von Lews Kopf und lief weg. Die Menge war so riesig, dass man ihn unmöglich finden konnte. Lew hat gesagt, dass er sich umgeschaut habe, aber niemanden mit der Mütze sehen konnte. Die Zeitungen haben später geschrieben, dass die französische Polizei die Mütze nach dem Spiel gefunden und Lew zurückgegeben hätte, aber das ist gelogen. Sie war für immer verschwunden.“
Später sollte Jaschin als einziger Fußballer überhaupt den Leninorden erhalten, die höchste Auszeichnung der Sowjetunion. Doch Jaschin war nicht einfach nur erfolgreich, sondern gehörte auch zu einer kleinen Gruppe von Spitzentorhütern, die mithalfen, die Rolle des Schlussmannes neu zu interpretieren. Sie erkannten, wie wichtig die Beherrschung des Sechzehners und des angrenzenden Raumes war. So verließ Jaschin regelmäßig für Befreiungsschläge seinen Strafraum, und sein mutiger Körpereinsatz und seine Kopfballstärke waren legendär. Inspiriert habe ihn, so sagte er, Apostol Sokolow, Torwart der Bulgaren bei einer Tour durch die UdSSR im Jahr 1952. „Dieser blonde Teufel spielte weit vorne und stellte jeden Stürmer, der es hinter die Verteidigung schaffte“, erklärte Jaschin. „Das war mir völlig neu, aber ich bin seinem Beispiel gefolgt.“ Was bei seinen ersten beiden Spielen noch als unbesonnenes Herausstürmen betrachtet wurde, wurde nun als vorausschauende Spielweise anerkannt. Mit wachsendem Selbstbewusstsein und steigender Autorität begann Jaschin zudem, seine Abwehr so zu dirigieren, wie man es von heutigen Torhütern kennt, damals aber unüblich war.
In jeder Karriere, wie ruhmreich sie auch sein mag, gibt es dunkle Momente. Torhüter sind sicherlich besonders anfällig für Selbstvertrauenskrisen. Jaschins schwierigste Phase kam während der WM 1962. Zunächst hielt er seinen Kasten sauber, als die UdSSR in ihrer ersten Partie Jugoslawien mit 2:0 schlug. Auch im zweiten Spiel führten die Sowjets bereits 4:1 gegen Kolumbien, da traf Marcos Coll nach 68 Minuten direkt per Eckstoß, wobei Verteidiger Giwi Tschocheli den Ball beinahe selbst über die Linie gelenkt hätte. Er erklärte das damit, dass er Jaschins Ruf „Igraju!“ („Ich spiele!“) falsch verstanden habe. Das konnte den Torhüter allerdings kaum beruhigen, der ihm kräftig mit der Hand auf das Hinterteil schlug. Fortan waren die Sowjets verunsichert. Die Kolumbianer kamen wieder zurück ins Spiel, schossen noch zwei weitere Tore und erzwangen das nicht mehr für möglich gehaltene Unentschieden.
Jaschin litt auch daran, dass er seine Mitspieler nicht gern kritisierte. „Er hasste Getratsche, gab nie jemandem die Schuld oder sagte gehässige Dinge und war auch sonst zurückhaltend“, sagte Walentina. „Manchmal fragte ich ihn: ‚Warum spielt dieser Spieler alle Pässe zum Gegner?’ Dann machte er eine ohnmächtige Geste: ‚Er kann es einfach nicht! Er kann den Platz nicht sehen!’ Das war sein Lieblingssatz: ‚Er kann den Platz nicht sehen.’ Den hat er auch vom Fußball auf das echte Leben übertragen.“
Durch den Sieg über das verletzungsgeschwächte Uruguay wurden die UdSSR trotzdem Gruppenerster, und es kam zum Viertelfinale gegen Gastgeber Chile. In diesem Spiel ließ sich Jaschin am kurzen Pfosten durch einen von Leonel Sánchez auf der rechten Seite getretenen Freistoß düpieren. Nach Igor Tschislenkos Ausgleich überwand Eladio Rojas Jaschin mit einem Weitschuss. Zwar hatte Walentin Iwanow den Ball zuvor beim Spielaufbau dilettantisch verloren, aber Jaschin nahm die Schuld auf sich, obwohl der Schrägschuss ganz knapp neben dem Pfosten ins Tor flog. „Es war nur ein sowjetischer Journalist vor Ort, von der Nachrichtenagentur APN“, sagte Jaschin. „Der hatte keine Ahnung vom Fußball und machte mich zum Sündenbock. Als ich zurück in die UdSSR kam, wurde ich dort als Schuldiger für unsere Niederlage empfangen. Ich war so wütend, dass ich ans Aufhören dachte.“
Walentina kann sich noch gut an die Feindseligkeit erinnern, die ihrem Ehemann selbst bei Heimspielen entgegenschlug. „Die Zuschauer pfiffen und brüllten alles Mögliche“, sagte sie. „Das ging zwei oder drei Spiele so. Zu der Zeit gab es kein Fernsehen in Russland, und so stammten alle Informationen, die die Leute hatten, von diesem APN-Journalisten. Wegen dem dachten alle: ‚Jaschin hat die WM verspielt.’ Zwei Mal sind unsere Fenster eingeworfen worden, auch wenn ich nicht weiß, ob das damit etwas zu tun hatte. Unter unserem Fenster stand eine Straßenlaterne, also haben vielleicht auch Rowdys mit Steinen darauf geworfen und stattdessen die Fenster getroffen. Und manche Leute haben entsetzliche Dinge über Lew in den Staub auf unserem Auto geschrieben.“
Wenn man bedenkt, welch großartige Leistungen er vor dem Turnier gebracht hatte, wirkt die überwältigende Wut gegen Jaschin unverständlich – selbst wenn er hier ein einziges Mal einen Fehler gemacht hatte. Gleichzeitig zeigt es, wie leicht das Ansehen eines Torwarts Schaden nehmen kann. „Das passiert ja nicht nur im Fußball“, fuhr Walentina fort. „Anderswo sind wir ja genauso. Einer muss die Schuld kriegen, wenn etwas schiefgeht. Die Bosse ganz oben wollten um die Strafe herumkommen, also haben sie die Schuld auf Jaschin geschoben.“
France Football deutete außerdem an, dass es vielleicht an der Zeit sei, dass Jaschin seine Karriere beendete. Egal, ob die Schuldzuweisungen berechtigt waren oder nicht, er jedenfalls entschied sich fürs Weitermachen. „Er kannte genau wie jeder Mensch Phasen großen Zweifels, der Unsicherheit und Schwäche“, sagte Jakuschin. „Gleichzeitig hat sein Verantwortungsgefühl für die Mannschaft seine tapfere, starke Seite hervorgebracht.“ Eine Weile trainierte Jaschin nicht. Unterstützung bekam er von Dynamos Trainer Alexander Ponomarew. Der sagte zu Jaschin, er solle Russland mal eine Zeit lang verlassen und angeln gehen. Als Jaschin wieder da war, trainierte er mit der Reserve und kehrte erst in der Folgesaison in die erste Mannschaft zurück.
Wie sich zeigen sollte, hatte er alles richtig gemacht: 1963 wurde seine wohl beste Saison. In 27 Ligaspielen kassierte er gerade einmal sechs Tore. International wurde er noch berühmter durch seine hervorragende Leistung in der Partie anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Football Association, in der in Wembley eine Weltauswahl gegen England antrat. Die Begegnung überzeugte den sowjetischen Nationaltrainer Konstantin Beskow, ihn in die Nationalmannschaft zurückzuholen. Im Jahr darauf hielt Jaschin einen Strafstoß von Sandro Mazzola in einem EM-Qualifikationsspiel gegen Italien – einen von ungefähr 150 gehaltenen Strafstößen in seiner Karriere – und wurde zu „Europas Fußballer des Jahres“ ernannt. Er ist der einzige Torwart, der jemals diese Auszeichnung erhielt.
Bei der Weltmeisterschaft 1966 spielte er erneut erstklassig, insbesondere im Viertelfinale gegen Ungarn, das im Roker Park in Sunderland stattfand. Obwohl er bereits 1967 seinen Abschied aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, wurde er in den Kader für die WM 1970 in Mexiko berufen, wo er als Ersatztorwart und allgemeiner Berater diente. Noch kurz vor seinem 40. Geburtstag präsentierte er sich bei Dynamo in prächtiger Form und ließ in seinen ersten zehn Saison-spielen nur ein Tor zu. Kurz nach der Rückkehr aus Mexiko beendete er seine Karriere und absolvierte am 30. August 1970 sein letztes Meisterschaftsspiel, 20 Jahre und 59 Tage nach seinem ersten. Auch wenn Statistiken im Fußball nicht unbedingt sehr aussagekräftig sind, sind die von Jaschin doch so erstaunlich, dass sich ein Blick darauf lohnt. So absolvierte Jaschin für Dynamo Moskau und die UdSSR insgesamt 438 Spiele. Beide Teams waren zwar erfolgreich, aber nicht übermäßig. Umso erstaunlicher ist es, dass Jaschin 209-mal, also in 48 Prozent seiner Spiele, zu null spielte.
Lew Jaschin (2.v.l.) wird als „Europas Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet. Kein anderer Torhüter erhielt je diesen Preis.
Im Mai 1971 streifte Jaschin das dunkle Jersey noch einmal über für ein Abschiedsspiel zwischen einer Weltauswahl mit Gerd Müller, Dragan Džajić und Christo Bonew und einer Elf der landesweiten Sportgemeinschaft Dynamo. Unnötig zu erwähnen, dass er noch nicht bezwungen worden war, als er in der 52. Minute unter bewegenden Beifallsbekundungen ausgewechselt wurde. Anschließend arbeitete er als Vorstand bei Dynamo Moskau, verbrachte aber den Großteil seines Ruhestands mit Angeln. „Ich kann mir zum Ausspannen nichts Schöneres vorstellen, als mit der Rute in der Hand draußen auf einem See oder in der Marsch zu sein“, sagte er. Jaschins mutige Spielweise forderte nun allerdings ihren Tribut. Die regelmäßigen Schläge auf die Beine hatten innere Schäden verursacht. 1984 erkrankte er bei einer Reise mit der sowjetischen Altherrenmannschaft in Budapest, und ihm musste das rechte Bein amputiert werden. Dass er starker Raucher war, machte die Sache nicht besser. 1990, sechs Monate nach seinem 60. Geburtstag, ist Lew Jaschin gestorben. Doch seine Legende lebt weiter.
Es gab die Vorgänger Jaschins, und es gibt seine Nachfolger. Der Jaschin der 1980er Jahre war Rinat Dassajew, der 1957 im südrussischen Astrachan geboren wurde. Er ist, direkt hinter Jaschin, vermutlich der zweitgrößte russische Torhüter aller Zeiten und sicherlich der größte tatarische Fußballer überhaupt. Er nahm an drei Weltmeisterschaften teil, gewann Bronze bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau und wurde Zweiter bei der EM 1988 in Deutschland. Zwischen 1979 und 1990 brachte er es auf 91 Länderspiele. Nur Oleh Blochin hat mehr Spiele für die Sowjetunion absolviert.
Seine größten Spiele waren aus seiner eigenen Sicht die 1:2-Niederlage gegen Brasilien in der Gruppenphase der WM 1982 und der 1:0-Sieg gegen die Niederlande in der Gruppenphase der EM 1988 (die Niederländer besiegten die Sowjets im Finale mit 2:0). „‘82 war die erste Weltmeisterschaft für mich“, sagte er. „Ich habe eine DVD und gucke sie mir immer mal wieder an. Ich kann mich noch an jeden einzelnen Moment des Spiels erinnern, und ich glaube nach wie vor, dass ich beide Tore hätte verhindern können, wenn ich eine Hand und nicht beide benutzt hätte.“
Dassajew war auch ein Schlüsselspieler in der starken Mannschaft von Spartak Moskau in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren, die zwei Meisterschaften holte und dabei eine schnelle, attraktive Spielweise mit Kurzpässen und ständigen Positionswechseln pflegte. Sechsmal wurde er sowjetischer Torhüter des Jahres, und man nannte ihn den „Eisernen Vorhang“. Nach dem Ende des Kommunismus gehörte er zu den ersten Spielern, die die neue Reisefreiheit nutzten, und wechselte 1990 für eine Transfersumme von damals umgerechnet gut vier Millionen Mark zum FC Sevilla. „Als ich zu Sevilla kam, war ich 31“, sagte er. „Aber ich kam mir vor wie ein Teenager, weil ich nicht ausdrücken konnte, was ich wollte oder was ich von anderen Spielern wollte. Ich hielt mich von der Mannschaft fern. Das lag an meinen fehlenden Sprachkenntnissen.“
Und so enttäuschte Dassajew gegen Ende seiner Karriere in Spanien. Er hatte schon bei der WM 1990 in Italien untypische Schwächen gezeigt. Nun musste er sich regelmäßig mit dem Status des vierten Ausländers begnügen, waren damals im spanischen Fußball doch nur drei erlaubt. 1994 lief sein Vertrag aus. Danach entschied er sich, in Spanien zu bleiben, auch wenn er nicht wirklich die Qualifikationen besaß, einen Arbeitsplatz zu finden. „Meine Frau ist aus Sevilla, und wir haben dort viele Freunde“, sagte er. „Ich fahre oft dorthin. Sevilla ist meine zweite Heimat. Dort gehöre ich dazu.“ Einige Jahre lang schien Dassajew verschwunden zu sein, bis ihn die Zeitung Komsomolskaja Prawda aufspürte. Sie berichtete, dass er mittlerweile in Armut lebte. Man überredete ihn, nach Russland zurückzukommen, wo man ihn als Helden empfing.
Dassajew erkannte das Land kaum wieder. „Ich habe ja selbst nicht miterlebt, was da alles passiert ist“, sagte er über die radikalen Veränderungen nach der Perestroika. „Ich hatte Glück. Da war ich schon weg. Ich habe meine Freunde von Spanien aus angerufen, und die haben mir gesagt, ich solle dort bleiben und nicht zurückkommen. Das war ein guter Rat. Als ich nach zehn Jahren Spanien zurückkehrte, musste ich die nächste Herausforderung meistern. Ich musste wieder Russisch lernen, weil ich zehn Jahre lang nur Spanisch gesprochen hatte. Ich musste immer ein bisschen überlegen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe auch Zeit gebraucht, bis ich mich an die neue Wirklichkeit in diesem Land gewöhnt hatte. Ich bin aus einem Land fortgegangen und in ein ganz anderes zurückgekommen, politisch gesehen. Also musste ich noch einmal von vorne anfangen.“
Dassajew scheint gemischte Gefühle zu haben, was das alte System angeht. Er weiß, dass sich sein Leben als Spitzenfußballer stark von dem vieler Landsleute unterschied. „Ich spreche nicht nur für mich, sondern auch für viele andere große Sportler, die die Sowjetunion repräsentierten“, sagte er. „Es gab zwar so etwas wie Druck, aber der war nicht so schlimm oder stark, dass man darunter zu leiden hatte. Dass die UdSSR ein abgeschottetes Land war, galt für uns Fußballspieler ja nicht wirklich, weil wir oft auf Reisen waren. Wir haben in einer anderen UdSSR als unsere Mitmenschen gelebt. Die einzige Einschränkung war, dass wir das Land nicht verlassen konnten, um bei anderen Vereinen zu spielen. Das war verboten. Vergessen Sie nicht, dass wir in der UdSSR groß geworden sind und dass wir Teil dieser Gesellschaft waren.“
Und weiter: „Wir waren ein bedeutender Bestandteil des sowjetischen Lebens. Man fragt mich oft, wann es denn besser war, zu sowjetischen Zeiten oder heute. Was den Fußball angeht, stimmt es schon, dass wir nicht so hohe Gehälter bekamen, wie man sie den Spielern heute zahlt. Aber was wir Sportler zu der Zeit an Geld bekommen haben, war mehr als genug, um das Leben zu genießen. Man hatte keine Probleme, eine Wohnung oder ein Auto zu kaufen. Außerdem waren die Preise so niedrig, da reichte das Geld, das wir bekamen, um einen hohen Lebensstandard zu garantieren. Heute kriegen die Jungs zwar viel Geld, aber sie müssen auch viel Geld ausgeben.“ Und vielleicht änderte sich auch die Einstellung gegenüber Torhütern: In der neuen Gesellschaft suchte man nun den Ruhm und die Ehre, die Tore mit sich brachten, und weniger die mit viel Selbstaufopferung einhergehende Unabhängigkeit des Torhüters. Nachdem er eine Zeit lang als Co-Trainer der russischen Nationalmannschaft gearbeitet hatte, begann Dassajew, eine Trainerakademie im Luschniki zu führen.
Der nächste Mann, der als Nachfolger Jaschins galt, war Michail Jeremin. 1986 gab er mit 18 Jahren sein Debüt bei ZSKA Moskau, war Schlüsselspieler der UdSSR beim Gewinn der U21-Europameisterschaft 1990 und wurde noch im gleichen Jahr für ein Freundschaftsspiel der A-Nationalmannschaft gegen Rumänien nominiert. 1991 gehörte er dem ZSKA-Team an, das nach einem Sieg gegen Torpedo Moskau den sowjetischen Pokal gewann und später auch die letzte sowjetische Meisterschaft holte. Doch auf der Heimfahrt vom Finale platzte Jeremin ein Reifen an seinem Auto, und er stieß mit einem Bus zusammen. Eine Woche später erlag er seinen Verletzungen.
Daraufhin wurde Sergei Owtschinnikow als „neuer Jaschin“ gehandelt, auch wenn er sich durch sein forsches Auftreten und seinen Pferdeschwanz im Stile des englischen Torhüters David Seaman deutlich von seinem berühmten Vorgänger unterschied. Owtschinnikows Talent wurde schon zu Schulzeiten rasch deutlich. Damals erwarb er sich auch den Spitznamen „Boss“. Bald holte man ihn in die Jugendabteilung von Dynamo Moskau – des Klubs also, in dem sich bereits Jaschin einen Namen gemacht hatte. 1991 wechselte Owtschinnikow zu Lokomotive Moskau und von dort nach sechs weiteren Jahren nach Portugal. Hier spielte er bei Benfica, Alverca und dem FC Porto, bis er 2002 zu Loko zurückkehrte. Oft tun sich russische Spieler im Ausland schwer, doch Owtschinnikow lernte offensichtlich eine Menge in Portugal. Als er Russland verließ, war er zwar brillant, aber nicht konstant; als er zurückkehrte, war er brillant und konstant. Er spielte 20 Spiele zu null – ein neuer russischer Rekord –, als Lokomotive erstmals in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft holte. „Die Situation bei Loko mit Owtschinnikow war damals die gleiche wie bei Dynamo mit Jaschin“, sagte Lokos damaliger Stürmer Walentin Bubukin.
Nur Owtschinnikows Temperament war ein anderes. Jaschin war zwar auch hitzig, lernte aber, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Das schaffte Owtschinnikow nie. „Der Keeper sollte aggressiv sein“, sagte er. „Er sollte schreien, das Kommando übernehmen, für seine Mitspieler kämpfen. Das wird Teil seines Images. Man macht das mit Absicht, um Druck auf die Schiedsrichter aufzubauen und den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Glauben Sie bloß nicht, dass ich auch im Alltag so bin.“ Manchmal übertrieb er es allerdings mit seiner Aggressivität. 2003 wurde er für fünf Spiele gesperrt, nachdem er einem Trainer von Zenit St. Petersburg hinterhergejagt war, der aus seiner Sicht Loko beleidigt hatte. „Am meisten regt mich an anderen Leuten auf, wenn sie sich Loko gegenüber respektlos zeigen“, sagt er. „Wenn sie Schlechtes über meinen Verein sagen, ist das das Gleiche wie eine persönliche Beleidigung.“
Nachdem Owtschinnikow bei einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland nur Ersatz gewesen war, hieß es im Jahr 2000, er habe geschworen, nie wieder für die Nationalmannschaft anzutreten. Doch tatsächlich kehrte er vor allem deshalb aus Portugal nach Russland zurück, um sich in den WM-Kader zu spielen. Nach seiner Rückkehr gesellten sich zu den beiden Auszeichnungen als Russlands Torhüter des Jahres, die er bereits bei seinem ersten Engagement für Loko gewonnen hatte, noch zwei weitere. Eine Rote Karte wegen Handspiels außerhalb des Strafraums bedeutete allerdings faktisch das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Insgesamt brachte er es auf nur 35 Länderspiele. Daher beschleicht einen das Gefühl, dass er dem ganzen Hype trotz seines Talents nie ganz gerecht wurde. Nach dem Ende seiner aktiven Zeit war Owtschinnikow interessanterweise auch einmal Berater für einen ukrainischen Film über das Todesspiel und trainierte den Schauspieler, der Trussewitsch spielte.
Nach Jeremin und Owtschinnikow kam Igor Akinfejew. Er wurde 1986 in Widnoje geboren, direkt vor den Toren Moskaus. Sein Vater war Kraftfahrer und seine Mutter Lehrerin in einer Schwesternschule. Sein Großvater hatte bereits als Torwart in der zweiten sowjetischen Liga gespielt. „Er kannte einen Trainer aus der Jugendabteilung von ZSKA, und deswegen haben die mich da reingebracht, als ich vier Jahre alt war“, sagte Akinfejew. „Ich glaube, niemand liebt ZSKA mehr als ich.“
Akinfejew war 16, als er sein Debüt bei ZSKA gab und beim 2:0-Sieg über Krylja Sowetow Samara einen Strafstoß hielt. „[Wenjamin] Mandrikin verletzte sich“, erinnerte er sich. „Ich war sehr nervös und hatte Angst, wie die anderen Spieler mich wohl empfangen würden. Ich habe mich im Trainingslager in ein Zimmer eingeschlossen und habe mit niemandem geredet. Am Abend hatten wir allerdings eine Trainingseinheit, also musste ich rauskommen. Aber die Jungs haben mich freundlich begrüßt, und nach dem ersten Spiel habe ich eine Ladung Bier mit in die Sauna genommen, um zu feiern.“
Eigentlich ist er ja nicht von der ängstlichen Sorte, wie auch ZSKAs Torwarttrainer Wjatscheslaw Tschanow bestätigt, ein ehemaliger Torhüter, den Akinfejew einmal als „Trainer fürs Leben“ bezeichnete. „Er hat Mut“, sagte Tschanow. „Er wird nicht nervös. Seine größte Stärke ist sein Selbstvertrauen, was sich auf seine Mitspieler überträgt. Er macht nur sehr selten mal einen Stellungsfehler.“ Akinfejew brachte es in der Saison 2003 noch auf 13 Ligaeinsätze, und ZSKA holte die erste Meisterschaft seit dem Ende der UdSSR. Im Jahr darauf wurde er Stammtorhüter bei ZSKA und zum russischen Torhüter des Jahres gewählt. Wiederum eine Saison später gewann ZSKA als erste russische Mannschaft einen europäischen Titel. Im UEFA-Pokal-Finale schlug man Sporting in deren eigenem Stadion in Lissabon.
Auch Akinfejew hat ein feuriges Temperament. So wurde er beispielsweise fünf Spiele gesperrt, weil er Ognjen Koroman, den serbischen Mittelfeldspieler von Krylja Sowetow, geschlagen hatte. Der hatte, offenbar ohne böse Absicht, beim Torjubel mit dem Ball auf ihn geschossen. Doch inzwischen ist Akinfejew zu einer freundlichen, reflektierten, fast schon melancholischen Persönlichkeit gereift. 2005 hatte er noch über einen Wechsel ins Ausland nachgedacht, wenn auch ohne große Begeisterung. Schließlich ist er Russe, und es gibt vielleicht keine andere Nation, die sich ihrer Heimat derart verbunden fühlt. „Von seinem eigenen Volk verlangt Russland die hilflose Verehrung des Dazugehörens“, stellt Colin Thubron in Unter Russen fest. „Es umschließt sie mit dem elementaren Despotismus einer Erdmutter, und das Volk empfindet für sie die zerquälte Zärtlichkeit eines Bittenden.“
Bei Akinfejew wird diese Bindung durch seinen orthodoxen Glauben noch verstärkt. „Wenn ich Zeit habe“, sagte er bei meinem ersten Interview mit ihm im Jahr 2006, „dann versuche ich, in die Kirche zu gehen. Ich zünde einfach nur eine Kerze an […], und schon spüre ich Unbeschwertheit in meiner Seele. Ich kann mir selbst gar nicht vorstellen, für einen anderen Verein als ZSKA zu spielen. Aber wenn man die Chance kriegt, zu einem namhaften Verein zu wechseln, muss man sie nutzen. Vielleicht jetzt noch nicht, aber ganz bestimmt, wenn ich 25 bin. Wenn man in Russland 30 Jahre alt wird, vergessen einen alle. Es gibt große Schauspieler, die im ganzen Land berühmt waren und arm und vergessen gestorben sind.“
Als er dann 25 Jahre alt war, hatte Akinfejew noch immer Zweifel an einem Wechsel. „Fragen Sie mich, ob ich von ZSKA weg will, und ich werde Nein sagen“, sagte er. Einige glauben aber, dass er woanders hingehen muss, wenn er weiterkommen will. „Zu Beginn seiner Karriere war er der beste Nachwuchsspieler“, sagte Dassajew. „Er war sehr vielversprechend, aber bisher hat er die Erwartungen noch nicht richtig erfüllt. Ich glaube, dass er sich nicht so entwickelt, wie er es müsste, um der Beste zu werden. Ein paar Jahre lang hat er Fortschritte gemacht, und jetzt tut er das nicht mehr. Vermutlich ist es an der Zeit für ihn, ins Ausland zu wechseln. Solange er das nicht tut, wird er stagnieren.“
Akinfejew sieht das ähnlich, zumindest theoretisch. Gefühlsmäßig bleibt er jedoch an Russland gebunden. „Ich verstehe ja, dass jeder Spieler Fortschritte machen muss. Aber Fortschritte macht man nur bei besseren Mannschaften“, sagte er. „Deshalb würde ich zum Beispiel nie für Aston Villa oder Florenz hier weggehen. Ich habe gehört, dass Arsenal und Manchester United ein gewisses Interesse an mir haben. Sollte ich eines Tages herausfinden, dass das stimmt, dann würde ich ziemlich ins Grübeln kommen. Das sind echt starke Mannschaften, aber ich liebe ZSKA, und ich liebe auch Russland. Ich mag die Menschen in Russland – sie sind mein Volk. Ich mag die russische Natur, besonders die Birken. Ich glaube an Gott und gehe gerne an orthodoxen Kirchen vorbei. Davon würde ich in Europa ganz sicher nicht genug bekommen. Mich machen ja sogar schon zwei Wochen Trainingslager in Europa traurig.“
Das ist vielleicht typisch russisch. Zahllose Spieler aus Russland haben von starkem Heimweh berichtet, nachdem sie zu ausländischen Klubs gewechselt waren. Jegor Titow sagte, dass ihm regelmäßig übel wurde, wenn er im Flugzeug in Moskau auf den Start wartete. Das geht über die üblichen Probleme hinaus, mit denen sich Fußballspieler, die sich an eine neue Umgebung gewöhnen müssen, konfrontiert sehen.
Auch dass Akinfejew in einem Atemzug von der Natur und seinem orthodoxen Glauben spricht, ist letztlich typisch. Das verdeutlicht auch Thubron, als er die Vorliebe der Russen für die Eleusa-Darstellungen der Jungfrau Maria erörtert, die vor allem die mütterlichen und weniger die königinnengleichen Eigenschaften der Jungfrau Maria betonen. „Dieses Bild der Mutterschaft schlägt in der russischen Seele eine tiefe Saite an“, schrieb Thubron. „Es durchzieht den sowjetischen Nationalismus mit seiner mystischen Anrufung der rodina, des ‚Mutterlandes’, und reicht zurück, so scheint es, bis in die Zeit vor der Christianisierung, als eine große Urmutter über diese heidnischen Wälder und Ebenen herrschte. Diese Mutter besaß kein Antlitz, vielleicht war sie namenlos: ein alles gebärender Schoß. Durch die animistische Verehrung ihrer Natur – der Bäume, Seen, des Feuers, der Steine – wurden ihre Anbeter in ihre Allmacht hineingezogen.“
Akinfejew ist sich im Übrigen der Tradition großer russischer Torhüter sehr wohl bewusst. „Ich stelle mich selbst in die russische Torwarttradition, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass man mir die Sachen beigebracht hat, die Jaschin, Chomitsch und Dassajew immer gemacht haben“, sagte er. „Ja, Jaschin war der ‚König des Strafraums’, aber heutzutage muss jeder Torwart so spielen. Der moderne Fußball ist schneller geworden, und manchmal kannst du nur noch mit deinen Füßen anstelle deiner Hände spielen, so wie es Dassajew getan hat. Ich mache das ja nicht wegen ihm persönlich. Es geht so einfach schneller. Aber ich habe Respekt vor allen großen russischen Torhütern und bin stolz darauf, Teil dieser Tradition zu sein.“
Allerdings befindet sich diese Tradition gerade im Wandel. In einer Welt, in der Individualismus – häufig in seiner ungezügelten Form – die Norm ist, spielt die Position des Torhüters als Weg der Befreiung vielleicht nicht mehr die gleiche Rolle wie früher. Fußball ist ein globaler Sport geworden. Auch wenn Akinfejew die überragenden Einzelgänger im sowjetischen Russland respektiert, stammt sein Vorbild vom anderen Ende Europas, nämlich aus Spanien, genauer: Valencia. „Santiago Cañizares war der Held meiner Kindheit“, sagte Akinfejew. „Nicht, dass ich seine Spielweise als Torhüter übernommen hätte, aber wir sind in manchen Dingen vergleichbar: Wir spielen beide lieber solide. Wenn du gelassen bleibst, ist dein Kasten sicher. Fußball ist ein einfaches Spiel, und wenn du eine Show machst, minimierst du deine Chancen, deinen Kasten sauber zu halten. Warum solltest du springen und in den Winkel hechten, wenn du einfach zwei Schritte machen und den Ball sicher fangen kannst? Als ich René Higuitas berühmten ‚Skorpion-Kick’ gesehen habe, sagte ich: ‚Der Kerl ist doch bekloppt! Der kann von Glück sagen, dass er sich nicht das Rückgrat gebrochen hat.’ Diese Art von Torwartspiel ist eindeutig nichts für mich. Nach Cañizares’ Karriereende habe ich keinen Torhütern mehr beim Spielen zugeguckt. Tschanow sagt mir immer wieder, dass sich jeder Torwart auf seinen eigenen Stil konzentrieren muss.“
Mit ungefähr 1,85 Metern ist Akinfejew nach heutigen Standards nicht sonderlich groß für einen Torhüter. Worin er aber dem aktuellen Torwartideal entspricht, ist sein hervorragendes Passspiel. Stolz zitiert er den ehemaligen russischen Nationaltrainer Guus Hiddink, der gesagt habe, dass „Aki einen guten langen Ball schlagen kann“ – und damit war nicht gemeint, dass er den Ball weit schießen kann. Vielmehr lobte er die Genauigkeit seines Passspiels. „Er hat immer gesagt, dass ich einen Angriff einleiten kann“, erzählte Akinfejew. „Bei der EM 2008 hat er die Innenverteidiger aufgefordert, den Ball zu mir zu spielen, wenn sie keinen freien Spieler sehen. Ich kann über eine Distanz von 60, 70 Metern Pässe schlagen. Ich liebe das, muss ich ehrlich sagen. Deshalb tue ich das sehr oft.“
Das Turnier markierte Akinfejews Comeback nach einer schweren Knieverletzung, die er sich im Mai 2007 zugezogen hatte. Sie hatte ihn schwer getroffen: „Ich hatte eine furchtbare Verletzung. Nach meiner Operation musste ich einen Monat lang auf dem Rücken liegen, und man sagte mir, ich solle bloß nicht auf die Seite rollen. Die ganze Reha hat sechs Monate gedauert, aber ich habe den Schmerz noch ein Jahr lang gespürt. Wenn ich ZSKA spielen sah, habe ich geweint, weil ich der Mannschaft nicht helfen konnte. Meine Eltern und Freunde haben mich sehr unterstützt, aber keiner kann einem diesen Schmerz wirklich nehmen. Das musste ich selbst tun – und ich habe es geschafft. Aber die Leute in Russland vergessen gerne mal, dass Akinfejew nach dieser Verletzung auf dasselbe fußballerische Niveau zurückkommen konnte. Hier gibt es keine große Wertschätzung. Gute Worte kommen meistens von Ausländern.“
Ob er wirklich zurück zu alter Form gefunden hat, ist umstritten. Gegen Ende des Jahres 2009 fiel auf, dass er viele Tore durch die Beine kassierte. Der frühere sowjetische Nationalspieler Ansor Kawasaschwili meinte, das sei eine Frage der Technik und hänge mit dem Tempo zusammen, mit dem Akinfejew aus seinem Tor rücke. Der reagierte, indem er seine Position veränderte und von da an immer ein wenig weiter vor dem Tor stand. So war der Weg kürzer, um die gegnerischen Angreifer zu stellen. Gleichzeitig wechselte er die Stollen, womit er dieses spezielle Problem anscheinend in den Griff bekam. Trotzdem blieben Zweifel bestehen, ob er den hohen Erwartungen, die er so früh geweckt hatte, jemals wirklich gerecht geworden war.
Und dann, im August 2011, verletzte sich Akinfejew erneut: an den gleichen Bändern im gleichen Knie. Nach einem sinnlosen Angriff von Spartaks brasilianischem Stürmer Welliton kurz vor Schluss war er mit diesem zusammengestoßen und ungünstig aufgekommen. Welliton bekam für das Foul sechs Spiele Sperre, die nach einem Einspruch auf drei Spiele verkürzt wurde. Mit 25 Jahren hatte es Akinfejew bereits auf über 50 Länderspiele gebracht, dazu kamen über 200 Einsätze für ZSKA. Alles sprach dafür, dass er neue Rekordmarken aufstellen würde. Doch nun gab es Grund zur Sorge, dass er sich von dieser Verletzung nie wieder richtig erholen würde – schließlich hatte es bereits nach der ersten Verletzung zwei Jahre gedauert, bis er wieder völlig gesund war – und deshalb nie zu den ganz großen russischen Torhüterlegenden zählen würde, auch wenn er genauso talentiert ist wie seine drei berühmten Vorgänger.
Lew Jaschins Erbe ist immer noch ein schweres.