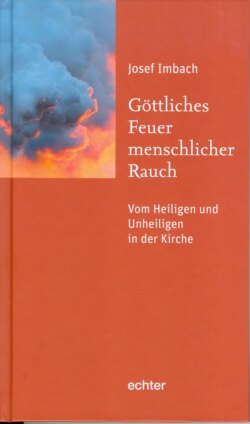Читать книгу Göttliches Feuer, menschlicher Rauch - Josef Imbach - Страница 7
VON LANGEN WÜRSTEN
UND ABGESCHNITTENEN ZÖPFEN
ОглавлениеWas sie denn morgen Abend kochen solle, fragt Helen ihren Friedel. »Eigentlich hätte ich wieder einmal Lust auf eine Waadtländer Saucisson, mit Kartoffeln und Lauch«, sagt der. Und fügt hinzu: »Sag mal, warum schneidest du eigentlich immer an beiden Enden ein kleines Stück ab, bevor du die Wurst ins heiße Wasser legst?« »Das hat schon meine Mutter so gemacht.« Die kommt ein paar Tage später zu Besuch (was jeweils eher nach einer Visitation als nach einer Visite aussieht). Bei dieser Gelegenheit fällt Friedel die Sache mit der Wurst wieder ein. Also fragt er die Schwiegermutter, weshalb sie die beiden Wurstenden vor dem Sieden jeweils abgeschnitten habe. »Das habe ich von meiner Mutter übernommen.« Jetzt interessiert sich plötzlich auch Helen, welche das Ganze mitgekriegt hat, für die Sache. Als sie ihre Oma ein paar Tage später im Altenheim aufsucht, erkundigt sie sich bei ihr, was es mit den abgeschnittenen Wurstenden eigentlich auf sich habe. »Ach«, sagt die alte Frau, »habt ihr ihn denn noch immer, diesen viel zu kleinen Topf?«
Diese Geschichte erinnert an die Haltung mancher Gläubigen, die nur das als richtig erachten, was angeblich seit jeher praktiziert wurde. Und die deshalb neueren Entwicklungen von vornherein ablehnend gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang wird oft bedauert, dass viele alte Traditionen einfach verschwunden seien. Dabei sollte man nicht übersehen, dass gewisse zeitweise aus der Übung gekommene Bräuche heute wiederum vermehrt gepflegt werden, wie etwa das Palmenbinden vor Beginn der Karwoche. Andere Gepflogenheiten hingegen haben sich verflüchtigt, weil sie fast nur noch musealen Charakter hatten.
Dass eine solche Entwicklung nicht in jedem Fall negativ zu beurteilen ist, haben die Preußen zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf ganz profaner Ebene demonstriert. Damals trugen die Soldaten das Haar lang und offen. Im Zug einer Vereinheitlichung des militärischen Erscheinungsbildes wurde dann die Vorschrift erlassen, die Strähnen zu einem Zopf zu binden. Aber die neue Einheitlichkeit hatte ihren Preis; beim Exerzieren erwies sich der Zopf als hinderlich. Weshalb er irgendwann wieder aus den Kasernen verschwand. Geblieben ist die Redewendung vom »alten Zopf«, der abgeschnitten gehört.
Wer manchen früher verbreiteten Andachtsübungen nachtrauert, verbindet damit vermutlich vor allem Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugendzeit; das Bedauern hätte dann weniger religiöse als vielmehr psychologische Ursachen.
Wenn die Zeiten sich ändern, kann sich die Kirche nicht einfach auf den alten ausgetretenen Wegen bewegen. Schon Jesus mahnte ja die Seinen, die Zeichen der Zeit zu deuten und entsprechend zu handeln (vgl. Lukas 12,56). Die Evangelisten haben das als Erste begriffen. Bekanntlich haben sie Jesu Botschaft nicht einfach protokolliert, sondern sie gleichzeitig im Hinblick auf die Bedürfnisse der Gemeinden, für die sie ihre Schriften verfassten, aktualisiert. Die im Lauf der Jahrhunderte sich herauskristallisierenden Traditionen sind im Grunde nichts anderes als die Fortschritte von vorgestern und gestern. Und die Fortschritte von heute? Werden, falls sie sich durchsetzen, vielleicht einmal zu Traditionen von morgen und übermorgen. Verbindlich aber sind nicht diese einzelnen Traditionen; bindend ist einzig die große apostolische Tradition, welche sich in den verschiedenen zeit- und situationsbedingten Gepflogenheiten jeweils konkretisiert. Die einzelnen geschichtlich gewachsenen Traditionen können sich überleben, und manchmal sind sie sogar der Sache selber hinderlich. Dem Lukasevangelium zufolge ist Jesus »gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen« (11,49). Dieses Feuer gilt es zu schüren – und nicht, die Asche zu hüten.