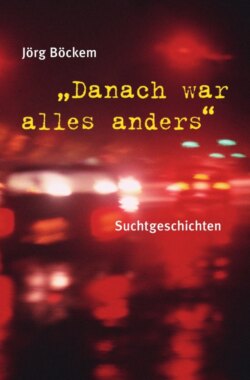Читать книгу Danach war alles anders - Jörg Böckem - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Alexander Scheer, 29, Schauspieler aus Berlin Kinder einer Revolution
ОглавлениеEine Gaststätte im Hamburger Stadtteil St. Georg. In den angrenzenden Straßen offene Drogenszene, Straßenstrich, Cafés und Clubs der Schwulenszene, der Hauptbahnhof und das Hamburger Schauspielhaus. Der Mann, der die Kneipe betritt, fällt auf. Er ist Ende zwanzig, hoch aufgeschossen und nadeldünn. Er trägt eine Sonnenbrille mit großen dunkelbraunen Gläsern und eine Häkelmütze mit Ohrwärmern in braun und orange. Seine dunkelbraune Lederjacke ist zerschlissen, seine Armeehose stammt aus NVA-Beständen. Er sieht sich um. Sein schlaksiger Körper scheint ständig in Bewegung. Ein Auftritt wie in einem Western, wenn der Revolverheld sagt: »Hier bin ich! Es kann losgehen!«
Alle Köpfe im Raum wenden sich ihm zu. Er beherrscht den großen Auftritt. In der vergangenen Nacht hat er den Othello gespielt, in einer gefeierten Inszenierung des Regisseurs Stefan Pucher am Hamburger Schauspielhaus, ist wie ein Derwisch über die Bühne gefegt, um am Ende verausgabt den Jubel zu genießen. Bei all seiner Energie, seinem Verlangen nach Aufmerksamkeit, wirkt er doch unangestrengt und unverstellt. Er ist einer, der sich kopfüber in die Welt wirft, kompromisslos und ohne Zögern.
»He Mann, schön, dass wir uns endlich treffen«, sagt er und nimmt die Sonnenbrille ab. »Ich bin Scheer.« Alexander Scheer ist Schauspieler, er soll die Hörbuchfassung meines Buches lesen. »Dein Buch hat mich sehr an die neunziger Jahre in Berlin erinnert«, sagt er. »Damals haben wir alles an Drogen genommen, was wir bekommen konnten. Eine großartige Zeit. Zumindest zu Anfang.«
Alexander Scheer wird am 1. Juni 1976 im Ostberliner Bezirk Lichtenberg geboren, er ist das erste Kind und wird das einzige bleiben. Sein Vater arbeitet als Abteilungsleiter im »Rechenzen-trum für Datenverarbeitung«; seine Mutter ist Hausfrau, sie strickt Jacken und Pullover, die sie an Nachbarn und auf Märkten verkauft. Einige Jahre nach Alexanders Geburt zieht die Familie nach Friedrichshain, in eine geräumige Dreizimmeraltbauwohnung mit großer Küche, Balkon und Erker. Im Hof vor Alexanders Fenster steht eine Kastanie.
Alexander ist ein guter Sportler, schnell und ausdauernd, sein Sportlehrer würde ihn gerne zum Boxer ausbilden. Aber die Eltern sind dagegen. Auch als Läufer und Springer gehört er zu den Besten an seiner Schule. Nur bei Weitwurf versagt er - die Handgranatenattrappen, mit denen er im Sportunterricht werfen muss, schlagen schon nach zehn Metern auf. Im Ernstfall hätte er wahrscheinlich seine Einheit in die Luft gesprengt.
Alexander liebt Filme, vor allem Science-Fiction-Filme, Western mit John Wayne, Mantel-und-Degen-Filme und »Ein Colt für alle Fälle« im Westfernsehen. Sein Taschengeld trägt er ins Kino. DEFA-Filme, »Winnetou«, »Die Olsen Bande«; eine Vorführung kostet fünfzig Pfennig. An besonders guten Tagen auch mal ein Film aus Hollywood. Aber die sind teuer. Für »E.T.« geht das Taschengeld eines gesamten Monats drauf, 3,20 Mark muss er im Kino »Kosmos« zahlen. Alexander ist wie vernarrt in diesen Film, wieder und wieder sitzt er mit klopfendem Herzen und aufgerissenen Augen im Kino, ungefähr ein dutzend Mal. An den Wochenenden baut er den Kopf des Außerirdischen in Orginalgröße nach, sein Vater hilft ihm, sie formen ein Drahtgestell, rühren Pappmaschee und Latexfarbe an. Aus Knetgummi modelliert Alexander das Gesicht, für die Augen benutzt er die Gläser einer alten Skibrille.
Filme verzaubern ihn. Er klebt sich Bärte an, malt sich Einschusslöcher auf die Stirn, bastelt zusammen mit seinem Vater aus Niveadosen und Holz eine Steinschlosspistole, wie sie in den alten Filmen benutzt wird. Von einem Besuch bei Verwandten in Westdeutschland schmuggelt ihm seine Mutter ein Buch über Special Effects über die Grenze, er vergräbt sich tagelang darin. Er beginnt zu experimentieren, mischt braunen Büroleim mit weißem Puder und rot-weißer Zahnpasta, so lange, bis die zähe Masse die Farbe der menschlichen Haut annimmt. Daraus modelliert er sich eine neue Nase, die täuschend echt aussieht. Zumindest aus einigen Metern Entfernung. Alexander ist ziemlich stolz auf diese Nase.
Er besitzt ein einziges »Donald Duck«-Heft, die sind schwierig aufzutreiben in der DDR. Also beginnt er, selbst Comics zu zeichnen. Später experimentiert er mit Vorlagen für Zeichentrickfilme, zeichnet seine Bilder auf durchsichtige Folien. Auch sein erstes Poster malt er sich selbst, ein Poster von Elvis. Er überträgt das Cover einer Elvis-Platte auf eine Folie, die er von hinten bemalt. Irgendwann werden die Farben klumpig und bröckeln ab, Elvis verliert seine Form. Wie im richtigen Leben.
Alexander beginnt, Gitarre zu spielen, übt die Songs von Elvis, ohne Noten, im Osten kursieren lediglich Fotos von Notenblättern auf Trödelmärkten, unter dem Tisch gehandelt für eine Menge Geld. Also verlässt er sich auf sein Gehör.
Mit ein wenig Fantasie und viel Enthusiasmus kann man beinahe alles erreichen. Und ziemlich viel Spass haben. Eine Lektion, die sein Leben prägen wird.
Am 1. Mai 1987 marschiert die NVA durch die Frankfurter Allee. Alexander hat schulfrei. Er ist elf Jahre alt und steht mit seinen Freunden, allesamt Jungpionieren, in Uniform am Straßenrand und schwenkt Wimpel mit Hammer und Sichel und eine Fahne mit dem Wappen der DDR. Ein japanischer Tourist filmt mit seiner Sony-Kamera die Parade und die Jungs mit ihren Fahnen und Wimpeln. Anschließend zeigt er ihnen die Aufnahme auf dem eingebauten Monitor. Zum ersten Mal sieht Alexander sich selbst in einem Film. »Was ist das denn?« denkt er. »Wie kann der den Film so schnell entwickeln?«
»Das ist Video«, sagt der Japaner und lächelt. Video. Für Alexander klingt das wie ein Zauberwort.
Der Japaner kauft den Jungs ihre Fahnen ab. Er will sie in Ostmark bezahlen, aber sie handeln zehn D-Mark aus, Westgeld, ein kleines Vermögen. Sofort stürmen sie den nächsten Intershop, geben das ganze Geld für Überraschungseier und Milky Way aus. Intershops sind das Größte, ein Schlaraffenland. Dort riecht es sogar anders. So muss der Westen sein. Die Mauer sieht Alexander nur sehr selten. Manchmal spürt er sie. Zum Beispiel wenn er davon träumt, ein Filmstar zu sein. So einer wie die in den Filmen aus Hollywood, denn die Stars der DEFA sind nur wenig glamourös. Aber er hat keine Ahnung, wie das gehen soll. Hollywood liegt im Reich des Bösen. Oder Popstar, aber das ist auch nicht einfacher, vor allem wenn man nicht die Puhdys, sondern Elvis Presley vergöttert. Egal. Alexander weiß, er möchte berühmt werden, Musik machen, Filme drehen, malen. Aber zuerst wird er wohl zur Armee gehen. Und dann wird er sich etwas suchen, irgendeinen Beruf, der mit Musik oder Kunst zu tun hat. Irgendeinen Job bekommt ja jeder in der DDR. Da wird auch für ihn etwas dabei sein. Um die Zukunft macht er sich nur selten Gedanken. Seine Welt ist geordnet.
Im Sommer 1989 verschwindet Alexanders Klavierlehrerin. Einmal die Woche ist er in den vergangenen zwei Jahren zu ihr nach Pankow gefahren. Sie hat ihm Stücke von Bach oder Tschaikowsky vorgespielt, Alexander hat neben ihr gesessen, konzentriert zugehört und genau auf ihre Hände geachtet. Dann hat er die Stücke nachgespielt, aus dem Gedächtnis Fingerstellung und Tonfolgen kopiert, ohne sich mit Noten zu plagen. Als er an einem Mittwoch im August an ihrer Tür klingelt, reagiert niemand. Vergangene Woche hat die Lehrerin ihm ihren Klavierhocker geschenkt. Da hat er sich schon gewundert. Sie hat ihren Termin noch nie vergessen. Später erfährt er, dass seine Klavierlehrerin sich über Ungarn in den Westen abgesetzt hat.
Am Morgen des 10. November 1989 weckt ihn sein Vater mitten in der Nacht. »Alex, aufstehen, die Mauer ist auf«, sagt er aufgeregt. In der Stimme seines Vaters schwingt auch Sorge mit. »Jetzt wird es gefährlich, bald haben wir Kapitalismus, dann geht es nur noch um Geld.« Alexander ist dreizehn. Es ist das Ende der Welt, wie er sie kennt. Mit einem Mal ist alle Ordnung vergangen.
»Das war der Big Bang«, sagt Alexander Scheer heute. Ein Altbau in Berlin Prenzlauer Berg, im Erdgeschoss der Laden eines asiatischen Lebensmittelhändlers, an der Straßenecke die U-Bahn-Station Eberswalderstraße. Er wohnt in der dritten Etage, zwei Zimmer, 68 Quadratmeter. Die Wohnung sieht aus wie eine Trödelmarkthalle oder die Requisitenkammer eines Theaters - voll gestellt mit technischen Geräten und Musikinstrumenten, Gitarren, Trommeln, Monitoren und Stapeln von Schallplatten. In der Ecke ein Klavier, daneben ein Bonanza-Rad und eine Staffelei. Die Bilder an den Wänden hat er selbst gemalt, auf der Toilette starrt einen Al Pacino vom Klodeckel an.
In einem Erker vor dem Fenster zwei Sitzkissen und ein kleiner Tisch - eine kleine Insel inmitten des Durcheinanders. Unter einer Zimmerpalme auf dem Fensterbrett steht E.T.
»Als die Mauer fiel, war ich dreizehn Jahre alt«, sagt Scheer. »Plötzlich war nichts mehr wie vorher. Das ganze Land veränderte sich. Und ich mich auch. Im Frühjahr 1990 kam der Stimmbruch, meine Hormone spielten verrückt und die neunziger Jahre hatten begonnen.« Er drückt seine Zigarette im Aschenbecher aus. Er hat sie bis auf den Filter runtergeraucht. Scheer kostet alles bis zum letzten Zug aus. »Das ist das Besondere an meiner Generation«, sagt er. »Eben waren wir noch Thälmannpioniere mit roten Halstüchern und wollten Kosmonaut werden oder Rockstar, irgendetwas, von dem wir ahnten, dass wir es wohl nie sein würden. Und dann war das ganze Land in Bewegung, ein Volk ging auf die Straße und zwang den Staat in die Knie. Plötzlich gab es Synthesizer, die Rolling Stones, Computer, Haschisch, Techno, Coca Cola, Privatfernsehen und Video. Wir sind Kinder einer Revolution.« Seine Augen leuchten. »Wir hatten keine Ahnung von Sex oder von Rock’n Roll, und von Drogen hatten wir auch noch nie gehört.«
Seinen ersten Joint raucht er mit fünfzehn. Ein Jahr zuvor ist Alexander Scheer an die Händel-Schule gewechselt. Sie galt lange Zeit als Eliteschule, ihr Schwerpunkt liegt auf musischen Fächern. Hier wurden in den vergangenen Jahrzehnten Musiker und Musiklehrer ausgebildet. In der DDR war es üblich, dass jeder Schüler, der eine besondere Begabung zeigte, an eine entsprechende Schule wechselte. Jetzt, nach der Wende, gibt es diese Spezialschulen offiziell nicht mehr. Also ist die Händel-Schule kurzerhand zum Gymnasium umdeklariert worden. Scheer, der neben Gitarre und Klavier mittlerweile auch Schlagzeug spielt, fühlt sich dort wie im Paradies - in jedem Klassenraum steht ein Klavier, die Jungs tragen mondäne Anzüge und rauchen Pfeife, die Mädchen tragen orientalische Kleider, in den Pausen spielen sie Flöte. Wenn sie über den Schulhof laufen, bimmeln kleine Glöckchen, die an einem Silberkettchen um ihre Fußgelenke baumeln. Noch bevor sein erstes Schuljahr an der Händel-Schule beginnt, kauft Scheer sich seinen ersten Anzug, eine Pfeife und eine Taschenuhr an einer silbernen Kette. Alexander nennen ihn nur noch seine Eltern und die Lehrer an der Schule.
An seinem dritten Schultag hört er aus einem Klassenraum ein Klavier und eine Stimme, die »Rocky Racoon« von den »Beatles« singt. In dem leeren Klassenzimmer sitzt ein Junge am Klavier, er trägt ein grünes Jackett und dazu eine weinrote Hose mit Schlag, sein dunkelblondes Haar ist kurz geschnitten. Als er Scheer im Türrahmen stehen sieht, lächelt er. »Kannst du mir das beibringen?« fragt er. Der Junge heißt Steve Patuta, er ist ein Jahr älter als Scheer. Von diesem Tag an sind die beiden Freunde.
»Zu dir, Alexander, Folgendes«, sagt Scheers Klassenlehrerin zwei Wochen später in scharfem Ton. »Pass auf, mit wem du dich hier anfreundest. Du bist so ein netter Junge. Ich habe gesehen, wie du auf dem Schulhof mit Steve Patuta Pfeife geraucht hast. Das ist kein guter Umgang.« Doch dieser Umgang ist das Beste an der Schule.
Nirgends spürt Scheer die Verwirrung und Angst der Wendejahre, den Verlust von Heimat so deutlich wie in der Schule. Wie geht das, ein neuer Staat werden? Was für eine Schule sind wir überhaupt, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule oder was? Wie sollen die selben Lehrer, die noch vor einem Jahr sozialistische Wahrheiten gepredigt haben, die Welt plötzlich neu erklären? Und vor allem: Wie soll man die noch ernst nehmen? Die alten Schulbücher haben ihre Gültigkeit verloren, neue gibt es noch nicht. Nur einen großen Fotokopierer von Rank Xerox, mit dem die Seiten westdeutscher Schulbücher kopiert werden. Scheers Klassenlehrerin kann noch nicht einmal den Markennamen fehlerfrei aussprechen.
Die Lehrer können keine Fragen beantworten und wissen selbst nicht, wo ihr Platz in diesem neuen Staat sein soll oder ob sie nächsten Monat noch unterrichten dürfen. Die Ersten sind schon wegen ihrer Kontakte zur Staatssicherheit aus dem Schuldienst entfernt worden. Schule ist Zeitverschwendung, uninteressant und unglaubwürdig. Zeit zu verschwenden ist eine Sünde. Die Welt außerhalb der Schulmauern ist viel aufregender. Wozu im Unterricht sitzen, wenn man jeden Tag Filme von Fellini, Godard, Polanski und Scorsese sehen kann? Wenn es jeden Abend LiveKonzerte gibt und Partys in besetzten Häusern und leerstehenden Fabrikhallen? Wenn es stündlich Neues zu entdecken gibt, Musik, Sex, Drogen?
Haschisch ist die erste Droge, die Alexander Scheer kennen lernt. Eine Feier an seiner Schule, einige ältere Jungs aus einer Nachbarschule haben das Dope mitgebracht und drehen den Joint. Früher am Abend hat Scheer mit seiner Band auf der Bühne gestanden. Er spielt Schlagzeug, die Band heißt »Plastic Explosion«, er hat sie gemeinsam mit vier anderen Jungs gegründet, die ebenfalls die Händel-Schule besuchen. Der Name scheint ihnen passend - »Plastic« wie all das Neue aus demWesten, und »Explosion« wie das, was im Osten passiert ist in den vergangenen zwei Jahren. Wenn sie auf Schulfesten in ihren Anzügen und mit dunklen Sonnenbrillen Coverversionen von den »Rolling Stones« und den »Beatles« spielen, himmeln die Mädchen sie an.
Scheer beobachtet, wie einer der Jungs aus der Nachbarschule einen Joint dreht. Er will auch kiffen, unbedingt. All die Jungs in den Bands, die er bewundert, nehmen Drogen - die »Beatles«, die »Stones«, Hendrix, »The Velvet Underground«, und die coolen Typen in den Büchern von Jack Kerouac und William Burroughs. Kiffen, das ist es. Nach drei, vier Zügen ist mit einem Mal alles schreikomisch, die Party, die Menschen. Scheer hat Tränen in den Augen. Als das Lachen verebbt, nimmt er die Musik wahr. Er hört sie nicht nur, er spürt sie im ganzen Körper. Es ist, als hätte sich eine Tür geöffnet. Eine Tür, zu der er den Schlüssel jetzt selbst in Händen hält. Scheer spürt, er hat an diesem Tag einen bedeutenden Schritt getan. Auf einem Weg, auf dem die anderen bald folgen werden.
Scheer und sein Freund Steve Patuta stürmen meist vorne weg. Zusammen fordern sie die Welt heraus, jeden Tag aufs Neue. Rennen gegen Wände und übertreten Grenzen. Gemeinsam schwänzen sie die Schule, verwüsten die Turnhalle der Schule. Stehlen nach dem Unterricht in den Läden der Umgebung Zeitschriften, Tiefkühlgerichte und M&M’s, um mit den Schokolinsen anschließend Passanten zu bewerfen. Alles ist Herausforderung und Wettstreit - schneller, härter, lauter, um jeden Preis. Wer stehen bleibt, verliert.
In den Monaten, die folgen, bleiben Scheer und Steve immer häufiger dem Unterricht fern. Scheer beginnt, Zigaretten zu rauchen. Als eine Art Training. Damit ihm das Kiffen leichter fällt. Vor der Schule treffen sie sich mit den anderen Kiffern, einer fährt einen alten Mercedes. Bei schönem Wetter hocken sie auf der Motorhaube und rauchen Joints. Das Läuten der Schulglocke hat keine Bedeutung mehr. Während ihre Klassenkameraden in stickigen Zimmern sitzen und Kompositionen von Bach analysieren, liegen sie weggetreten in der Sonne oder reden sich die Köpfe heiß, der Kassettenrecorder im Mercedes spielt »Stairway to Hea-ven«. Sie sind auf dem richtigen Weg, da ist Scheer ganz sicher. Malen, schreiben, reden, Musik machen - alles läuft noch besser, wenn er bekifft ist. Die Ideen purzeln nur so durch seinen Kopf, drängen hinaus in die Welt. Der Tag hat zu wenig Stunden für seinen Schaffensdrang. Wenn er im Klassenraum sitzt, holt er dort meist den Schlaf nach, den er in den Nächten zuvor verpasst hat. Zu lernen gibt es dort eh nichts für ihn.
Nachts in den Kellern der besetzten Häusern feiern die Punks, ein paar leere Bierkästen mit einem Brett darüber als Tresen, ein improvisiertes DJ-Pult, abenteuerlich zusammengelötet, der Strom an der Straßenlaterne abgezapft. Künstler aus der ganzen Welt leben und arbeiten in leerstehenden Kaufhäusern, stillgelegten U-Bahn-Schächten und Bauruinen, täglich wird ein neuer Club eröffnet, in einem baufälligen Haus, einer leerstehenden Fabrik, einem ehemaligen Bunker - Tresor, WMF, Toaster, Delicious Donughts, E-Werk. Die Frankfurter Techno-Szene hat Berlin als Spielplatz entdeckt - die Polizei hat den Überblick verloren, tausende junger Menschen sind auf der Suche, sie tanzen zu Techno, später Jungle und Break Beat. Musik, die radikal anders ist als alles zuvor. Berlin ist ein gigantischer Club, und alle sind gekommen, um zu feiern.
Scheer stürzt sich in diese Nächte, hungrig nach Neuem. Und entdeckt Ecstasy. Die Droge scheint auf magische Weise alles zu vernetzen - die Musik, die durch seinen Körper fließt, die Mädchen, die lächelnd über die Tanzfläche schweben, die Jungs, die mit aufgerissenen Augen durch die neue Welt tollen. Berlin ist der aufregendste Ort im Universum.
»Für uns gab es damals keine Grenzen und keine Autoritäten mehr«, sagt Scheer, er sitzt in seinem Wohnzimmer und öffnet eine Flasche Beck’s. »Berlin war Paradise City, eine Art rechtsfreier Raum. Schanklizenz, Behindertenklo, Notausgang - alles scheißegal. Kein Polizist wusste genau, was erlaubt ist und was nicht. Denen aus dem Osten haben wir erzählt, das ist jetzt völlig legal, wir sind jetzt BRD, denen aus dem Westen, das ist O.K., das machen wir im Osten schon immer so.« Unten auf der Straße schrillt eine Polizeisirene, Blaulicht fällt durch das Fenster. »Dann kamen die ersten Love Parades«, sagt er. »Wir haben uns als eine große, durch Musik und Drogen verbundene Gemeinschaft erlebt. In Berlin lief damals alles perfekt zusammen.«
Ein sonnendurchfluteter Frühlingstag 1995. Scheer ist achtzehn Jahre alt. Am Tag zuvor hat er erfahren, dass er die elfte Klasse wiederholen muss. Am Morgen hat er beschlossen, für den Rest des Schuljahres dem Unterricht fernzubleiben. Wenn er eh nicht versetzt wird, welchen Sinn hat es dann noch, Zeit im Unterricht zu verschwenden? Er ist nicht der einzige Schulversager. In seiner Klasse bleiben in diesem Jahr sämtliche Jungs sitzen. Alle haben mit dem Kiffen begonnen in diesem Jahr; haben vorgegeben, zur Schule zu gehen und stattdessen die Tage zugedröhnt verdämmert und die Nächte auf Partys durchgetanzt. Aber so etwas Banales wie Sitzenbleiben passt nicht in Scheers Konzept. Also hört er ganz auf. In dieser Stadt ist alles möglich, wen kümmert da das Abitur? Er will Schauspieler werden. Jetzt mehr denn je. »Wenn du das unbedingt willst, dann mach mal«, sagen seine Eltern. Sie haben schnell begriffen, dass alte Wahrheiten und Konzepte nicht mehr viel bedeuten. Es gilt, seine Chance zu suchen, neue Wege zu beschreiten. Scheers Vater hat seinen Job behalten und sich weiterbilden lassen, seine Mutter einen kleinen Laden für Strickwaren eröffnet. Scheer hat seinen Eltern auch erzählt, dass er hin und wieder einen Joint raucht. »O.K.«, sagt seine Mutter, »Hauptsache, du passt auf dich auf.« Sie traut ihrem Sohn zu, dass der seinen Weg findet in der neuen Welt.
An diesem Tag ist Scheer mit dem Fahrrad unterwegs, Christian, ein Freund, den er ebenfalls an der Händel-Schule kennen gelernt hat, begleitet ihn. Sie trinken Bier, die Sommersonne spiegelt sich in den Flaschen, der Kassettenrecorder spielt »Sky Pilot« von Eric Burdon.
»Jetzt fehlt nur noch was zu kiffen«, sagt Scheer.
»Lass uns zu Keller fahren«, sagt Christian.
Keller, ihr Dealer, wohnt in einem besetzten Haus in Fried richshain. Er ist Ende zwanzig, fast zwei Meter groß, hat kurzes, schwarzes Haar, er hört Reggae und Dub und trägt eine riesige Brille mit blauem Rahmen. Scheer und Keks haben ihn noch nie außerhalb seiner Küche gesehen. Sie klingeln an der Haustür, Keller schiebt seinen Kopf aus dem Küchenfenster im ersten Stock. Von unten ist nur seine Brille zu erkennen. Er wirft ihnen eine Socke hinunter, in die er den Wohnungsschlüssel gewickelt hat.
Als die beiden oben ankommen sitzt Keller in Hausschuhen am Küchentisch, wie immer. Wahrscheinlich hat er gar keine anderen Schuhe. Keller ist ständig zugedröhnt, wenn er redet, nuschelt er. Aber die Schlüsselworte, die verstehen sie.
»He Keller, was hast du heute im Angebot?« fragt Scheer.
»Hmmnn Afgne«, sagt Keller.
»Afghane, Klasse«, sagt Scheer.
»Hmmnn Gras.«
»Super!«
»Hmmnn Plze.«
»Nee, Pilze heute nicht.«
»Hmmnn krsse Pppn.«
»He? Was?«
»PAPPEN!«
»Was? Pappen? Kapier ich nicht.«
»LSD MANN!«
»Ach LSD! Geil, lass mal sehen.«
Keller verkauft ihnen Yellow Sunshines, ein Quadratzentimeter große Pappplättchen mit LSD beträufelt und einer gel-ben Sonne bedruckt.
In Christians Wohnung schlucken die beiden die LSD-Trips. Nach etwa einer halben Stunde glaubt Scheer, dass der Küchenboden sich windet und schliert, die Sonnenstrahlen zaubern Farbreflexe auf das PVC. Der Kassettenrecorder spielt »Umma-gumma« von Pink Floyd, die Haare auf ihren Unterarmen stellen sich auf. »Mann, ist das geil«, sagt Scheer. Christian starrt ihn mit weit aufgerissenen Augen an, nickt wie in Zeitlupe.
Sie verbringen das gesamte Wochenende in der Wohnung, als die Wirkung verebbt, rauchen sie einen Joint, das Haschisch befeuert das LSD aufs Neue. Ungefähr alle acht Stunden werfen sie Trips ein. Zwischendurch fährt Scheer nach Hause, holt seine Videokamera und seinen Videomischer. Die Geräte hat er von dem Geld gekauft, dass er zu seiner Jugendweihe geschenkt bekommen hat. Sie verkabeln die Kamera mit dem Videomischer und verschalten den Mischer in einer Schleife mit sich selbst, so dass er sein eigenes Signal modifiziert. Scheer filmt seine Hand, die sich langsam von links nach rechts bewegt. Auf dem Videobild schwimmen Farben und Konturen ineinander, so ähnlich wie in seinem von LSD getunten Hirn.
Sie füllen einen Topf mit Wasser. Filmen die Wasseroberfläche. Die ganze Nacht sitzen sie davor, filmen dasWasser durch die unterschiedlichsten Farbfilter. Versetzen die Oberfläche in Schwingung, gießen Spülmittel dazu, Farbtropfen, Öl. Und dokumentieren mit ihrer Kamera versunken jede Veränderung in Struktur und Farbe des Wassers. Sie zünden das Öl an, die Wasseroberfläche ein Miniaturflammenmeer. Dieser Topf ist ihr eigenes Universum, hier sind sie Götter. Die Nacht ist erfüllt von Farben, Licht und Bewegung. An Schlaf ist nicht zu denken.
Seit er nicht mehr zur Schule geht, bleibt Scheer meist bis Mittag im Bett. Am Nachmittag bekommt er Klavierstunden. Manchmal jobbt er, recht Laub auf dem Friedhof, trägt Briefe aus oder steht nachts hinter einem Bartresen. So hat er seinen Führerschein finanziert und sein erstes Auto, einen alten Trabant. Nachmittags trifft er sich mit seinen Freunden. Einige von ihnen tragen jetzt weite Hosen, Kapuzenpullis und Baseballkappen, hören HipHop und gleiten auf Skateboards über die Betonflächen des Hochhausghettos. Ihre Staffeleien sind Brückenpfeiler, Hauswände und Straßenbahnwagen, an die sie nach der Schule ihre tags sprühen. Auch die Drogen sind andere, vor kurzem hat Scheer Speed und Koks kennen gelernt. Die Drogen putschen ihn auf, drehen ihn hoch, er schläft immer weniger. Trifft seine Freunde, hört Platten, nimmt Haschisch, LSD, Ecstasy, Speed und Koks. Macht Musik, dreht Videos, plant das nächste Graffiti oder nimmt eines der Mädchen mit nach Hause. Sie schmieden verwegene Pläne. Eine Fabriketage, in der sie zusammen wohnen, Musik machen, Filme drehen, Bilder malen, das wäre es. Eine Art Factory, so wie die von Andy Warhol in New York in den Sechzigern. Sie ziehen zugedröhnt durch Ostberlin, inspizieren leere Fabrikhallen, feiern Partys auf Hausdächern.
Im Sommer, wenn die Touristen in Berlin einfallen, fliehen Scheer und seine Freunde aus der Stadt. Außerhalb von Berlin finden Partys statt, auf Feldern oder stillgelegten Truppenübungsplätzen - Techno, Drogen und überall lächelnde Menschen, die in den Sonnenaufgang tanzen. Scheer und seine Freunde sind LSD-Kosmonauten, erforschen die unendlichen Weiten des Drogenrausches. Das ist Leben, denkt Scheer. So intensiv und aufregend wie nie zuvor. Und auch später nie mehr.
Nach einer Ecstasy-Nacht sitzt er in einem Baum, beobachtet Schmetterlinge. Den Jungen neben ihm, Andre Jagusch, hat er in der Nacht zuvor kennen gelernt. Andre jobbt als Filmvorführer in einem Berliner Kino. Die beiden haben gerade einen LSD-Trip eingeworfen, reden über Kino, ihre Lieblingsfilme, Schnitttechniken, Kamerafahrten. Erzählen von ihren ersten eigenen Filmen. Und beschließen, eine Filmproduktionsfirma zu gründen. Wenige Tage später entsteht »Nine O’Clock Pictures«. Christian und Steve sind mit dabei, Scheers Freunde von der Händel-Schule und Mirco Dzikanski, ein aufgedrehter Junge mit einer Vorliebe für Kleidung aus den siebziger Jahren, Plateauschuhe, große Brillen, Hosen mit Schlag und schreibunte Pullis mit Rollkragen.
Gemeinsam drehen sie an einem Abend ihren erster Kurzfilm, »American Showdown 1«, in derselben Nacht geschnitten. Eine Minute Action, Verfolgungsjagd und Schusswechsel, mit bescheidenen Mitteln und viel Begeisterung in Szene gesetzt. Die Kamera wird zu ihrem ständigen Begleiter, neben inszenierten ActionSequenzen und psychedelischen Bildkompositionen filmen sie vor allem ihren Alltag, die Partys und Konzerte, die sie besuchen, das Leben in den Clubs und auf den Straßen Berlins, die Auftritte mit der Band, die Tage und Nächte auf Droge. Sie spüren, dass sie etwas Außergewöhnliches erleben. Sie sind an einem besonderen Ort, zu einer besonderen Zeit. Ein ganzes Land ändert sich, Lebensläufe werden umgeschrieben. Und sie sind Teil dieser Veränderung, ihre Generation steht im Mittelpunkt von all dem. Das müssen sie festhalten, bewahren. Außerdem hilft ihnen die Kamera, zu verarbeiten. So vieles geschieht so schnell, möglich, dass ihnen etwas entgeht, wenn sie nicht alles festhalten.
Manchmal allerdings wird es Scheer zu viel. Die Nächte auf Speed und Kokain sind ein großer Spass, alle reden durcheinander, begeistern sich, machen Pläne. Aber auch wenn die Party vorbei ist, geht der Trubel in seinem Kopf weiter. Die Droge gönnt ihm keine Ruhe, sie hat sich in seinem Körper festgebissen, reißt ihm die Augen auf, Arme und Beine zucken, ohne Chance auf Schlaf wälzt er sich über Stunden in seinem Bett. Am nächsten Tag fühlt er sich ausgehöhlt, kraftlos, stumpf. Ein hoher Preis für die Party, denkt er immer häufiger - Speed und Koks, damit muss man dosiert umgehen.
Zu viele dieser toten Tage kann und will er sich nicht leisten. Er spielt mittlerweile im TIK, einem Off-Theater, die Gagen sind miserabel. Aber es ist sein erstes, bezahltes Engagement. Die Erfüllung seines Lebenstraums rückt näher. Am Theater hat er sich in ein Mädchen verliebt, ebenfalls eine Schauspielerin. Wenn sie nicht spielen, verbringen sie ganze Tage gemeinsam im Bett, hören Musik, schauen »Star Trek« und kiffen, oder sie sehen sich Stücke auf den zahlreichen kleinen Bühnen in Berlin an. Scheer verbringt viel Zeit im Theater und mit den Menschen dort. Drogen spielen hier keine große Rolle. Er wird zu einem Wanderer zwischen den Welten.
Kurz darauf erfährt Scheer, dass eine Werbeagentur für eine Videoproduktion Statisten für eine Clubszene sucht. Das Casting findet in einem Club statt. Scheer, Andre, Christian, Steve und Mirco werden sofort gebucht. »He, ihr seht echt cool aus in euren Anzügen«, sagt einer der Schauspieler dort. »Warum macht ihr nicht ein paar Fotos und bewerbt euch bei Agenturen?«
In der darauf folgenden Woche klauben Scheer und seine Freunde alte Fotoapparate aus der DDR zusammen, die in den Kellern ihrer Eltern verstauben, klauen in den Secondhandläden Anzüge und Hemden, rauchen Joints, trinken Bier und schießen Bilder, die sie selbst entwickeln. Mit diesen Fotos bewerben sie sich bei Casting-Agenturen. »Type Face«, die Agentur eines Fotografen, der nachts als Türsteher im Techno-Club »E-Werk« jobbt und dort die hübschesten Mädchen und lässigsten Jungs für seine Kunden rekrutiert, nimmt sie in ihre Kartei auf. Scheer bekommt die ersten Statistenrollen, Auftritte in Werbespots für Waschmaschinen und eine Bausparkasse folgen.
Im August 1996 läuft »Trainspotting« in den deutschen Kinos. Der Film erzählt von einer Hand voll Junkies in Schottland, rasante Bilder, lässige Jungs, schöne Mädchen, coole Dialoge und ein knalliger Soundtrack, Iggy Pop, Lou Reed, Primal Scream, allesamt ebenfalls frühere Junkies. Heroin verbreitet sich in den kommenden Wochen und Monaten wie ein Grippevirus. Doch dieses Mal rennt Scheer nicht vorne weg. »Bisher war ja alles cool«, denkt er, »aber jetzt muss mal einer den Kopf klar behalten und aufpassen.«
Trotzdem, einmal Probieren kann ja nicht schaden. Alles ausprobieren, Erfahrungen machen, keine Gelegenheit auslassen. So lebt er seit Jahren. Außerdem will er sie kennen lernen, diese Droge, die das Leben einiger seiner Freunde bestimmt. Im Januar 1997 sitzt Scheer bei Hinze auf dem Sofa. Hinzes Wohnung ist der Treffpunkt der Junkie-Szene, auch einige von Scheers Freunden gehen dort ein und aus. Einer von ihnen wohnt sogar dort. Die Wohnung ist verwahrlost, in der Küche schimmelt das schmutzige Geschirr, im einzigen Zimmer stapelt sich der Müll. Blutflecken und Brandlöcher überall, in der Luft liegt ein atemraubender Geruch - Schweiß, Alkohol, Verwesung, Blut und abgestandener Zigarettenrauch.
Scheer kennt Hinze flüchtig, hin und wieder haben die beiden auf einer Party zusammen Kokain oder Speed geschnupft. Hinze ist ein hoch gewachsener Junge, der nur weiße Kleidung trägt. Er war mal ein begnadeter Graffiti-Sprayer. Das ist noch kein Jahr her, scheint aber in einem anderen Zeitalter gewesen zu sein. Jetzt sieht Hinze aus wie abgestorben. Seine Haut ist bleich, seine Augen sind stumpf und wässrig. Er malt nicht mehr, geht nicht mehr auf Partys. Verdämmert den Tag in der zugemüllten Wohnung, geht nur noch vor die Tür, wenn die Heroinvorräte zur Neige gehen. Wenn er seine Dosis nicht bekommt, bricht ihm der Schweiß aus, Krämpfe in seinem Magen, Durchfall martert seinen Darm. So stellt sich Scheer das Leben nicht vor.
Scheer häuft etwas von dem braunen Pulver auf ein Stück Aluminiumfolie, rollt einen Zwanzig-Mark-Schein zu einem Röhrchen, steckt den Geldschein in den Mund und nimmt dann die Alu-Folie in die linke Hand. Mit der rechten führt er ein brennendes Feuerzeug darunter, langsam und vorsichtig, bis die Hitze das braune Pulver zu einem dampfenden Brei verschmilzt. Atmet den Rauch ein, zieht ihn tief in seine Lunge. Gemeinsam rauchen sie ein halbes Gramm Heroin. »Geiles Gefühl«, denkt Scheer. Alle Konturen verblassen, verlieren ihre Schärfe. Den Müll und den Dreck in diesem Zimmer nimmt er noch wie aus weiter Ferne wahr, das hat nichts mit ihm zu tun, berührt ihn nicht. Entspannt streckt er sich auf den fleckigen Matratzen aus. Versinkt darin wie in warmem weichem Wasser, das ihn umfließt und trägt.
Stunden später steht Scheer auf und verabschiedet sich. Am nächsten Tag hat er eine Vorstellung am Theater, da muss er wieder auf den Beinen sein. Irgendwo in Scheers Kopf gibt es eine Stimme, die sich nicht einlullen lässt vom Heroinrauch. Die laut und vernehmlich »Vorsicht!« sagt. Sicher, Drogen sind ein Teil seines Lebens, aber sie illuminieren die Tage und Nächte, sind Treibstoff, Inspiration. Eine Droge, die sein Leben beherrscht und verdunkelt, ist nicht das, was er sucht. Drogen nehmen, sich berauschen, sicher; aber abhängig sein, nein, das nicht. Wo bleibt da der Spass?
Im Februar 1997 wird in Berlin die »Goldene Kamera« verliehen. Eine große Gala im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, das Haus ist umlagert von Kamerateams und jungen Mädchen. Die »Backstreet Boys« werden erwartet, sie gehören zu den Preisträgern. Scheer, Steve, Andre und Mirco sind nicht eingeladen. Trotzdem, irgendwie müssen sie da rein. Nur haben sie dieses Mal keine Idee, wie sie das anstellen sollen. Sich gratis in Konzerte und Kinos oder ohne Einladung auf exklusive Empfänge und Partys schleichen haben sie zur sportlichen Disziplin kultiviert. »Ruppen« nennen sie das, der Ausdruck stammt aus der Szene der Autogrammsammler. Eigentlich bedeutet er stehlen.
Scheer und seine Freunde tragen bunte Anzüge mit Schlag, dazu riesige Sonnenbrillen und Hemden mit großem Kragen. Sie haben immer Drogen in den Taschen und sind meist zu viert unterwegs. Wie die »Beatles«.
Ein Mädchen hält die vier Jungs in ihren Anzügen irrtümlich für die »Backstreet Boys«. Sie beginnt zu kreischen und deutet auf die vier. Plötzlich rennen zweihundert Mädchen in ihre Richtung, Scheinwerfer leuchten auf. Die Jungs treten die Flucht an, rennen in Richtung Notausgang. Der Ordner erkennt ihre Bedrängnis, reißt geistesgegenwärtig die Tür auf und wirft sie hinter ihnen wieder zu. Ein erster Moment als Popstar.
Es fällt den Jungs nicht immer so leicht, in die Hotels und Hallen zu gelangen. Aber es gelingt ihnen immer. Bei der Eröffnung des Hotel Adlon zum Beispiel ist sogar der Kanzler eingeladen, alle Eingänge sind abgeriegelt. Aber die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, das Geschirr wird draußen in einem Innenhof gespült. Scheer und seine Freunde balancieren über eine Mauer in diesen Innenhof, in drei Metern Höhe, über die Köpfe des Küchenpersonals hinweg. Sie fühlen sich wie Ninjas, geschickt, unsichtbar. Als niemand hinsieht, schlüpfen sie in das Hotel. Die exklusivste Veranstaltung der ganzen Stadt, und sie sind dabei. Rauchen auf dem Klo ihre Joints und werfen ihre Ecstasy-Pillen ein. In einem Vorraum dreht ihnen ein livrierter Schwarzer den Wasserhahn auf und reicht ihnen ein Handtuch, neben dem Waschbecken stehen Flakons mit Parfum von Calvin Klein und Hugo Boss. Am Ende des Abends befinden sich all diese Flakons in den Taschen der vier.
Die neunziger Jahre sind voll von solchen Veranstaltungen. Scheer und die anderen Jungs von »Nine O’Clock Pictures« sind meist dabei, essen das Buffet leer, trinken Wein und amüsieren sich. Und das alles gratis. Die Kamera haben sie immer dabei. Sie dokumentieren, wie sie durch Toilettenfenster einsteigen, sich durch Dienstboteneingänge schleichen, tanzen, trinken und kiffen. Auf einem Empfang reden die Jungs völlig zugedröhnt minutenlang auf Eberhard Diepgen ein, bei Premierenpartys stößt Scheer mit Jürgen Vogel und Otto Sander an, und während einer Gala beobachtet er, im Ecstasy-Rausch versunken, einen Spuckefaden, der sich vom Mund Arnold Schwarzeneggers zu dessen Zigarre zieht, die der Hollywood-Star in der rechten Hand hält. Oft schleppen sie Möbel, Geschirr, teure Weine und Elektrogeräte aus den Hallen. Die Welt ist ein Selbstbedienungsladen, man muss nur wissen, wo die Hintertür ist.
»Wir waren rotzig und arrogant«, sagt Scheer, »und wir waren nicht bereit, für irgendetwas zu bezahlen. Warum soll ich Tickets kaufen, wenn ich mich auch durch das Toilettenfenster reinschleichen kann? Das war nicht unser Land, nicht unsere Gesellschaft, wir waren davon überzeugt, dass wir niemandem etwas schulden. Uns gab es eigentlich gar nicht, wir waren eine Zwischengeneration, gehörten weder hier- noch dorthin.«
Auf die Euphorie des Mauerfalls ist bald Ernüchterung gefolgt. Die gewaltsame Räumung der besetzten Häuser in der Mainzer Straße, der Polizeieinsatz am Ersten Mai am Kollwitzplatz, als die Beamten mit Wasserwerfern und Tränengas ohne Rücksicht auf Kinder und friedlich feiernde Anwohner Jagd auf Autonome machen. Und in den Fabrikhallen, in denen sie wilde Parties gefeiert haben, haben MTV und Universal ihre Firmenzentralen eingerichtet.
»Wir haben schnell gespürt, dieser Staat ist auch nicht viel besser als der alte«, sagt Scheer. »Anfangs war ich ziemlich stolz auf die Menschen im Osten. Da ist ein ganzes Volk unter Lebensgefahr auf die Straße gegangen und hat seine Meinung vertreten, gesagt, dieser Staat ist Scheiße, wir wollen anders leben, reisen. Wir waren zwar die Hansel, die alles selber basteln mussten, aber da war eine unglaubliche Energie, ein Gefühl von Zusammenhalt. Dann kam das Begrüßungsgeld, und wir haben uns kaufen lassen. Trotzdem, die Jahre zwischen dreizehn und einundzwanzig waren einmalig. Wir haben gedacht, es geht immer so weiter. Tut es aber nicht.«
Im Frühjahr 1998 zieht das TIK um in neue Räume. Die Neueröffnung soll mit einer großen Party gefeiert werden. »Das ist die Gelegenheit«, erkennt Scheer. Er sitzt mit Steve, Andre, Christian und Mirco in ihrer gemeinsamen Wohnung. Sie sind in die Endetage eines Altbaus in der Danziger Straße eingezogen. Eine Eröffnung im großen Stil - ein Theaterstück, Livemusik mit der Band, Bilder an den Hallenwänden, die Kurzfilme, die sie gedreht haben, auf riesige Leinwände projiziert und eine wilde, exzessive Party - endlich kann Scheer die verschiedenen Welten, in denen er lebt, zusammenfügen. Factory im großen Stil, zumindest für eine Nacht. Auf diesen Moment scheint er zugesteuert zu sein in den vergangenen Jahren. Er reißt die Organisation an sich. Und begreift, dass er sich viel vorgenommen hat. »O.K., jetzt wird’s ernst«, denkt er. »Das wird eine komplizierte Sache. Ich muss den Überblick behalten. Schluss mit den Drogen.«
Am nächsten Morgen kocht er einen starken Kaffee, kauft Croissants und Zigaretten, räumt seine Wohnung auf und beginnt zu telefonieren. Einige Wochen zuvor hat er auf einer Party mit Julia Valet, einer Moderatorin von MTV, getanzt. Leider hat er ihre Telefonnummer verloren. Also ruft er in der MTV-Zentrale in London an. Und wird tatsächlich durchgestellt. Sie verspricht, mit einem Kamerateam zu kommen. Scheer brennt vor Eifer und Begeisterung, er ist so überzeugend, dass Widerspruch unmöglich scheint. Stunde für Stunde telefoniert und organisiert er, wie im Fieber, berauscht sich an der Arbeit, am Erfolg, schläft kaum.
Einige Wochen später, am Tag vor der Eröffnungsfeier, er-fährt Scheer, dass Hinze verschwunden ist. Hinze ist immer noch auf Heroin. Einige Tage zuvor hat er sich einen Druck in die Hand gesetzt, aber die Vene nicht getroffen. Das Gewebe hat sich entzündet und die Hand ist immer weiter angeschwollen, bis sie aussah wie die Hand von Micky Maus, prall und überdimensioniert. Möglicherweise eine Blutvergiftung. Aber Hinze hat keine Zeit, sich darum zu kümmern. Drogen auftreiben ist aufreibend genug. Und das Heroin betäubt die Schmerzen.
Eine Ärztin, die sich um die Jungs und Mädchen in der Berliner Drogenszene kümmert, hat Hinze einen Therapieplatz besorgt und eine Einweisung in ein Krankenhaus, zur Entgiftung. Dort würden sie sich auch um seine Hand kümmern. Vorausgesetzt, dass er sich am nächsten Tag in diesem Krankenhaus einfindet. Aber keiner weiß, wo Hinze steckt. Aus seiner Wohnung ist er vor Wochen rausgeflogen. Die Jungs machen sich auf die Suche. Zuerst fahren sie zu Hinzes Mutter, klauben die nötigen Unterlagen zusammen, Personalausweis, Versicherungskarte. Dann durchkämmen sie die Stadt. Und finden Hinze spät in der Nacht in der Wohnung eines anderen Junkies. Belämmert liegt er auf der Couch, der Fernseher läuft. Er hat sich gerade einen Schuss gesetzt. Seine entzündete Hand sieht aus, als würde sie bald platzen, rot und prall wie die Schaumstoffhände, die in Amerika bei Sportveranstaltungen an das Publikum verkauft werden. Hinze sieht aus, als würde er nicht mehr lange durchhalten.
»Hinze, das war dein letzter Druck«, sagt Scheer. »Du kommst jetzt mit zu uns, und morgen gehst du ins Krankenhaus.« Der Spass, erkennt Scheer, ist endgültig vorüber. Jetzt gilt es zu retten, was noch zu retten ist. Hinze folgt ihnen ohne Widerspruch.
Heroin hat die Ernüchterung gebracht. Heroin, denkt Scheer, ist die Droge derer, die nicht klarkommen. Die nicht kapieren, wann es genug ist mit Spass und ein Gang runtergeschaltet werden muss. Die es nicht schaffen, einen Job oder eine Perspektive zu finden, einen Platz in dieser neuen Welt. Die keine Ambitionen, keine Leidenschaften mehr haben, nichts mit sich und ihrem Leben anzufangen wissen und nur noch stumpf dahindämmern.
Am nächsten Tag liefern sie Hinze im Krankenhaus ab. Am Abend findet die Eröffnungsfeier des TIK statt. Ein rauschendes Fest. Die Band spielt, Scheer am Schlagzeug. Auf die Wände projizieren sie die Videofilme, die sie in den vergangenen Jahren gedreht haben. Die gesamte Zeit über hat Scheer kein Haschisch geraucht, kein Ecstasy genommen und kein LSD. Ein Monat ohne Drogen, der erste seit Jahren.
»Nach der Party war die krasse Drogenzeit vorüber«, sagt Scheer heute. »Genauso haben wir uns das immer vorgestellt - wir nehmen ein paar Jahre frei, machen Party und sehen dann zu, dass wir einen Job finden, der uns Spass macht und unsere Rechnungen zahlt. Wichtig war immer, den Spagat hinzubekommen zwischen Geld verdienen und deine Haltung, deine Begeisterung nicht verlieren.«
Einige Monate nach dieser Party wird er von Leander Hauß-mann als Hauptdarsteller für den Film »Sonnenallee« verpflichtet. Der Start seiner Karriere als Schauspieler. Engagements am Bochumer Schauspielhaus und der Berliner Volksbühne folgen sowie diverse Rollen in Film und Fernsehen, darunter ein Kinofilm an der Seite von Götz George und eine Rolle in der ARD-Serie »Berlin, Berlin«. Seit Ende der neunziger Jahre arbeitet er beinahe ununterbrochen, für Drogenexzesse fehlen ihm meist die Zeit und die Gelegenheit.
2001, als sein Engagement in Bochum ihm einige freie Wochen im Sommer beschert, unternimmt er eine letzte Reise in die Vergangenheit. Fährt zurück in seine Heimatstadt, verdämmert gemeinsam mit seinen alten Freunden Tage auf Outdoor Partys und Raves im Berliner Umland, tanzt Nacht für Nacht in den Clubs, kifft, schnupft Kokain und Speed, schluckt Ecstasy, LSD und Pilze. Aber das Hoch der Drogen verweht immer schneller, der Rausch fühlt sich häufig schal an. Der Kater holt ihn immer schneller wieder ein. Nach sechs Wochen steht er an einer Autobahnraststätte hinter Berlin, hohlwangig und übernächtigt. In seiner Hand ein selbst gemaltes Pappschild mit dem Schriftzug »Bochum« darauf. Er hat den Ausflug in die Vergangenheit beendet und ist auf dem Weg zurück in seine Zukunft.
»Irgendwie war der Spass vorbei«, sagt er. »Überall wimmelte es von Sponsoren und Fotografen, und in den Clubs ging es nur noch darum, welcher berühmte DJ auflegt. Und die Drogen und die Musik wurden auch immer schlechter.«
Manchmal allerdings trauert er diesen Jahren der Drogen und exzessiven Partys noch nach. »Seit sechs Jahren arbeite ich permanent«, sagt er. »Die Zeiten, in denen ich mittags aufgestanden bin, einen Joint gedreht, meine Gitarre genommen habe und raus in den Tag gegangen bin ohne zu wissen, was kommt, sind leider vorbei.«
Heute ist es in erster Linie die Arbeit, die ihn berauscht, die Feierabendbiere nach einer Vorstellung in der Theaterkantine oder ein Joint, wenn er sich nach einer Aufführung so aufgekratzt fühlt, dass er keinen Schlaf findet. Nur wenn in den spielfreien Sommermonaten im Theater keine Dreharbeiten anstehen, gönnt er sich noch die eine oder andere rauschverlorene Nacht. Aber auch wenn die Drogen ihre Bedeutung verloren haben und jetzt der Terminkalender seine Tage strukturiert, grundlegend verändert hat sich sein Leben nicht. Er ist vorwärts gestürmt. Und dennoch bei sich geblieben.
Scheer spielt meist drei Vorstellungen in der Woche, in Hamburg und Berlin. Er feiert auf Premierenpartys die Nächte durch, ist meist vor Mittag nicht ansprechbar. Jagt von einem Termin zum anderen und wirft sich kopfüber in jedes neue Projekt, geht oft weit über die Schmerzgrenze. Ein Leben im Rausch, auch ohne Droge. Wenn er nicht auf der Bühne steht oder dreht, malt er, spielt mit Freunden in einer Band oder produziert befreundete Musiker. Häufig vergisst er zu essen, genug Schlaf bekommt er selten. Er träumt davon, irgendwann mehr als sechzig Kilo zu wiegen. Mit der U-Bahn fährt er häufig schwarz, und Eintritt zahlt er immer noch nicht gerne. Auf Premierenfeiern und Empfänge wird er mittlerweile offiziell eingeladen.
Es ist ihm gelungen, eine Nische in der Welt zu finden, in der er die Energie, die ihn umtreibt, den Lebens- und Erfahrungshunger nutzen kann. Einen Job, in dem es ihm verziehen wird, wenn er übertreibt und über die Stränge schlägt. Und er hat ein feines Gespür dafür entwickelt, wann es nötig ist, allen Irrsinn beiseite zu schieben und sich auf den Punkt konzentriert und verlässlich zu zeigen. Bei allem Überschwang und kreativem Chaos behält er die Kontrolle, über seine Arbeit, sein Leben.
Im April 2005 erschien die DVD zu »American Showdown«. Die Jungs von »Nine O’Clock Pictures« haben in den vergangenen Jahren noch sechs weitere Folgen gedreht. Am 9. April fand die Release-Party statt, sie dauerte bis in den Morgen. Um 9.30 Uhr stieg Alexander Scheer in den ICE nach Hamburg, am Abend sollte er am Schauspielhaus den Othello spielen, für den Nachmittag war eine Probe angesetzt. Er hatte nicht geschlafen in der Nacht und trug noch die Kleidung der Premierenfeier - Tarnan-zug, Sonnenbrille; sein weißes T-Shirt war mit Blut bespritzt, auf der Party war Scheer mit seiner Band aufgetreten, hatte Bass gespielt, bis die Haut an seinen Fingerkuppen aufgerissen war. In seinem Hosenbund steckte eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Als die Zugbegleiterin seine Fahrkarte kontrollieren wollte, sah sie die Plastikwaffe. Zu Tode erschrocken alarmierte sie den Bundesgrenzschutz. Der ICE wurde bei Büchen in Schleswig-Holstein angehalten, Alexander Scheer verhaftet und mit Handschellen abgeführt. Als das Missverständnis aufgeklärt war, ließ der Intendant des Schauspielhauses seinen Hauptdarsteller mit einem Taxi die sechzig Kilometer zum Theater fahren.
Stunden später hat Alexander Scheer als Othello auf der Bühne gestanden. Hat eine leidenschaftliche und konzentrierte Vorstellung geboten, die das Publikum zu frenetischem Beifall hinriss.
Hinze ist nach seinem Entzug rückfällig geworden. Heute lebt er in Hamburg. Scheer hat ihn seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen. Steve Patuta arbeitet in einem Tonstudio und komponiert Musik für Filme und Werbespots. Zusammen mit Scheer spielt er in der Band »Rockboys«. Andre Jagusch arbeitet als freier Kameramann und Regisseur, er dreht Filme und Werbespots. Alexander Scheer hat in diesem Jahr bei der Wahl zum Schauspieler des Jahres von der Zeitschrift »Theater heute« den dritten Platz belegt, Othello ist zur Inszenierung des Jahres gewählt worden. Demnächst wird er in einem Kinofilm den Ex-Junkie Keith Richards spielen. Die drei Freunde planen, die dutzende von Videobändern, die in ihren Wohnungen lagern, eines Tages zu einem Film zu verarbeiten. Eine Dokumentation, die zeigt, wie das war, damals, als sich ihre Welt veränderte.