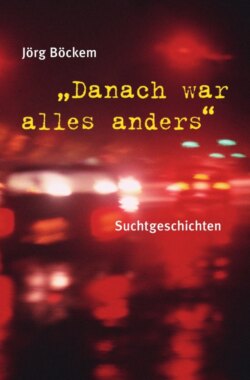Читать книгу Danach war alles anders - Jörg Böckem - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Laura, 17, Schülerin aus Dresden Verstecken
ОглавлениеDas Mädchen wartet im Treppenhaus. Ein monströser Gebäudekomplex inmitten einer Hochhaussiedlung in der Dresdener Vorstadt, mehr als fünfzig Wohnungen auf zehn Etagen, ein unübersichtliches Gewirr von Treppen, Fluren, Eingangs- und Zwischentüren. Der Aufzug hält nur auf jedem zweiten Stockwerk. »Hier entlang«, sagt sie. Dann reicht sie mir die Hand, zögerlich, die Geste mehr Frage als Aufforderung. »Hallo, schön Sie zu sehen. Ich bin Laura.« Es ist Sommer 2004.
»Ich bin fünfzehn, gehe in die neunte Klasse einer Realschule in Dresden und bin eine >Leseratte<«, hatte mir dieses Mädchen einige Wochen zuvor geschrieben. Das Wort »Leseratte« hatte sie in Anführungszeichen gesetzt. »Mein >Lieblingslesestoff< sind Bücher über Drogen«, schrieb sie. »Dass Sie Heroin genommen haben, kann ich irgendwie verstehen, wenn man Probleme hat oder mit seinem Leben nicht mehr klarkommt, findet man sich irgendwann in einer Sucht wieder. Ich selbst habe auch Probleme: Unzufriedenheit mit meinem Körper (ich wiege siebzig Kilo), meine schwerstbehinderte Schwester und mein Vater, der seit acht Jahren Alkoholiker ist. Meine Mutter ist meine wichtigste Bezugsperson - sie selbst war lange kaufsüchtig.« Ihr Brief endet mit den Worten: »Danke fürs Zuhören. Ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann.«
Laura ist ziemlich groß für ihr Alter. Ein hübsches Gesicht, umrahmt von langem, dunkelblondem Haar, in das sie braune Strähnen gefärbt hat, wache, blaue Augen, die sie oft gesenkt hält. Zugegeben, sie ist kräftig. Aber siebzig Kilo auf ungefähr 1,70 Meter Körpergröße verteilt - wirklich dick ist das nicht. Mit den fetten Kindern, die sich in TV-Sendungen durch Diät-Camps quälen, hat sie nichts gemein. Laura schließt die Wohnungstür auf. Vierzimmerwohnung, eine bescheidene Mittelstandsidylle - Einbauküche, ein großer, heller Raum mit Balkon, der als Wohn- und Esszimmer dient, eine Couchgarnitur aus Leder, eine Schrankwand aus Esche, ein Esstisch mit vier Stühlen. In der Vitrine Gläser und Porzellan, an der Wand ein Landschaftsbild, Wald und Wiesen in weiches Licht getaucht. In einem Regal Bücher über New York. Aber eine Urlaubsreise dorthin sei nie drin gewesen, leider, sagt Lauras Mutter, eine korpulente Fünfzigjährige mit kurzen, blonden Haaren und einem freundlichen Gesicht. Sie ist zuvorkommend, ihre Tochter verblasst ein wenig neben ihr. Lauras Mutter arbeitet für einen privaten Krankenpflegedienst. Sie ist eine Frau, in deren Obhut Patienten sich aufgehoben fühlen können.
Lauras Vater ist nicht da. Und dennoch allgegenwärtig. Vor sechs Wochen hat er eine stationäre Alkoholtherapie begonnen, auf Druck seines Arbeitgebers. »Es ist herrlich, mit Mutti alleine zu sein«, sagt Laura. Sie schaut nach unten, auf ihre Arme, die sie vor der Brust verschränkt hat. Eine Haarsträhne hat sie hinter das linke Ohr geklemmt, immer wieder löst sie sich und fällt ihr ins Gesicht. »Wie Urlaub«, sagt Laura. Sie sinkt auf einem Stuhl in sich zusammen, als wolle sie in den Polstern verschwinden. »Ich weiß, dass das ziemlich gemein klingt«, ergänzt sie schnell, »aber er hat so viel in unseren Seelen kaputtgemacht.«
Als Laura auf die Welt kommt, ist ihr Vater 29 Jahre alt. Er ist Lokführer, sein Traumberuf. Seine Ausbildung hat er noch in der DDR absolviert, nach der Wende hat er seinen Arbeitsplatz behalten. Fotos aus dieser Zeit zeigen einen Mann mit einem freundlichen, gewinnenden Lachen. Er sieht gut aus, schlank, dunkelhaarig, vital. Das ist die eine Seite. Die andere zeigt er nicht gerne.
Laura, die jüngste Tochter, ist drei Jahre alt, als ihr Vater beginnt, regelmäßig Alkohol zu trinken. Ein oder zwei Bier am Feierabend, so fängt es an. Er ist müde, fühlt sich vom Schicksal betrogen. Seine ältere Tochter hängt als Mühlstein seit einem Jahrzehnt an seinem Hals, zieht seinen Kopf immer tiefer hinab in einen Morast von Unglück und Unzufriedenheit. Eine Bürde, die er kaum noch tragen kann. Die er nicht mehr tragen will.
Nadine, die Erstgeborene, ist sieben Jahre älter als Laura. Sie ist schwerstbehindert - Spastikerin, blind, geistig behindert und Epileptikerin, sie leidet zudem unter Asthma und Allergien. Ein Pflegefall, rund um die Uhr, Tag für Tag, Jahr für Jahr, sie muss gefüttert, angezogen, getragen werden. Jeder Handgriff kostet Zeit und Mühe. Nadine kann ja nicht mithelfen, sie hängt ihm wie ein Sack in den Armen, wenn er sie die Treppe hinauf in die Wohnung trägt, zuckt, von Krampfanfällen geschüttelt, wenn er sie anziehen oder füttern will. Nachts muss sie alle drei Stunden gewendet werden, sonst liegt sie sich wund. Nadine ist für ihren Vater wie ein schwarzes Loch, das alle Aufmerksamkeit, alle Energie an sich zieht und verschlingt.
Zehn Jahre lang haben er und seine Frau all das selbst erledigt, haben ihren Schichtdienst so abgestimmt, dass immer einer von beiden bei der Tochter ist. Ein Jahrzehnt kreist der Alltag der Familie um das behinderte Kind. Ein Leben voller Entbehrungen, für gemeinsame Kino- oder Restaurantbesuche bleibt keine Zeit, Freunde treffen sie nur noch selten. Wenn sie mit Nadine das Haus verlassen wollen, müssen sie den Notarzt in Bereitschaft versetzen. Jeder Besuch bei Freunden ist ein logistisches Ereignis, so aufwändig, dass sie schon erschöpft eintreffen, zu erledigt, um das Zusammensein noch genießen zu können.
Doch für ihren Vater ist Nadine all die Jahre nicht nur eine Last. Sie wird auch immer mehr zu einem Makel, zu etwas, das er verstecken möchte. Dieser atmende, essende, zuckende Krüppel kann nicht, darf nicht seine Tochter sein. Er schämt sich. Für dieses Kind, und ganz hinten in seinem Kopf auch für sich selbst. Für den Überdruss, die Müdigkeit, er schämt sich für seine Scham. Und versteckt sich hinter trotzigem Selbstmitleid, betäubt sich mit Alkohol. Auch für Laura, das gesunde zweite Kind bleibt nicht viel Zeit, zu sehr sind Vater und Mutter mit der älteren Schwester beschäftigt. Und mit sich selbst.
Als Laura vier Jahre alt ist, wird Nadine in ein Heim für Schwerstbehinderte eingewiesen, sie besucht dort eine Schule und ist nur noch an den Wochenenden zu Hause. Ihre Mutter ist erleichtert, endlich findet sie ein wenig Zeit für sich und ihre jüngere Tochter. Aber gleichzeitig schämt sie sich, als sei es eine Art Verrat an dem behinderten Kind. So oft es geht, holt sie Nadine zu sich nach Hause. Laura lernt früh, sich um ihre große Schwester zu kümmern, versorgt sie schon bald mit der Gewissenhaftigkeit eines Erwachsenen. Ihr Vater entledigt sich mehr und mehr der Verantwortung, flüchtet sich häufiger in den Suff. Irgendwann trinkt er auch an den Wochenenden, neben Bier hin und wieder Wein und Schnaps.
Seine Frau flieht mit der jüngsten Tochter immer wieder aus der Wohnung. Dann gehen sie Eis essen, ins Kino oder in den Zoo. Und einkaufen. Lauras Mutter liebt es einzukaufen. Schon wenn sie einen Laden betritt, an den Regalen entlang schlendert, aus denen Mikrowellenherde funkeln, Blusen und Röcke in weichen Stoffen und leuchtenden Farben nur auf sie zu warten scheinen, schlägt ihr Herz schneller, sie fühlt sich großartig und lebendig. Sie kauft, was ihr gefällt, Kleidung für sich und die Mädchen, Bettwäsche, Elektrogeräte. Keine Juwelen oder Pelze, ihre Träume richten sich nur auf das, was gerade eben außerhalb ihrer Reichweite liegt, solide, bodenständige Wünsche eines Menschen, der sein ganzes Leben hart gearbeitet hat und mit einem kleinen Zipfel des Paradieses zufrieden ist.
Mit jeder gekauften Bluse, jedem Elektrogerät steigt ihre Stimmung. An manchen Tagen nimmt sie ein Taxi, lässt sich vor die Geschäfte chauffieren. Dann fühlt sie sich irgendwie bedeutend. Die Erinnerung an zu Hause verblasst mit jeder Mark auf dem Taxameter, die Erinnerung an den übellaunigen Ehemann zu Hause, an die behinderte Tochter im Heim, an das schlechte Gewissen. Sie erkauft sich ihr kleines Stück vom Glück. Nach dem Einkauf geht sie in ein Café, gibt ein großzügiges Trinkgeld. So muss es sich anfühlen, sorgenfrei zu sein, zu leben.
Allerdings, auch dieses Glück ist flüchtig. Schon auf dem Weg nach Hause verweht ihre Hochstimmung und wenn sie abends an ihrem Esstisch sitzt und die Quittungen addiert, kommt das Unbehagen zurück. Dann fühlt sie sich wie eingemauert in ihrem Leben. Dann beginnt der Neid wieder an ihr zu nagen, Neid auf all die anderen, für die so etwas wie ein harmonisches Familienleben existiert. Dieser Neid frisst seit Jahren an ihr und braucht einen Schuldigen oder doch wenigstens ein Ventil, das sie am nächsten Tag findet, wenn sich die Tür zum Einkaufszentrum wieder hinter ihr schließt.
In der Wohnung stapeln sich Elektrogeräte, Kleider, Möbel. In zwei Jahren gibt sie 80 000 Mark aus. Das Geld stammt aus einer Erbschaft, ihre Mutter hatte es ihr hinterlassen. Eigentlich hatte sie es angelegt, in einen Bausparvertrag, als Vorsorge für schlechte Zeiten. Aber wie viel schlechter konnten die Zeiten noch werden? Also löst sie den Bausparvertrag auf, gibt alles aus. Wenn ihr Mann wissen will, wo das ganze Zeug herkommt, kanzelt sie ihn ab. »Das habe ich von meinem Geld gekauft, das geht dich nichts an!« Sie treiben immer weiter auseinander, jeder auf seiner ganz persönlichen Fluchtroute. Begegnen sich kaum noch, Sex und Intimität sind nur noch Erinnerung. Der andere nicht einmal mehr Partner im Leid, sondern Teil davon.
Irgendwann ist das geerbte Geld aufgebraucht und ihr Konto überzogen. Jetzt beginnt sie, Geld vom Haushaltskonto zu unterschlagen, muss bei den Mahlzeiten sparen. Ihr wird klar, dass sie kaufsüchtig ist, dass sie so nicht mehr weitermachen darf. Ihr Gewissen quält sie. Ihre Familie soll unter ihren kleinen Fluchten nicht leiden müssen. Aber sie kann nicht widerstehen. Auch ihrem Mann fällt schließlich auf, dass ständig Geld fehlt. Ihre wirtschaftliche Existenz ist gefährdet. Diesen Alarm können sie beide nicht überhören. Eine letzte gemeinsame Anstrengung, sie gehen zur Eheberatung, für kurze Zeit normalisiert sich das Familienleben. Er trinkt weniger, sie bekommt mit Hilfe einer Therapeutin ihre Kaufsucht in den Griff.
»Damals habe ich wirklich eine Menge Geld ausgegeben«, sagt Lauras Mutter heute, ihre Augen strahlen und sie lächelt ein wenig wehmütig, wie jemand, der von seinem letzten, lang vergangenen Urlaub erzählt, »aber ich habe es nie bereut. Ich bin nicht traurig, dass das ganze Geld weg ist. Ich habe mich einfach super gefühlt, wenn ich einkaufen war. Das war es mir wert. Ich habe doch niemandem wehgetan damit! Das Wichtigste ist, dass es mir gelungen ist aufzuhören, bevor ich die Familie in Schulden gestürzt habe.« Einkaufen, sagt sie, gehe sie heute noch gerne. Aber sie habe gelernt, sich zu mäßigen.
Ihrem Mann gelingt es nicht, sich zu mäßigen, nicht dauerhaft. Als Laura elf Jahre alt ist, sieht sie ihren Vater fast nur noch betrunken. Mittlerweile säuft er schon tagsüber. Laura kann sich kaum noch an die Zeit erinnern, in der ihr Vater sich mit ihr beschäftigt hat, mir ihr auf dem Spielplatz war oder im Zoo, in der er ihr seine Platten vorgespielt hat. Sie hat seine Musik geliebt damals, vor allem Michael Jackson. Vielleicht war es aber auch gar nicht die Musik, die Laura so faszinierte, vielleicht war es die Begeisterung, mit der ihr Vater die Platten hörte und von den Konzerten erzählte, die er besucht hatte. Diesen Vater vermisst sie.
Sie ist zwölf, als sie beginnt, sich für ihren Vater zu schämen. Als sie nach der Schule einen Klassenkameraden mit nach Hause bringt, liegt ihr Vater in Unterwäsche auf der Couch, Schuhe, Jacke, Hose und Pullover auf dem Fußboden verteilt. Sein Gesicht ist gerötet, es gelingt ihm kaum, seine Augen offen zu halten. »Ich ruhe mich nur aus«, sagt er, mühsam seine Stimme kontrollierend, als er die beiden Teenager im Flur bemerkt. Der Junge glotzt den Mann auf der Couch verständnislos an. Laura zieht ihn am Arm, raus aus dem Flur in ihr Zimmer und schließt die Tür.
»Was war denn mit deinem Vater los?« fragt der Junge am nächsten Tag in der Schule. »Der sah aber komisch aus.« Laura zuckt mit den Achseln. »Der war kaputt von der Arbeit und ist auf der Couch eingeschlafen.«
Seit diesem Nachmittag nimmt Laura niemanden mehr mit nach Hause. In der Schule ist sie immer verschlossener. Sicher, es gibt ein paar Mädchen, mit denen sie sich gut versteht. Aber auch die ahnen nichts davon, wie es in ihr aussieht. Von ihrer behinderten Schwester hat sie nur einem einzigen Mädchen erzählt, ihrer ältesten Freundin. Und ihr das Versprechen abgenommen, es den anderen nicht zu sagen. Aber wichtiger noch als das Versprechen ist für Laura die Tatsache, dass auch ihre Freundin etwas zu verbergen hat, einen Makel, den sie Laura anvertraut hat: Ihr Vater hat vor einigen Jahren versucht, sich umzubringen. Heute ist er Frührentner, »nicht ganz auf der Höhe«, wie seine Tochter sagt.
Die in der Schule sollen nichts wissen von Nadine. Laura schämt sich für ihre Schwester. Auch wenn sie Nadine zu Hause liebevoll umsorgt, von ihr erzählen oder sie gar im Rollstuhl durch die Straßen zu schieben, in aller Öffentlichkeit, kommt nicht in Frage. Laura fürchtet, dass die in der Schule oder in der Nachbarschaft blöde Sprüche machen und über den »Krüppel« lästern würden. Dass sie sich dann streiten, ihre Schwester verteidigen müsste. Und sich selbst, weil die anderen bestimmt auch über sie, die Schwester des Krüppels, lästern würden. Also verbirgt sie ihre große Schwester.
Vor allem aber verbirgt sie das mit ihrem Vater. Etwas, das noch keinen richtigen Namen hat. »Alkoholiker«, den Begriff kennt sie. Dass es sich dabei um eine Krankheit handelt, wird sie noch lernen. Aber noch ist der Begriff so abstrakt, so klinisch und hat wenig zu tun mit dem betrunkenen Mann auf der Couch, der mal ihr Vater war. Von dem Mann auf der Couch erzählt Laura niemandem. Nicht einmal ihrer ältesten Freundin, nicht einmal, als sie von deren Familiendrama erfährt. »Wenn ihr wüsstet, was bei mir zu Hause los ist«, denkt sie nur und schweigt. Sie ist vorsichtig, misstrauisch. Fürchtet sich vor der Entdeckung und dem darauf folgenden Urteil.
Laura hat eine Menge zu verbergen. Oft fragt sie sich, was die anderen wohl von ihr dächten, wenn sie alles offenbarte. Sicher nichts Gutes, denn besonders gut denkt Laura auch von sich selbst nicht. Wenn sie in den Spiegel sieht, starrt sie wie hypnotisiert auf das, was sie für ihre Schwächen hält, seziert sich wie mit einem Skalpell. Bei all den anderen Mädchen, in der Schule oder in den Zeitungen, starrt sie immer nur neidisch auf das, was sie ihr voraus haben. Sie hat so viel zu verbergen.
Lauras Leben gleicht immer mehr einer Flucht. Zu Hause verbarrikadiert sie sich in ihrem Zimmer, verkriecht sich in die Bücher. Wenn es das Wetter zulässt, verbringt sie die schulfreien Nachmittagsstunden auf einem Wiesengelände, einige hundert Meter hinter ihrem Haus. Dort hat die Stadt einen Tierhort für Kinder angelegt. Laura hat ihre Meerschweinchen da untergebracht, jede freie Minute spielt sie mit den Tieren. Mittlerweile ist Laura vierzehn, die anderen Kinder sind deutlich jünger. Die Gleichaltrigen verbringen die Zeit lieber im Jugendclub, hören Musik, trinken und kiffen, anstatt auf dem Feld durch Matsch zu waten oder zu frieren. Laura hat das Jugendzentrum noch nie betreten. Die anderen Jungs und Mädchen dort, die Lässigkeit, die sie zur Schau tragen, ihre abschätzigen Blicke schüchtern Laura ein.
Am Abend des 17. August 2003 sitzt Laura an ihrem Schreibtisch, über ihr Tagebuch gebeugt. An der Wand hängt ein Poster von Britney Spears, in den Regalen stehen Bücher und Manga-Comics, auf dem Kleiderschrank ein Globus. Die Bäume vor ihrem Fenster verstellen den Blick auf die Hochhäuser gegenüber. »Was ich dir noch nicht geschrieben habe ist, dass ich essgestört bin. Schon seit Sommer vorigen Jahres esse ich nicht mehr >ordentlich<. Und es wird immer weniger, aber das stört mich nicht, denn ich fühle mich wohl.«
Es beginnt im Juni 2002. Laura ist dreizehn. In der Schule gehört das verschlossene, stille Mädchen nicht zu den Beliebtesten. Aber die anderen respektieren sie oder lassen sie zumindest in Ruhe. Doch in diesem Jahr verändert sich etwas. Zwei Mädchen aus der Parallelklasse, Zwillinge, suchen einen Prellbock für ihre Launen. Ein Mädchen, an dem sie ihre Macht erproben können. Sie finden Laura. Plötzlich steht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In den Pausen machen sich die Zwillinge lustig über Laura, über ihre Zurückhaltung, die jetzt Schwerfälligkeit ist, ihre Verschlossenheit, die plötzlich wie Dummheit aussieht, und vor allem über ihre Figur. Die anderen Mädchen und Jungs hören zu, lachen manchmal. All die kleinen vermeintlichen Fehler und Schwächen, die Laura zu verbergen suchte, werden plötzlich an die Öffentlichkeit gezerrt. Vor allem ihr Körper - Laura ist groß für ihr Alter, 1,67 Meter, sie wiegt ungefähr sechzig Kilo, ein ganz normales Gewicht. Sicher, sie ist ein eher kräftiges Mädchen, ihr Busen ist schon deutlich zu sehen. Mit einem Mal gilt sie als fett. Sie ist eine gute Sportlerin, schwimmt gern und besucht mit einer Freundin einmal pro Woche einen Gymnastikkurs. Ein Handstand macht ihr keine Probleme. Aber all das zählt nicht mehr, nicht wirklich. Sie ist jetzt die Dicke. Die Zwillinge sind klein und zierlich, und auch sonst alles, was Laura nicht ist - auffällig, schlagfertig, quirlig, beliebt bei den Mitschülern. Mit jedem gehässigen Wort, jedem abschätzigen Blick fühlt Laura sich klobiger, fetter, einsamer. Sie holt sich Rat bei ihrer Mutter, gemeinsam reden sie mit dem Vertrauenslehrer. Nichts ändert sich. Und wenn Laura nach der Schule in ihr Zimmer kommt, hängt da ein Poster von Britney Spears an der Wand, dünn und erfolgreich, ihren flachen nackten Bauch zeigt sie wie eine Auszeichnung. Ihr Lächeln scheint Laura eine Mischung aus Vorwurf und Ansporn. Sie wird sich selbst unerträglich, fühlt sich gefangen in ihrem Körper.
Laura isst immer weniger. Das Frühstück lässt sie bald komplett ausfallen. In der Schule gönnt sie sich allenfalls einen Apfel oder einen Joghurt. Sitzt sie mit ihrer Mutter beim Abendessen, dann behauptet sie, in der Schule gegessen zu haben und knabbert lustlos an einer trockenen Scheibe Knäckebrot oder stochert in ihrem Gemüse. Bald muss sie sich nicht mehr zwingen, zu hungern. Mit der Zeit nimmt ihr Appetit einfach ab. Nach einem Apfel, nach einer Scheibe Brot ist sie satt. Sie nimmt ab, sieben Kilo sind es irgendwann, aber sie fühlt sich immer noch zu dick. Sie muss zu dick sein, keiner bewundert sie, sagt ihr, dass sie toll aussieht. Seit eine der Zwillingsschwestern die Schule verlassen musste, sagt ihr auch niemand mehr, sie sei fett. Aber das muss ihr auch niemand mehr sagen. Das weiß sie selbst.
»Mensch, bist du dürr!« sagt dagegen eine Klassenkameradin beim Schulschwimmen, als sie Laura in ihrem Badeanzug sieht. » Die hat doch einen an der Klatsche!« denkt Laura. Sie wiegt jetzt 53 Kilo, bis auf 45 Kilo will sie noch abnehmen. Dann wird alles besser, denkt sie.
Ihre Eltern sorgen sich. »Ich höre auf zu trinken, wenn du wieder normal isst«, beschwört sie ihr Vater ein ums andere Mal, betrunken und unter Tränen. Laura glaubt ihm nicht, er wird nicht aufhören, das schafft er gar nicht. Die vergangenen Jahre haben das bewiesen. Mittlerweile hat er seinen Führerschein verloren, wegen Trunkenheit am Steuer, und eine Lokomotive steuern darf er auch nicht mehr, sein Chef hat ihn in den Innendienst versetzt. Seine alkoholisierte Anteilnahme empfindet Laura als Vorwurf, seine Tränen als verlogen. Möglich, dass er wieder nur sich selbst bedauert - noch eine Tochter, die nicht seinen Vorstellungen entspricht.
Im August 2003 schickt die Mutter Laura zu einer Ärztin, einer Spezialistin für Essstörungen bei Jugendlichen. Die will wissen, welche Probleme Laura hat, sagt, wenn ihr Gewicht unter fünfzig Kilo fällt, wird sie in ein Krankenhaus eingewiesen und zwangsernährt. Die Ärztin erklärt ihr, drastisch und in allen Einzelheiten, wie ihr Körper, ihre Gesundheit unter dem Nahrungsmangel leiden, auch wenn sie davon noch nicht viel spürt. Zu Hause kontrolliert die Mutter Lauras Mahlzeiten, versucht, sie zum Essen zu überreden. Aber Laura will nicht über ihre Probleme reden, sie will gar nicht wissen, was sie ihrem Körper zumutet, was es bedeutet, dass ihre Regel in den letzten Monaten oft ausbleibt. Sie will nicht wissen, ob der Suff ihres Vaters etwas mit ihrem Essverhalten zu tun hat. Sie will nicht in ein Krankenhaus, sie will nicht zwangsernährt, kontrolliert und gemästet werden. Sie will doch nur abnehmen, schlank werden, sich wohl fühlen. Warum lassen die anderen sie nicht in Ruhe?
Aber mit der Ruhe ist es vorbei, nicht nur zu Hause am Esstisch, auch in Lauras Kopf. Jetzt geistern dort Schreckgespenster mit Namen wie »Magersucht«, »Nierenversagen«, »Unfruchtbarkeit«, »Zwangsernährung« und »Depression« umher, rauben ihr den Schlaf. Wenig Essen und Abnehmen ist plötzlich nicht mehr etwas, das sie einfach tut, es beherrscht jetzt ihr Denken, wird gleichermaßen zu ihrem Lebensinhalt und ihrer Geißel. Sie will, sie muss, abnehmen, egal was die Gespenster, die diese Ärztin gerufen hat, ihr zuflüstern. Von all dem erzählt sie nur ihrem Tagebuch. »Wer das lesen würde, dächte bestimmt, ich sei bekloppt«, heißt es da.
Essen, erkennt Laura, ist widerlich. Als ihre Mutter sie von der Schule abholt und in ein Eiscafe einlädt, wie sie es oft tut, wenn der Vater wieder besoffen auf der Couch liegt, trinkt sie zwei große Gläser Kirschsaft, ihrer Mutter zu Gefallen. An-schließend fühlt sie sich eklig, voll und angeschwollen. Der Saft, dickflüssig, beinahe wie Essen, ist etwas Fremdes, das nicht in ihren Körper gehört. »Wenn ich weiter zum Essen gezwungen werde, fange ich an zu kotzen«, denkt sie.
Am Abend des 31. August 2003 sitzt Laura mit ihrer Mutter am Esstisch. Ein lichtdurchfluteter Sommerabend, ihr Vater ist einkaufen, ein Moment der Ruhe und des Friedens. Laura sehnt die Momente herbei, in denen ihr Vater das Haus verlässt. Eine Auszeit, die Anspannung lässt nach, ganz verschwindet sie nie. IhrVater wird oft ausfallend, wenn er betrunken nach Hause kommt, beschimpft dann Tochter und Ehefrau. In den vergangenen Monaten wurde er sogar hin und wieder von Polizisten zur Haustür eskortiert. Betrunken am Steuer, er hat Unfälle verursacht. Manchmal auch mit dem Fahrrad. Mehrmals endeten diese Unfälle für Lauras Vater sogar wegen Alkoholvergiftung auf der Intensivstation.
Doch Laura denkt in diesem Moment nicht an ihn. Denn da ist dieser Hunger, der immer drängender wird. Den Nachmittag hat sie auf dem Tierhort verbracht, Meerschweinchen und Pferde gefüttert und Ställe ausgemistet. Gegessen hatte sie zu Mittag zwei kleine Kartoffeln und ein wenig Rosenkohl. Mittlerweile fällt es ihr immer schwerer, auf Essen zu verzichten, sie hungert, quält sich durch die Tage. Aber sie hält sich zurück, auch an diesem Abend, knabbert wie üblich nur etwas Gemüse. Ihre Mutter isst Toast. Eine Scheibe bleibt auf ihrem Teller, sie ist satt. Wie ferngesteuert greift Laura nach der Toastscheibe. »Die ist zu schade zum Wegwerfen«, sagt sie sich. In ihrem Kopf warnt eine andere Stimme »Die darfst du nicht essen!« Aber es ist doch nur eine Scheibe trockener Toast, das geht schon, beruhigt sie sich. Dann toastet sie die zweite Scheibe, legt etwas Käse oben auf. Auf die dritte ebenfalls. Mit jedem Bissen wird ihr Heißhunger mächtiger. Als nächstes isst sie karamellisierte Sonnenblumenkerne, eine halbe Tüte, dann Salzstangen, Waffelröllchen, Cornflakes. In ihr ist ein riesiges Loch, das gestopft werden will. Ihr erster Fressanfall. Am Ende fühlt sie sich hundeelend, möchte am liebsten alles auskotzen, mit dem ekligen Essen auch die ekligen Gefühle aus ihrem Körper zwingen. Sie geht in das Badezimmer, beugt den Kopf über die Kloschüssel und steckt sich den Finger in den Hals. Es funktioniert nicht. Nicht mal das bekommt sie hin.
In den kommenden Monaten isst sie zwanghaft immer mehr, im Kochunterricht in der Schule sogar noch den Kuchenteig aus der Schüssel. Anschließend ekelt sie sich vor sich selbst, versucht sich zusammenzureißen, verordnet sich die gewohnte Diät. Immer seltener hält sie durch, auf karge Mahlzeiten folgen Berge von Schokolade, Keksen und Chips. Die Fressanfälle häufen sich, in ihrem Tagebuch listet sie wie besessen auf, was sie isst, als wolle sie sich selbst quälen. Immer wieder steckt sie sich den Finger in den Hals, ohne Erfolg. Nicht nur, dass sie nicht durchgehalten hat, dass sie dem Heißhunger nichts entgegensetzen kann. Wenn sie im Fernsehen oder in Zeitschriften Bilder von magersüchtigen Mädchen sieht, runter gehungert bis auf die Knochen, fühlt sie sich doppelt als Versager - so dünn wie die ist sie nie geworden, nicht einmal das ist ihr gelungen. Und jetzt stopft sie wieder Schokolade in sich hinein, wird dicker als sie zuvor war.
Der Weg von der Realschule nach Hause dauert mit dem Fahrrad eine gute Viertelstunde. Mit jeder Minute wächst ihre Angst. Was erwartet mich zu Hause? Sie öffnet die Tür, leise, vorsichtig, späht in den Flur. Schuhe und Jacke ihres Vaters liegen auf dem Fußboden, ein erstes Warnsignal. Ein schneller Blick in die Küche. Schmutziges Geschirr und Essensreste überall. Ihr Vater hat, wie so oft, im Suff gekocht und das Essen aus dem Topf geschlungen. »Wie ein Schwein«, denkt sie. Die Küche ein Saustall, er ein besoffenes Schwein. Sie schleicht in das Wohnzimmer. Da liegt er. Besudelt mit Essen, der Mund offen, Speichelfäden in den Mundwinkeln. Auf der Couchgarnitur aus braunem Leder, an der Wand über ihm das Landschaftsbild, die friedliche Szenerie will so gar nicht in dieses Wohnzimmer passen. Sie verkriecht sich in ihrem Zimmer, ihrer letzten Zuflucht, der Tierhort ist seit dem Winter geschlossen, weil immer weniger Kinder kamen. Sie spielt mit ihren Meerschweinchen, die sie jetzt in einem Käfig in ihrem Zimmer hält. Musik spielt sie nur ganz leise, sie fürchtet, dass der ater aufwacht. Dann bietet auch ihr Zimmer keine sichere Zuflucht mehr. Irgendwann wird ihr Vater wach, wankt ohne anzuklopfen in ihr Zimmer. Streichelt eines ihrer Meerschweinchen, Fernando, das braun-weiß gescheckte Männchen, das sie mehr liebt als irgendetwas anderes auf der Welt. Sie möchte ihm das Tier entreißen. Für seine Tochter keine Zärtlichkeit. Stattdessen abschätzige Blicke. Worte wie Ohrfeigen. »Willste nich ma abnehmen?« lallt er. »Was soll denn so aus dir werden? Bald kannste Zelte tragen.« Will er nett sein, nennt er sie »Speckmäuschen«. Zärtlich klingt auch das nicht. Warum lässt er sie nicht einfach in Ruhe?
»Man hat versucht, sich zu wehren, aber das bringt ja doch nichts«, sagt Laura. »Wenn man ihn auf sein Trinken angesprochen hat, hat er alles nur ins Lächerliche gezogen.« So redet sie meist, wenn sie von sich selbst spricht - sagt man statt ich. Vielleicht schmerzt es sie dann weniger, von diesem Mädchen und ihrem Leben zu erzählen. Ein letzter Akt des Versteckens. »Das Schlimmste ist die Angst, wenn man nach Hause kommt und sich jedesmal in Gedanken fragt, was wohl heute wieder los ist.« Sie wünscht sich, es könne immer so bleiben wie jetzt - nur sie und ihre Mutter, ihr Vater in der Therapie, der Alkohol nur eine Gewitterwolke am Horizont. Und irgendwo, gut verborgen, die stille Hoffnung, nach der Therapie könnte vielleicht doch noch alles gut werden. Aber ihre Mutter denkt schon an Trennung. Noch einen Rückfall ihres Mannes will sie nicht mitmachen. Schon vor Monaten haben sie sich eine Wohnung angesehen. Aber sie sind geblieben. Hoffnung, Mitleid, Angst vor der Veränderung, sie kann es nicht genau sagen. Vielleicht ein wenig von allem.
Auf dem Nachhauseweg nach der Schule denkt Laura häufig an den Tod. Wünscht sich, nichts mehr zu spüren. Keine Scham, keine Angst, keinen Neid, kein Unglück. Stellt sich vor, einen großen Schritt auf die Straße zu machen und sich unter einen Wagen zu werfen. Dann wäre alles vorbei. Aber dazu fehlt ihr der Mut. Und auch dafür hasst sie sich: »Vielleicht sind ja Drogen eine Lösung.«
Seit sie im vergangenen Jahr »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« gelesen hat, verschlingt sie alle Bücher, die von Drogenschicksalen erzählen. In ihrer Vorstellung hat sie sich schon etliche Male eine Nadel in den Arm gestochen, Heroin in die Venen gejagt. Nichts mehr mitbekommen, das Gehirn vernebeln. Eine wohlige Einsamkeit, eine, die nicht weh tut. Die Flucht in eine andere Welt, eine, die nur besser sein kann. Aber zu dieser Welt fehlt ihr der Zugang. Sicher, einige Jungs und Mädchen an ihrer Schule kiffen. Aber diese Kiffer sind eine verschworene Gruppe. Durch ihre Klasse läuft eine unsichtbare Grenze. Für jemanden wie Laura, die nicht einmal Zigaretten raucht, ist sie unüberwindlich. Und ein wenig fürchtet sie sich auch vor den Drogen. Noch schützen sie diese Grenze und die Angst.
Seit einigen Monaten besucht sie eine Therapeutin. Die rät ihr zu einer stationären Therapie. Laura sträubt sich. Ihre Meerschweinchen und ihre Mutter will sie nicht im Stich lassen. Und in diesem Sommer steht ihr Schulabschluss an, den muss sie mit einem Durchschnitt von 2,5 bestehen, damit sie ein Wirtschaftsgymnasium besuchen und irgendwann Tierarzthelferin werden kann. Bisher sieht es noch gut aus, auch wenn im vergangenen Jahr ihre Noten ein wenig schlechter geworden sind.
An einem Nachmittag im November sieht Laura auf dem Heimweg von der Praxis der Therapeutin ihren Vater, zwanzig, dreißig Meter vor ihr auf der Straße. Er torkelt, sucht Halt an Häuserwänden und Laternenpfählen. Laura weiß, dass er mit dem Fahrrad unterwegs war. Das Rad sieht sie nirgends. Tage später wird sie erfahren, dass er gegen ein parkendes Auto gefahren und aus Angst vor der Polizei zu Fuß geflüchtet ist. Laura verbirgt sich in einem Hauseingang, hofft, dass niemand auf der Straße diese merkwürdige Choreografie bemerkt, der Mann, der nach Halt sucht, das Mädchen, das Schutz sucht.
Lauras Vater hat im September seine Therapie beendet. Das Saufen hat er nicht aufgegeben. Schon an seinem ersten Abend zu Hause lässt er sich völlig zulaufen. Als Laura gegen 23 Uhr aus dem Fenster sieht, steht ihr Vater unten auf der Straße, an die Hausmauer gelehnt. Sein Oberkörper pendelt vor und zurück. Laura ist unruhig an diesem Abend, kann nicht schlafen. Seit ihr Vater sich vor einigen Stunden mit den Worten »ich gehe noch mal um den Block« verabschiedet hat, noch nüchtern, ist sie bei jedem Geräusch aufgeschreckt und hat aus dem Fenster gesehen. Jetzt drückt sie den Türsummer, hofft, das Geräusch dringt vor bis in den umnebelten Verstand ihres Vaters. Macht ihm klar, dass es nur einer Bewegung bedarf, die Tür zu öffnen. Wenige Schritte, den Hausflur zu betreten, in den Aufzug zu steigen. Nichts geschieht. Er steht nur da, die Haustür öffnet und schließt sich, Nachbarn gehen an ihm vor über. Laura ringt ihre Tränen nieder. Enttäuschung und Wut schnüren ihr die Kehle zu. Wie gerne würde sie ihn da stehen lassen, dieses Häufchen Elend, unten in der Kälte! Aber er ist ihr Vater, sie würde keinen Schlaf finden. Runter auf die Straße, ihm helfen und möglicherweise erkannt werden, will sie aber auch nicht. Schlimm genug, dass Nachbarn ihn in diesem Zustand gesehen haben.
Nach einer Stunde geht sie gemeinsam mit ihrer Mutter doch hinunter. Ihr Vater steht noch an der gleichen Stelle, der Kopf fällt ihm auf die Brust, seine Augen völlig verdreht. Lauras Mutter redet auf ihren Mann ein, er soll ihr in die Wohnung folgen. Er brabbelt Unverständliches. Sie bittet ihre Tochter, die Fenster zu beobachten, ob jemand zusieht. Schließlich hält Laura ihrem Vater die Hand hin, er greift zu, hält sich fest, müht sich an der Hand seiner Tochter die Eingangstreppe hinauf, seine freie Hand tastet fahrig nach den Wänden, dem Treppengeländer, ständig kurz davor, zu fallen. »Wie ein Kleinkind, das seine ersten Gehversuche macht«, denkt Laura. Sie hat panische Angst davor, dass er hinfällt. »Das ist nicht mein Vater.«
Im Februar 2005 treffe ich Laura in einem Café in der Dresdener Innenstadt. Ihrem Vater wurde vor einigen Wochen gekündigt, er hatte sich zuletzt schon während der Arbeit betrunken. Jetzt liegt er den größten Teil des Tages zu Hause auf der Couch oder im Bett, eine Flasche Bier in Griffweite. Beinahe jeden Abend verlässt er die Wohnung und geht auf Sauftour. Laura sitzt dann zu Hause vor dem Fernseher und stopft Schokolade, Chips und Gummibärchen in sich hinein. »Ich esse immer noch viel zu viel«, sagt sie. »Das ist wie bei Papi mit dem Trinken - man kann nicht ohne.« Nur ganz selten nennt sie ihren Vater noch Papi. Die eigene Esssucht scheint ihr den rauschverlorenen Vater auf seltsame Weise auch näher zu bringen. »Man isst, obwohl man satt ist. Immer weiter. Spass macht das nicht.« Wenn sie versucht, sich zusammenzureißen, denkt, »du darfst das nicht essen«, wird es nur schlimmer.
In dem Café zögert sie, ihren Mantel auszuziehen. Als sie es schließlich doch tut, hängt sie ihn nicht an die Garderobe, sondern bindet ihn um ihre Hüften. So viel Verstecken muss sein. Wieviel sie in den vergangenen Monaten zugenommen hat, verschweigt sie. »Zu viel«, sagt sie nur. Schwimmen geht sie nicht mehr. Ihren Lieblingssport hat sie aufgegeben, zu sehr schämt sie sich ihres Körpers. In der Öffentlichkeit nur einen Badeanzug zu tragen, kommt nicht in Frage. »Aber im Moment ödet mich eh alles an«, sagt sie. »Sogar lesen.«
Laura verbringt viel Zeit vor ihrem Laptop. In einem Chat-Forum hat sie einen jungen Mann kennen gelernt, sie haben sich Bilder geschickt. In einigen Monaten wollen sie sich sogar treffen. »Mal sehen«, sagt Laura. Sie bleibt misstrauisch, wagt kaum, auf etwas Gutes zu hoffen. Bei eBay hat Laura in den vergangenen Monaten mehr als hundert Euro ausgegeben, für Poster, Kalender und CDs von Michael Jackson. Wenn sie seine Musik hört, fühlt sie sich besser. Verstanden und getröstet. Obwohl der Popstar, gegen den ein Verfahren wegen Kindesmissbrauchs läuft, im Moment selbst Trost gut gebrauchen kann. »Die meisten sehen in ihm nur einen durchgeknallten Endvierziger, der Kinder missbraucht«, sagt sie. »Ich glaube nicht, dass er zu so etwas fähig ist. Die Leute machen sich nicht die Mühe, nachzuvollziehen, wie er denkt und fühlt. Menschen wie er haben in der Kindheit schlimme Erlebnisse gehabt und suchen nur nach verlorener Liebe und Zuneigung.« Dann ergänzt sie: »Ich denke, das betrifft auch meinen Vater. Aber er erzählt mir ja nie was.«
In den vergangenen Monaten hat sie gemeinsam mit ihrer Mutter eine Wohnung gesucht. Gemietet haben sie noch keine. »Es ist schwierig, etwas Passendes zu finden«, sagt Laura. »Wir hätten gerne eine Altbauwohnung. Aber wegen meiner Schwester kommt ja nur eine Wohnung mit Aufzug in Frage, und das gibt es in alten Häusern selten.« Erdgeschoss oder Hochparterre gingen auch, sagt sie. »Aber da würde ich mich beobachtet fühlen, wenn jeder in die Fenster sehen kann.« Laura muss sich verstecken, mehr denn je. Außerdem fürchtet sie einen Auszug, trotz allem. »Wenn wir weg sind, kommt mein Vater bestimmt total unter die Räder«, sagt sie. Obwohl sie weiß, dass weder sie noch ihre Mutter ihrem Vater helfen können, hat sie Angst davor, ihn zu verlassen. Angst davor, dass ihre Unsicherheit ins Gigantische anwachsen würde.
So sehr sie es hasst, ihn betrunken zu sehen, schlimmer wäre es, wenn er ihrer stillen Sorge und hilflosen Aufsicht völlig entglitte.
Ihre Therapeutin drängt sie immer stärker zu einer stationären Therapie. Aber Laura will nicht in der Schule fehlen. Die Vorstellung, ein Jahr wiederholen zu müssen, ist ihr unerträglich. Bis zum Ende des Schuljahres, denkt Laura, wird sie schon noch durchhalten. Obwohl auch ihre schulischen Leistungen immer schlechter werden. Im Unterricht meldet sie sich nie, und wenn sie gefragt wird, schweigt sie. Auch wenn sie die Antwort weiß. Aus Angst, sie könne etwas Falsches sagen. Wenn die richtige Antwort eines Mitschülers sie im Stillen bestätigt, genügt ihr das. Lauras Lehrer haben sich daran gewöhnt. Dass es Laura trotz allem gelingt, einen Schnitt von 2,5 zu halten, ist erstaunlich. Ein unglaublicher Kraftakt, seit Jahren schon. Einer, auf den dieses kluge, einfühlsame Mädchen stolz sein könnte. Eigentlich. Vielleicht gelingt ihr das auch irgendwann. In den Sommerferien, möglicherweise. »Vielleicht suche ich mir dann eine Tagesklinik«, sagt Laura. »In den Ferien zu Hause sein ist eh scheiße.« In dieser Klinik würde sie die Tage verbringen, nur am Abend zum Übernachten nach Hause zurückkehren. Und am Ende der Ferien hätte sie die Möglichkeit, neben dem Therapieprogramm auch das Wirtschaftsgymnasium zu absolvieren. Vielleicht wird dann alles anders. Vielleicht gelingt es ihr in dieser Klinik tatsächlich, abzunehmen, neue Freunde zu finden. Dann kann sie in der neuen Schule von vorne anfangen. Muss sich nicht mehr verstecken. Aber Laura ist vorsichtig. Hoffnung, hat sie gelernt, ist gefährlich. Wer seine Hoffnung in Worte kleidet, entblößt sich. Wird angreifbar. Wer hofft, wird enttäuscht.