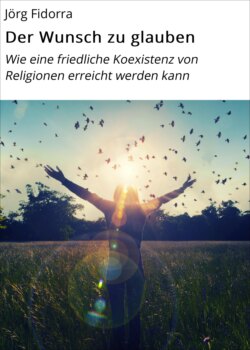Читать книгу Der Wunsch zu glauben - Jörg Fidorra - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Spirituelle Vorstellungen
ОглавлениеDie Menschwerdung beginnt nach allgemeinem Verständnis mit der Entwicklung der Sprachfähigkeit. Bereits die „Vorläuferversionen“ des Menschen bargen das Potential zur Sprachfähigkeit. Sie bildet das herausragende Merkmal eines Menschen, das ihn von allen anderen Lebewesen auf unserer Erde unterscheidet. Die Entwicklung eines Sprachvermögens scheint bisher nur der menschlichen Spezies vorbehalten geblieben zu sein und stellt damit eine Besonderheit in der gesamten belebten Natur dar.
Da nach der Darwinschen Lehre alles in der belebten Welt aus Vorformen hervorgegangen ist, erhebt sich die Frage, ob es auch für die Sprache eine Vorform gibt oder gegeben hat. Ein Blick in die Tierwelt zeigt in der Tat eine Reihe von Beispielen, die eine Vorform des Sprachvermögens darzustellen scheinen. Bekannt sind die wunderschönen Melodien, die einige Vogelarten beherrschen. Warn- und Weckrufe vieler Vögel dienen einer einfachen Kommunikation, um nur einige Beispiele zu nennen. Papageien können Klanggebilde sehr gut nachahmen, und ihre situationsbezogenen Wortgruppen sorgen regelmäßig für Heiterkeit. Eine Vogelart, die die Bezeichnung Leierschwanz trägt, ist im Nachahmen von Geräuschen so perfekt, dass sie sogar das Geräusch einer Kettensäge imitieren kann. Aber es sind nicht nur Vögel, die akustisch Informationen austauschen. Auch Säugetiere, zu denen schließlich auch der Mensch gehört, verfügen über die Fähigkeit, sich mit gesangsähnlichen Lauten über große Entfernungen zu verständigen. Markante Beispiele für eine akustische Verständigung unter Säugetieren sind bekanntlich die Delphine und Wale. Akustische Signale spielen zudem bei vielen Tieren eine wichtige Rolle bei der Partnerwahl und bei der Aufzucht von Jungtieren.
Angesichts dieser Tatsachen stellt sich die Frage, ob nicht diese Fähigkeiten einer Klangerzeugung die Vorform eines Sprachvermögens darstellen. Damit würden die Sprachanfänge auf eine gesangsähnliche Ausdrucksform zurückgehen. Schließlich ist der Gesang ein elementares Kommunikationsmittel, das über alle Sprachbarrieren hinweg Verständigung ermöglicht, Emotionen weckt und zum Mitsingen anregen kann.
Nach Johansson soll sich die Sprache des Menschen vor etwa zwei Millionen Jahren entwickelt haben [20]. Dabei bleibt unbestimmt, ob bereits das Aussprechen sinnbehafteter Einzelworte als Sprache zu bezeichnen ist. Für die Existenz als Jäger und Sammler ist eine ausgeprägte Sprache nicht unbedingt erforderlich, wie die Beispiele aus der übrigen Tierwelt belegen. In Rudeln jagende Löwen oder Wölfe beispielsweise verständigen sich auch ohne irgendwelche Lautsignale. In der Brutpflege von Jungtieren dagegen spielen Lautsignale sehr wohl eine wichtige Rolle, ohne die ein Kontakt mit dem Muttertier nicht gewährleistet ist.
Die anatomischen Voraussetzungen zur Ausbildung eines Organs, das Sprache hervorbringen kann, sind zweifellos in der Erbsubstanz codiert. Gleichzeitig muss dort aber auch die genetische Information gespeichert sein, die dazu befähigt, eine systematische Anordnung von Worten und Sätzen zu konstruieren. Fehlt eine neurologische Weiterentwicklung in diesem Zusammenhang, wie es etwa bei Papageien der Fall zu sein scheint, so bleibt nur die Fähigkeit zur Imitation von Klängen und Geräuschen bestehen.
Wenn Sprachfähigkeit und Bewusstsein einander bedingen, so müsste die Ausprägung eines Bewusstseins ebenfalls von der Erbsubstanz her bestimmt sein. Die Ausprägung eines Sprechapparates und die Entwicklung einer zugehörigen Gehirnarchitektur, die im Stande ist, Laut- und Wortgebilde zu koordinieren, müssen daher in der Erbsubstanz festgelegt sein. Somit ist davon auszugehen, dass mit der Ausbildung eines Sprachzentrums im Gehirn nach heutigem Kenntnisstand auch eine Entwicklung des Bewusstseins, wenn nicht eingesetzt, so doch gefördert wurde. Allerdings scheint es Einschränkungen zu geben. Studien an höher entwickelten Tieren, wie etwa Raben, Menschenaffen und Delphinen, dokumentieren, dass auch bei diesen der Ansatz eines Bewusstseins vorzuliegen scheint, ohne dass gleichzeitig eine Sprachentwicklung stattgefunden hat [2]. Demnach wäre die Ausbildung eines Bewusstseins nicht zwingend mit einer gleichzeitigen Sprachentwicklung verknüpft, wie ursprünglich angenommen wurde [15]. Das Bewusstsein scheint umgekehrt eher die weitere Ausprägung der Sprachfähigkeit zu begünstigen, sobald die anatomischen Voraussetzungen für die Ausbildung eines Sprechapparats geschaffen sind.
Ab dem Zeitpunkt, ab dem sich Sprachvermögen und Bewusstsein ausgebildet hatten, dürfte sich die Ausdrucksfähigkeit aufgrund von Lernprozessen, die sich bei der Ausübung handwerklicher Tätigkeiten ergeben, ständig verbessert haben. Zu den ersten wichtigsten handwerklichen Tätigkeiten gehören sicherlich die Herstellung von Werkzeugen und das Beherrschen des Feuers.
Während in der frühesten Phase der Menschheitsentwicklung der Sprachgebrauch und die Kommunikation aufgrund der gesamten Lebensumstände sich auf das Allernotwendigste begrenzt haben werden, dürfte sich mit dem Gebrauch des Feuers die Situation geändert haben. Nicht nur, dass sich die Nahrungszubereitung erweiterte, auch die Abende konnten vielfältiger genutzt werden. Ereignisse des vergangenen Tages konnten mit Gruppenmitgliedern besprochen und Aufgaben des kommenden Tages geplant werden. Den Abend mit Gesang auszufüllen stärkte das Gemeinschaftsgefühl. Es entstanden Situationen, die geeignet waren, die verbale Kommunikation zu fördern.
Mit dem Einsetzen der Landwirtschaft dürfte die sprachliche Entwicklung abermals einen deutlichen Schub erhalten haben. Ging es jetzt doch darum, anderen Personen zu beschreiben, wie die Viehhaltung durchzuführen und zu welcher Jahreszeit mit der Aussaat zu beginnen ist. Schilderungen, die die Ausdrucksfähigkeit weiterentwickelten und gleichzeitig den Bewusstseinszustand verbesserten. Wann die Landwirtschaft im großen Stil eingesetzt hat, kann nur grob geschätzt werden. Es wird angenommen, dass dies vor etwa 8000 Jahren in der Levante und vielleicht auch im Industal der Fall gewesen sein dürfte. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Beginn einer Viehhaltung aus folgenden Gründen schon sehr viel früher eingesetzt haben muss.
Menschliche Ansiedlungen erstreckten sich immer in unmittelbarer Nähe von irgendwelchen Gewässern. Seien es Bäche, Flüsse oder Seen. Jede Ansiedlung in solchen Gegenden, auch wenn sie von den Nomaden nur von kurzer Dauer genutzt wurden, muss eines Tages dazu geführt haben, dass die Menschen die dort ebenfalls ansässigen Wasservögel zur Ergänzung ihres Speiseplanes gejagt haben. Es bedarf keiner großen Phantasie, sich vorzustellen, dass dabei auch das Gelege dieser Wasservögel entdeckt und geplündert wurde.
Bei der Plünderung von Gelegen wird sich irgendwann auch die Situation ergeben haben, dass aus den schon fertig bebrüteten Eiern Jungtiere zu schlüpften begannen. Mit Verwunderung dürften die Menschen dann die Erfahrung gemacht haben, dass die gerade geschlüpften Tiere keinerlei Scheu vor den Menschen hatten, ihnen sogar bereitwillig hinterherliefen, wie sie es bei dem Muttertier getan hätten. Gerade geschlüpfte Wasservögel sind außerordentlich zutraulich, wenn sie von Anfang an nur des Menschen ansichtig werden. An Stelle eines Muttertieres sehen sie nun den Menschen als ihr Bezugsobjekt an. Dieses Verhalten änderte sich selbst dann nicht, als die Wasservögel herangewachsen waren. Der Bezug zum Menschen blieb bestehen. Erfahrungen, die jeder Tierhalter von Federvieh nachvollziehen kann und die in den 1960ger Jahren von Konrad Lorenz wissenschaftlich untersucht und ausführlich beschrieben worden sind [24].
Die Zutraulichkeit der Jungtiere zum Menschen eröffnete die Möglichkeit, sowohl eine bequemere Nahrungsbeschaffung sicherzustellen als auch Verhaltensbeobachtungen an den gefangen gehaltenen Tieren durchzuführen. Die Beobachtungen erlaubten einen Vergleich mit menschlichem Verhalten und offenbarten Verhaltensweisen, die eine gewisse Gemeinsamkeit mit denen des Menschen aufzuweisen schienen. Nach diesen Erfahrungen dürfte es nur folgerichtig gewesen sein, die so gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen auch auf anderes Federvieh, wie etwa Hühner, anzuwenden. Und es wird nicht nur beim Federvieh geblieben sein. Die frühen Menschen werden sich eines Tages überlegt haben, wie Jungtiere von anderen Tierarten des Waldes und der Savanne einzufangen wären, um sie ebenfalls unter menschlicher Aufsicht großzuziehen. Bot sich hier doch die Möglichkeit, zu jeder Zeit frische Nahrung zur Verfügung zu haben, insbesondere dann, wenn Notsituationen zu überbrücken waren. Spätestens nach diesen Erfahrungen wird das Fallenstellen sich als eine Methode zur Beschaffung von Tieren etabliert haben. Eine Methode, die auch die Entwicklung von Lebendfallen miteinschloss. Bei der Nutzung von Lebendfallen wird es nur eine Frage der Zeit gewesen sein, eines Tages auch ein trächtiges Muttertier einzufangen und dieses ihr Junges dann in Gefangenschaft gebären zu lassen. So folgen Schritt für Schritt die weiteren Phasen zur Viehhaltung.
Die sich aus diesen Situationen ergebende Notwendigkeit, anderen Gruppenmitgliedern die Technik des Fallenstellens, des Aufziehens von Jungtieren und die Versorgungsmöglichkeiten der heranwachsenden Tiere zu beschreiben, führte erneut zu einer Erweiterung des Sprachschatzes und neuer Ausdrucksformen. Bei der Nahrungssuche für die eingefangenen Tiere dürfte schnell die Entdeckung gemacht worden sein, dass einige Gräser auch für den Menschen schmackhaft waren. Die Entdeckung, dass die Samen einiger Gräser, die von den Weidetieren gefressen wurden, auch für den Menschen genießbar waren, legte den Grundstein für die Entwicklung zu einer Landwirtschaft. Sehr schnell dürften die Frühmenschen zu der Erkenntnis gekommen sein, dass es einfacher ist, die Gräser in der Nachbarschaft anzupflanzen, als in der Steppe nach den schmackhaften Gräsern zu suchen. Der Grundstein für die Sesshaftigkeit war damit gelegt, und die Kommunikation unter den Stammesmitgliedern passte sich der neuen Situation an. Schließlich mussten den Nachkommen die einzelnen Wachstumsphasen und Witterungsbedingungen erklärt und beschrieben werden, die man selbst in jahrelanger Fleißarbeit in Erfahrung gebracht hatte. Damit verbunden war die Ausbildung einer sich weiter differenzierenden Sprache und die Notwendigkeit einer gewissen Abstraktion, wenn es galt, die Anzahl der Tiere oder die Zahl der Samenkörner für eine Neubepflanzung zu beschreiben.
Die Erfahrungen, die die frühesten Menschen mit der Tier- und Pflanzenwelt gewannen, führten zu der Vorstellung, dass alles ein hohes Maß an Ordnung und ein sinnvolles Zusammenwirken aufweist. Die Beobachtung an den Tieren etwa ließ erkennen, dass diese neben Futterneid, Aggressivität, Wutreaktionen und Nahrungsdiebstahl auch Freundlichkeit und Friedfertigkeit aufwiesen. Eigenschaften, die der Mensch auch bei sich selbst beobachten konnte. Fast zwangsläufig wird sich die Erkenntnis ausgebildet haben, dass der Mensch aber eine besondere Stellung in der Natur einzunehmen scheint und über alle Tierarten eine Herrschaft ausüben kann.
All diese Erfahrungen führten bei den frühen Menschen zu der Erkenntnis, dass trotz unheilvoller Naturereignisse, die gelegentlich vorkamen, eine gewisse Ordnung in der gesamten Natur vorherrscht. Eine Ordnung, die durch unsichtbare Kräfte ausgeübt wurde. Der Wind dürfte bei dieser Vorstellung eine beispielgebende Rolle gespielt haben. Als unsichtbares Medium schüttelt er Bäume durch, lässt Vögel durch die Lüfte gleiten oder trägt von weither Geruchsstoffe heran. Zu der Vorstellung, überall von unsichtbaren Mächten umgeben zu sein, gesellten sich Beobachtungen an Familienmitgliedern, die nach dem Genuss von Pilzen und anderen psychogenen Substanzen ihr Verhalten änderten und sich verhielten, als seien sie von fremden Mächten gelenkt.
Aus all diesen Naturbeobachtungen festigte sich schließlich die Vorstellung, dass alles, was sich bewegt und verändert, durch unsichtbare Kräfte hervorgerufen sein muss. Die eingeschränkten Beobachtungsmöglichkeiten der frühen Menschen führten dabei nicht selten zu recht merkwürdigen Interpretationen der Gegebenheiten. Die menschliche Neigung zur Verallgemeinerung von Beobachtungen führt zu der Vorstellung, dass nicht nur Pflanzen aus dem Erdboden heraus ans Tageslicht kommen, sondern auch Steine langsam aus dem Erdboden herauszuwachsen scheinen. Den Erosionsvorgängen wurden ebenfalls geheimnisvolle Kräfte zugeordnet. Von der Annahme ausgehend, dass alles, was sich bewegt, mit einer Art „Lebenskraft“ verknüpft ist, wird verständlich, dass auch der Lauf der Gestirne von unsichtbaren Mächten gelenkt werden müsse. Von Mächten, deren Fähigkeiten die des Mensch in unvorstellbarem Maße übersteigen.
Für das Selbstverständnis der frühen Menschen dürfte es naheliegend gewesen sein, diese Kräfte zwar unsichtbaren, aber doch menschenähnlichen Wesen zuzuordnen. Schließlich ließen sich damit die vielfältigen Arten von Naturphänomenen wie beispielsweise Sturm und Gewitter, Vulkanausbrüche und Krankheiten anschaulich darstellen. Selbst die als ganz persönlich empfundenen Triebkräfte wie etwa Liebe und Machtstreben seien auf das Wirken dieser Wesen zurückzuführen. Die als völlige Abhängigkeit empfundene Einbettung des Menschen in das Dasein führte soweit, dass selbst eine Idee oder ein Traum nicht als ein eigenes Produkt, sondern einer fremden äußeren Macht zugeschrieben wurde. Noch in mittelalterlichen Erzählungen ist überliefert, dass Personen, die sich mit schwierigen Problemen befassten, glaubten, dass sie während des nächtlichen Schlafes Ratschläge zur Lösung eines Problems eingeflüstert bekommen hätten. Erst mit Sigmund Freud wurde der Traum nicht als eine von außen gespeiste Quelle angesehen, sondern als eine individuelle Erlebniswelt, in der Erlebnisse des Alltags verarbeitet und mit Erinnerungen aus der Kindheit vermischt werden.
Die Erlebnisse in den einzelnen Kindheitsphasen prägen zudem die individuelle Vorstellungswelt wie auch die Vorstellung im Hinblick auf andere Menschen und die gesamten Natur. Die Vorstellung einer alles ordnenden Kraft wird gestützt durch die in frühester Kindheit erlebten Erfahrungen aus einer familienähnlichen Struktur. Der lenkende und schützende Einfluss der Erwachsenen bei der Entwicklung eines Kindes bestärkt dieses in seinem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Ein psychischer Zustand, der später im erwachsenen Alter in der Struktur eines Volksstammes und letztlich in einer staatlichen Struktur ebenfalls gesucht wird. Die tiefenpsychologischen Auswirkungen dieser zahlreichen Einflüsse hat Sigmund Freud erstmals eingehend untersucht und wichtige Zusammenhänge aufzeigen können [13].
Zu diesem Erfahrungshintergrund gesellt sich unsere Neigung, Analogieschlüsse zu ziehen, wenn es darum geht, im Detail unbekannte Naturvorgänge oder Erscheinungsformen der Natur verständlich zu machen. Unbekanntes oder Neues wird mit bereits Bekanntem verglichen, um adäquate Handlungsmuster anwenden zu können. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Allgegenwärtigkeit des Wirkens von unsichtbaren Mächten unweigerlich zu einer Personifizierung auch dieser Mächte führen muss. Mit der Folge, dass, abgesehen von der Unsichtbarkeit der höheren Wesen, diese mit vertrauten menschlichen Eigenschaften bedacht werden und schließlich auch weniger positive Attribute wie Wut und Eitelkeit sichtbar werden lassen. Die so konstruierte transzendente Welt stellt den Menschen auf eine Stufe, die zwar über der Tier- und Pflanzenwelt hinausgeht, von den höheren Mächten jedoch überragt wird.
Mit diesem Weltbild lässt sich nicht nur die aufsteigende Ordnung in der Natur anschaulich beschreiben, sondern auch die bevorzugte Stellung des Menschen, die er aufgrund seiner Vernunftbegabung allen anderen Lebewesen gegenüber einnimmt. Eine Position, in der er sich den unsichtbaren Wesen näher wähnen kann als es allen anderen Lebewesen in der Natur vergönnt ist. Die Extrapolation dieser als aufsteigend interpretierten Ordnung der Natur über das Bestehende hinaus erlaubte die schmeichelhafte Vorstellung, dass die unsichtbaren Wesen lediglich eine Weiterentwickelung des Menschseins darstellen, die nun mit einer unfehlbaren Vernunft und größter Machtfülle ausgestattet sind. Eine Machtfülle, die dazu zu dienen scheint, alle Naturvorgänge zu steuern, aber nicht dazu, einen direkten Kontakt zu dem gemeinen Menschen herzustellen. Zur Erklärung dieser Diskrepanz muss nun eine neue Annahme postuliert werden.
Wenn die höheren Wesen mit übermenschlichen Eigenschaften ausgestattet und eine letzte Vollkommenheit besitzen, trotzdem aber noch menschenähnlich sind, dann sollte es doch möglich sein, auf irgendeinem Wege einen Kontakt zu ihnen herzustellen. Die Sprache der höheren Wesen mag den Menschen fremd sein, so fremd, wie es die Analogie zum Tierreich zu zeigen scheint. Bedienen sich nicht auch höher entwickelte Lebewesen einer besonderen Art der Kommunikation, die der Mensch nur nicht zu deuten versteht? Schließlich lässt sich beobachten, dass einige Tiere durchaus Gesten und Symbole auszutauschen scheinen, da sie mit entsprechendem Verhalten reagieren. Und so wie Tiere, und hier insbesondere die Haustiere, durch Symbole und entsprechende Gesten zu einem bestimmten Verhalten bewegt werden können, so könnte auch eine Vermittlerrolle gegenüber den höchsten Wesen zustande kommen.
Clevere Stammesmitglieder werden schon frühzeitig hier ihre Chance erkannt haben, den beim Menschen latent vorhandenen Hang zur Symboldeutung zu nutzten, um sich selbst in eine besondere Dolmetscherrolle zu begeben und glaubhaft zu machen, dass nur sie allein von den höheren Wesen für genau diese Kontaktaufnahme auserkoren seien. Eine geschickte Überzeugungsarbeit dürfte bei vielen Stammesmitgliedern auf fruchtbaren Boden gefallen sein. Die Entstehung eines Schamanentums war somit geradezu zwangsläufig.
Die Symbollastigkeit, die vielen Objekten in der Welt zugesprochen wurde, öffnete gleichzeitig das Tor zum Aberglauben. Einem Glauben, der sich dadurch auszeichnet, dass allem in der Welt, ob Gegenstand, Lebewesen oder Ereignis, eine geheimnisvolle Fähigkeit innewohnt. Etwa in dem Beispiel: schwarze Katze von links – eine Warnung für den Menschen, nicht für die Katze ̶ , ein Hufeisen über der Hauseingangstür oder das Tragen eines Amulettes, in allem sollen magische Kräfte verborgen sein. Die Phantasie der Menschen wurde durch geheimnisvolle Zeichen oder Symbole schon immer beflügelt und begünstigt allerlei Spekulationen. Insbesondere dann, wenn der Mensch sich in einer schwierigen Situation befindet und er dann geneigt ist, jede Lösung zu akzeptieren, die ihn aus einer misslichen Lage zu befreien verspricht. Schwer heilbare Krankheiten sind hier ein typisches Beispiel dafür, dass viele Menschen in dieser Situation bereit sind, nahezu jeden Vorschlag zur Linderung zu versuchen, solange gleichzeitig auftretende Nachteile als geringer bewertet werden.
Die Verwendung von Symbolen durch auserwählte Personen, die dazu dienen, Kontakte zu den höchsten Wesen herzustellen, nahm im Laufe der Zeit eine dominierende Rolle ein, auf die nicht mehr verzichtet werden konnte. Die mangelnde Kenntnis der Abläufe und Vorgänge in der gesamten Natur und der Wunsch nach anschaulichen Erklärungsmustern bilden die Grundlage für die Spiritualität, auf der sich religiöse Weltanschauungen bilden konnten. Der Weg von der Spiritualität zur Religiosität soll mit den nachfolgenden Betrachtungen vertieft werden.