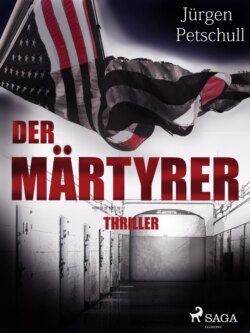Читать книгу Der Märtyrer - Jürgen Petschull - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеHamburg, März 1984
Der erste Frühjahrssturm kam unerwartet über Nacht. Satellitenfotos vom Vortag hatten das Orkantief noch über Island gezeigt und die Metereologen prophezeiten, es werde sich über den britischen Inseln austoben, bevor es Norddeutschland und Hamburg erreichte, wo die Menschen nach einem eisigen Winter die ersten warmen Sonnenstrahlen genossen. Doch der Orkan verlor seine Kraft nicht. Er fiel mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern über die schlafende Stadt her. Dächer wurden abgedeckt, Baugerüste umgeworfen; umherwirbelnde Äste und Dachziegel zertrümmerten Fensterscheiben und Autobleche.
An der Straße Schöne Aussicht, einer teuren Wohngegend an der Außenalster, fuhr der Sturm in die Krone einer jahrhundertealten Kastanie. Die Wurzeln wurden aus dem Boden gerissen und der meterdicke Stamm stürzte vor der Einfahrt der prächtigen Moschee der islamischen Gemeinde quer über die Fahrbahn. Am nächsten Vormittag machten sich Arbeiter mit kreischenden Motorsägen über die mächtige Kastanie her, um das Verkehrshindernis zu zerstückeln und beiseite zu räumen.
Ein doppelstöckiger Stadtrundfahrt-Bus mußte an dieser Stelle warten. Die junge Fremdenführerin hatte Zeit, ihren Fahrgästen die Geschichte des Bauwerkes gegenüber dem Clubhaus des »Norddeutschen Rudervereins von 1868« zu erklären, das sich befremdlich zwischen hanseatischen Patrizier-Villen und modernen, marmorverkleideten Appartementhäusern ausnahm: die türkisfarbene, von zwei schlanken Minaretts flankierte, von einer grünen Kupferkuppel überwölbte Moschee, die Ende der fünfziger Jahre mit Spenden des persischen Schahs Reza Pahlewi erbaut worden war.
Die Insassen des Rundfahrtbusses konnten an diesem Freitagnachmittag die Auswirkungen der iranischen Revolution bestaunen: hinter meist europäisch gekleideten Männern eilten Frauen im schwarzen langen Schador mit schwarzen Kopftüchern in das moslemische Gotteshaus, die hier in Hamburg so exotisch wirkten wie eine katholische Fronleichnams-Prozession in einer Wüstenoase.
Im Verkehrsstau vor der gestürzten Kastanie wartete am Steuer eines weißen BMW 320 ein junger, gutaussehender Libanese mit einer kleinen roten Narbe an der Stirn, die von einem Autounfall stammte. Seine Frau saß neben ihm. Hinter ihm auf einem Kindersitz war seine drei Jahre alte Tochter angeschnallt, ein hübsches Kind mit großen dunklen Augen und zwei kleinen, mit weißen Schleifen zusammengebundenen schwarzen Zöpfen.
Hussein Ali Bakir war nervös. Er drückte mehrmals auf die Hupe. Sie würden zu spät zum Freitagsgebet kommen, das um 13.30 Uhr begann. Er scherte schließlich aus der Schlange der wartenden Fahrzeuge aus und parkte seinen Wagen gegenüber vom Café »Hansa-Steg«, einem hinter Büschen am Alsterufer gelegenen gelb geklinkerten Bungalow.
Er nahm seine Tochter auf den Arm. Die letzten zweihundert Meter zur Moschee legte das Ehepaar im Schnellschritt zurück. Sie eilten die lange Einfahrt entlang, die breite Steintreppe hinauf, durch die Eingangshalle und stellten vor dem Gebetsraum ihre Schuhe zu den mehr als zweihundert Paaren, die die vor ihnen angekommenen Gläubigen sorgfältig nebeneinander aufgereiht hatten.
»Es sind heute viel mehr Leute hier als sonst«, flüsterte ein junger Mann mit dem typischen Backenbart der Schiiten, der sich ebenfalls gerade die Schuhe abstreifte. »Sie wollen alle den Imam Ghobal, den neuen Gastprediger, hören.«
»Ein neuer Imam?« Hussein blickte den jungen Mann, den er schon einige Male gesehen hatte, fragend an.
»Er soll ein berühmter Prediger sein. Er kommt aus der heiligen Stadt Ghom.«
»Wie heißt er?«
»Mohammed Musa Ghobal.«
Hussein Ali Bakir hatte noch nichts von dem neuen Imam und seiner Mission gehört. Er war nicht sehr fromm und betete selten in der Moschee, obwohl er schon seit mehr als fünf Jahren in Hamburg lebte. Nur an hohen Feiertagen oder bei besonderen persönlichen Anlässen kam er hierher. Diesmal wollte er Allahs Schutz für seine Frau Miriam und seine Tochter Eva Fatima erbitten, denn die beiden sollten morgen zum ersten Mal allein in das immer noch vom Bürgerkrieg heimgesuchte Beirut reisen.
Sie betraten auf Strümpfen den kreisförmigen, von einem umlaufenden Lichtband erhellten Gebetsraum. Der Vorbeter verkündete gerade zum zweiten Mal die Worte der al Fatiha-Sure: »Allhu Akbar ...« – »Gott ist der Größte. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Alle Lobpreisungen gehören Gott, dem Herren der Welten, dem All-Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herren am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir, und Dich allein flehen wir um Hilfe an ...«
Der junge Mann im teuren Kamelhaar-Jackett stellte sich zwischen die betenden Männer auf einen freien Platz in einer der vorderen Reihen. Seine Frau ging zu den anderen Frauen, die außerhalb des von einer kniehohen Brüstung umgebenen Gebetsraumes in einer großen Nische saßen. Die kleine Tochter spielte – nachdem sie die erste Scheu überwunden hatte – mit anderen Kindern auf dem Gang.
Die Gesichter der Gläubigen wandten sich der Mirhab zu, der mannshohen, oben zwiebelförmig zulaufenden Gebetsnische, die nach Mekka ausgerichtet ist. Sie beteten stehend mit seitlich angewinkelten Armen und geöffneten Handflächen, sie beugten die Oberkörper, sie knieten nieder und berührten mit der Stirn die Strohmatten, die über die wertvollen Perserteppiche gelegt sind, dem einzigen Schmuck in der innen sonst schmucklosen Moschee. Bei jeder dieser Gesten der Verehrung und Unterwerfung murmelten sie auf arabisch im Chor die vorgeschriebenen Gebetsformeln.
Hussein Ali Bakir beobachtete seine Vorderleute und seine Nachbarn aus den Augenwinkeln. Er hatte lange nicht in der Moschee gebetet. Er war unsicher und bemühte sich deshalb, sich synchron mit seinen Nebenleuten zu bewegen und so zu sprechen wie sie. Als sich alle auf den Boden hockten, setzte auch er sich nieder.
In der ersten Reihe erhob sich jetzt ein Mann, dessen weißer Turban schon Anziehungspunkt vieler Blicke gewesen war. Der neue Imam, der Korangelehrte, stellte sich mit dem Rükken zur Gebetsnische und mit dem Gesicht zur Gemeinde auf: ein kleiner, untersetzter Mann mit rundlichem Gesicht, randloser Brille und einem Backenbart, dessen Ausläufer sich den Hals hinunterzogen. Seine Augen wanderten während der Predigt von einem Zuhörer zum anderen, in einem bestimmten Rhythmus, von rechts nach links, von der hinteren Reihe zur ersten und wieder zurück. Jeder im Raum hatte den Eindruck, der Imam spreche ihn zeitweilig persönlich an.
Er predigte auf deutsch, wie es in der Hamburger Moschee üblich ist, weil die Gläubigen der islamischen Gemeinde aus mehr als einem Dutzend verschiedener Nationen kommen. Die meisten sprechen Deutsch oder verstehen es zumindest. Der Imam begann:
»Ich habe den Auftrag, alle, die hier versammelt sind, von Ayatollah Chomeini persönlich zu grüßen. Er hat mir aufgetragen, in Hamburg und später in anderen Gemeinden der Bundesrepublik und in Europa zu sprechen ...« Er sei stolz, nun an derselben Stelle zu stehen, an der einst der große Gelehrte und Revolutionär und Märtyrer Ayatollah Mohammed Hosseini Beheschti – »Friede sei mit ihm« – gestanden habe.
Der Imam hob seine Stimme.
»So wie es damals die Aufgabe von Märtyrer Ayatollah Beheschti war, als er hier in Hamburg gelehrt hat, so ist es heute auch meine Aufgabe, die Wahrheit zu verbreiten; denn aus den trüben Quellen der westlichen Medien ergießt sich eine Flut von Lügen, von Schmutz und Verleumdung über die religiösen, gesellschaftlichen und politischen Errungenschaften und Entwicklungen im Iran und im Nahen Osten.«
Der Freitagsprediger setzte zu seiner Grundsatzrede an. Er erklärte, warum der einzige Weg zum Frieden in der Welt und zum persönlichen Glück das Leben nach den wahrhaftigen Regeln des Koran sei. Er sagte: »Eine kapitalistische Gesellschaftsordnung, deren oberstes Gebot die Profitmaximierung ist, steht zum Islam im grundsätzlichen Widerspruch – ebenso wie die Entmündigung des einzelnen durch die kommunistische Planwirtschaft. Der Imperialismus, der Kommunismus und der Zionismus sind unsere Feinde. Die Mächte, die diesen Ideologien anhängen, unterjochen die Völker des Libanon, Palästinas und Afghanistans – so wie sie früher den Iran unterjocht haben.« Die Stimme des Imams klang schrill, als er diesen Teil seiner Predigt beendete.
»Deshalb muß unser Ziel heißen: Nieder mit dem Imperialismus! Nieder mit dem Zionismus!«
Es war eine sehr gemischte Gemeinde, die dem Geistlichen lauschte. Außer ihrem Glauben hatten die Menschen in der Moschee wenig gemeinsam. Im Gebetsraum hockten Iraner, Iraker, Pakistani und Syrer, Türken, Tunesier, Marokkaner, Afghaner und Libanesen; auch dunkelhäutige Afrikaner und hellblonde Deutsche. Studenten in Jeans, Arbeiter in verschlissener Kleidung, Herren in Nadelstreifenanzügen und eine Handvoll junger Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die sich mit den Statussymbolen der westlichen Gesellschaft geschmückt hatten: mit teuren Armbanduhren, Seidenkrawatten und Anzügen italienischer Modeschöpfer.
»Manch einer unserer Brüder in diesem Raum betet die vergoldeten, hohlen Götzen der dekadenten westlichen Konsumgesellschaft an«, fuhr der Imam fort, »statt auch hier in der Fremde nach den Regeln Allahs zu leben, der zu Bescheidenheit und Selbstbesinnung aufruft.« Dies sei um so verwerflicher in einer Zeit, in der gleichaltrige junge Gläubige im Iran, im Libanon und in Palästina im Kampf für die einzige, wahre, gerechte Sache des Islam als Märtyrer ihr Leben hingeben: »So wie es ein sinnloses Leben gibt, so gibt es auch einen sinnlosen Tod – aber das Sterben dieser Märtyrer ist der höchste Sinn irdischen Daseins!«
Bei diesen Worten spürte Hussein Ali Bakir die großen Augen hinter der blinkenden Brille auf sich gerichtet. Es mochte ein Zufall gewesen sein, aber später erinnerte er sich wieder daran.
Hussein Ali Bakir war gerade 26 Jahre alt geworden. Als Student war er Anfang 1978 nach Hamburg gekommen. Ein Semester lang studierte er, wie es sein Vater Hasan gewünscht hatte, an der Hamburger Universität Betriebswirtschaft – vielmehr versuchte er zu studieren, doch seine Sprachkenntnisse und seine Schulbildung reichten nicht aus. Er mußte das Studium abbrechen.
Er schämte sich, seinem strengen Vater sein Versagen einzugestehen. Noch ein Jahr lang schrieb er ihm Briefe nach Beirut, in denen er über angebliche Fortschritte seines Studiums berichtete.
Statt Betriebswirt mit Diplom wurde Hussein Teppichhändler; zunächst in der Hamburger Firma seines Onkels Yussuf. Die »Persepolis Carpets Im- und Export« unterhielt ihr Büro und Lager in einem der alten Backsteinhäuser in der Speicherstadt des Hamburger Freihafens. Hussein, so stellte sich bald heraus, hatte ein ungewöhnliches Talent zum Handeln, wie viele seiner libanesischen Landsleute.
Nach einem Jahr war er der beste Verkäufer der Firma »Persepolis«. Sein Onkel zahlte ihm ein Gehalt von 2000 Mark plus mietfreiem möblierten Zimmer. Das war dem ehrgeizigen jungen Mann zu wenig. Hussein begann erste einträgliche Nebengeschäfte zu machen – ohne Wissen und auf Kosten seines Arbeitgebers: Kunden seines Onkels sagte er vertraulich, er könne ihnen wertvolle Teppiche zu Großhandelspreisen bei Orientteppich-Importeuren im Hamburger Hafen beschaffen; einen mittelgroßen »Isfahan«, der rund 10 000 Mark kostete, verkaufte Hussein für 7000 Mark – und verdiente selber noch 2000 Mark daran.
Der Onkel des jungen Libanesen wunderte sich über die nachlassenden offiziellen Verkaufserfolge seines Neffen – bis er durch einen anderen Angestellten von Husseins privaten Nebengeschäften erfuhr. Wütend warf er den treulosen Zögling aus der Firma und aus seiner Wohnung. Im Zorn diktierte er einen Brief an Husseins Vater, an Hasan Ali Bakir, nach Beirut. Er nannte Hussein einen undankbaren Menschen, einen hinterhältigen Betrüger, und er berichtete jetzt auch, daß Hussein schon vor längerer Zeit sein Studium abgebrochen und seinen Vater belogen habe.
Der alte Mann schrieb daraufhin verzweifelt und zornig, daß er keinen Sohn mehr habe: »Ich will Dich nie wiedersehen!«
Das war im Herbst 1979 gewesen.
Hussein besorgte sich eine Pistole, eine 7,65 Walther PPK. Er betrank sich, fuhr nachts zu den menschenleeren St. Pauli-Landungsbrücken, kletterte über das Geländer, starrte in das gurgelnde Elbwasser und setzte den Pistolenlauf in seinen Mund. Er wollte sich so erschießen, daß sein Kopf zerschmettert würde und sein Körper in die zur Nordsee fließende Strömung stürzen mußte. Seine Leiche sollte nie gefunden werden oder wenigstens nicht mehr identifiziert werden können.
Später wußte er nicht mehr, wie lange er da gestanden hatte. Erst als es hell wurde und die ersten Werftarbeiter kamen, gab er sein Vorhaben auf.
Er war dann ziellos durch die Stadt gelaufen. Und als er sich bewußt wurde, daß er irgendwie weiterleben würde, da war er zum ersten Mal in die Hamburger Moschee gegangen und hatte gebetet.
Jetzt, beim Freitagsgebet, mußte er nach langer Zeit wieder daran denken, als der Imam über sinnloses und sinnvolles Sterben sprach: sein Selbstmord wäre damals ein vergeudeter Tod gewesen.
Damals hatte er haltloser und skrupelloser weitergelebt als zuvor. Immer häufiger kamen seine Kunden aus der Hamburger Halbwelt: Söhne aus reichen Familien, Nichtstuer, Playboys, auch Zuhälter und Luxushuren. Es sprach sich in diesen Kreisen schnell herum, daß da ein junger Libanese war, der Orientteppiche erster Qualität sehr billig liefern konnte.
Hussein Ali Bakir trug das leicht verdiente Geld nicht auf die Bank, sondern in das Spielcasino im Hamburger »Intercontinental-Hotel«. Oft verlor er am Roulettetisch in wenigen Stunden fünfstellige Summen. Als er eines Nachts aus dem Casino kam, wartete in der Tiefgarage die Polizei auf ihn. Sein blauer Porsche, den er mit Bargeld und mit Teppichen bei einem zwielichtigen Gebrauchtwagenhändler bezahlt hatte, war in München als gestohlen gemeldet worden. Er wurde als Autodieb verdächtigt und erkennungsdienstlich behandelt. Im Hamburger Polizeipräsidium legten sie eine Akte mit seinen Porträtfotos und Fingerabdrücken an.
Der Staatsanwalt verzichtete später zwar auf eine Anklage, aber die Ausländerbehörde kündigte an, seine Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik werde wahrscheinlich nicht noch einmal verlängert werden.
Das war im Frühjahr 1980. Kurz danach hatte er Miriam kennengelernt.
Miriam.
Er drehte sich um. Sie saß in der Gebetsnische bei den Frauen ganz vorn. Sie hockte während der Predigt entspannt im Schneidersitz am Boden, die schlanken Hände auf die Oberschenkel gelegt, den Kopf in den Nacken geworfen. Ihre Gesichtszüge waren entspannt, ihre Augen geschlossen. Er liebte ihre Augen.
Ihre Augen waren ihm zuerst aufgefallen, noch bevor er ihr ovales, sandfarbenes Gesicht, ihre langen braunen Haare und ihren geschmeidigen Körper wahrgenommen hatte. Es waren klassisch schöne, orientalische Augen, groß und mandelförmig, von dunklem Grün.
Sie war die Tochter eines persischen Architekten, der zu Regierungszeiten des Schahs in der Nähe von Teheran ganze Trabantenstädte entworfen hatte, bevor er sich mit seinen Auftraggebern überworfen hatte und nach Deutschland ausgewandert war. Ihre Mutter war eine Hamburger Modeschöpferin. Miriam besaß die deutsche Staatsbürgerschaft.
Im Juni 1980 heirateten Hussein und Miriam. Der junge Ehemann schickte seinem Vater einen Brief mit einem Hochzeitsfoto nach Beirut. Er schrieb auch, daß er die Tochter eines iranischen Schiiten geheiratet habe. Er glaubte, das würde seinen Vater freuen. Aber er bekam keine Antwort.
Miriam wurde bald nach der Trauung schwanger. Im März 1981, drei Wochen früher als erwartet, wurde eine gesunde Tochter geboren. Sie nannten sie Eva Fatima. Das Baby hatte die mandelförmigen Augen der Mutter.
Die Ehe mit Miriam und die Geburt seiner Tochter hatten Hussein Ali Bakir verändert. Er brauchte jetzt keine Angst mehr um die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu haben, da er mit einer Deutschen verheiratet war. Er hatte – auch auf Drängen seines Schwiegervaters – seine einträglichen Geschäftsbeziehungen zu den Hamburger Unterweltskreisen abgebrochen und beim Gewerbeamt eine eigene Handelsagentur für den Im- und Export von Orientteppichen und Kraftfahrzeugen angemeldet. Er verdiente nicht mehr soviel wie früher – aber er ging auch nicht mehr ins Spielcasino.
Er war auf dem Wege, ein solider Kaufmann zu werden, mit eigenem Büro und kleinem Lager in einem der alten Speicherhäuser im Hamburger Freihafen, mit Steuerberater und offiziellem Bankkonto. Seine Einnahmen reichten für die Miete einer Vier-Zimmer-Wohnung in einer guten Wohngegend am Hamburger Isemarkt und für den Lebensunterhalt der kleinen Familie.
Zum ersten Mal war Hussein Ali Bakir mit sich und seinem Leben zufrieden. Nur der Gedanke an die Enttäuschungen, die er seinem Vater bereitet hatte und an dessen unversöhnlichen Zorn schmerzte noch.
Ganz unerwartet fand Hussein Ali Bakir Anfang März 1984 zwischen der Geschäftspost einen Brief aus Beirut. Er erkannte die Handschrift seines Vaters sofort. Er versuchte ruhig zu bleiben, aber seine Finger zitterten doch, als er das Kuvert aufriß. Darin lag ein zerknittertes weißes Blatt, auf dem in der steilen Schrift seines Vaters vier kurze Sätze standen, ohne Anrede und ohne Gruß:
»Du wirst Dich erinnern, daß ich bald meinen 70. Geburtstag haben werde. Es geht mir seit einiger Zeit gesundheitlich nicht sehr gut. Bevor ich sterbe, möchte ich mein Enkelkind sehen. Deine Frau und Dein Kind sind mir an meinem Geburtstag willkommen.«
Unterschrift: »Hasan Ali Bakir.«
Am Abend hatte er Miriam die arabischen Worte übersetzt.
Sie sagte: »Ohne dich fahre ich nicht!«
»Ich bitte dich darum«, erwiderte er.
»Ich kann mich ja nicht einmal richtig mit ihm unterhalten, und unser Kind wird auch nichts davon haben.«
»Er spricht Französisch und etwas Englisch«, sagte Hussein.
Sie merkte, daß ihn ihr Zögern wütend machte und gab deshalb nach:
»Wenn du es unbedingt willst, fahre ich.«
»Ich zwinge dich nicht, ich bitte dich.«
Der Geburtstag seines Vaters war am 23. März. Hussein versprach seiner Frau, in drei oder vier Tagen nachzukommen. Vielleicht kam es ja doch noch zu einer Versöhnung mit seinem Vater. Und wenn nicht, konnte er ihr und seiner Tochter noch ein paar Tage lang seine Heimat zeigen. Es schien im Moment ja ruhig und ungefährlich in Beirut zu sein.
Nach diesem Gespräch hatten sie beschlossen, in die Moschee zu gehen. Gemeinsam wollten sie für einen guten Verlauf der Reise nach Beirut beten.
»Manchmal«, sagte der Imam Mohammed Musa Ghobal, rückte seine starke Brille zurecht und legte seine Handflächen vor seiner Brust aneinander, »manchmal gibt Allah einigen von uns ein Zeichen ...« Nach dieser Überleitung sprach er über den Märtyrer Hossein, den Sohn des Propheten Ali, auf den die islamische Glaubensrichtung der Schiiten gegründet ist.
»Hossein hat den Kampf gegen übermächtige Feinde und den Tod gesucht, so wie sich heute zum Sterben entschlossene junge Freiheitskämpfer der gewaltigen Übermacht unserer Feinde Israel und USA stellen«, sagte der Prediger, und er schloß seine Rede: »Das Leben eines Märtyrers ist wie eine Kerze: es verbrennt, um andere zu erleuchten.«
Der Gottesdienst in der Moschee ging mit dem gleichen Gebetsritual zu Ende, mit dem er begonnen hatte.
Hussein blieb noch in sich versunken im Gebetsraum zurück. Seine Frau und seine Tochter warteten in der kleinen Eingangshalle der Moschee auf ihn, vor einem langen Tisch, auf dem Bücher und Zeitschriften über den Islam und die deutschsprachige Zeitschrift »Al-Fadschr« (»Morgendämmerung«) des islamischen Zentrums auslagen. In der Nähe stand der Imam und sprach mit einigen Gläubigen über seine Predigt. Auch zwei junge Deutsche hörten ihm zu. Der eine hatte einen Notizblock, der andere eine große Fototasche in der Hand. Hussein hörte, wie der Mann mit dem Notizblock sich dem Imam vorstellte. Er sei Reporter bei der größten deutschsprachigen Illustrierten. Der Reporter bat den Imam um ein Interview: er wolle sich über die aktuelle Entwicklung im Iran, über den Krieg gegen den Irak, den wachsenden Einfluß der Schiiten im Libanon und auch über die Situation der Moslems in der Bundesrepublik und in Hamburg informieren.
Der Imam schien zunächst ungehalten. Er beklagte die einseitige negative Berichterstattung der deutschen Medien über den Islam. Doch schließlich sagte er zu. Sie verabredeten sich für einen der nächsten Tage. Der Fotograf fragte, ob er jetzt schon ein Foto machen könne, das den Gastprediger der islamischen Gemeinde in Hamburg mit einigen Gläubigen zeige.
Das Bild wurde draußen arrangiert: im Mittelpunkt der Imam Ghobal, links neben ihm Miriam Bakir mit ihrer Tochter auf dem Arm, rechts neben ihm Hussein, im Hintergrund einige andere Moslems und die Außenansicht der Moschee. Während die Motorkamera schnarrte, rief der Fotograf, der Imam solle sich ein wenig mit den Leuten unterhalten, damit das Bild lebhafter wirke.
Imam Ghobal fragte den neben ihm stehenden Hussein nach seinem Namen, nach seinem Beruf und seinem Heimatland und gestikulierte etwas übertrieben dabei.
»Ich bin auch Libanese«, sagte der Geistliche, als Hussein geantwortet hatte. »Ich bin in Nabatiye geboren und erst als Student in den Iran gegangen.«
»Nabatiye im Südlibanon! Aus dieser Gegend stammen auch meine Vorfahren«, sagte Hussein.
Der Imam lächelte. »Dann sind wir ja nicht nur Brüder im Glauben.«
Hussein erzählte, daß seine Frau und seine Tochter morgen nach Beirut fliegen würden. Musa Ghobal wünschte ihnen gute Reise und Allahs Schutz. Er strich der kleinen Eva Fatima dabei über den Kopf. Die Motorkamera war noch immer in Aktion. Es mußten gute Bilder geworden sein.
Nachdem sich der Imam verabschiedet hatte, fragte Hussein die Journalisten, ob er einige Abzüge der Aufnahmen kaufen könne.
»Die schenken wir Ihnen«, sagte der Reporter, »weil Sie so gut mitgespielt haben. Rufen Sie mich in ein paar Tagen an.« Er gab Hussein seine Visitenkarte. »Jörg Peters« stand darauf. Hussein steckte die Karte ein.
Am nächsten Morgen fuhr er seine Frau und seine Tochter frühzeitig zum Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Von der Aussichtsterrasse aus winkte Hussein Ali Bakir ihnen nach, als sie oben auf der Gangway vor dem Eingang der Lufthansa-Maschine nach Frankfurt standen und sich noch mal umdrehten. Von Frankfurt aus hatte er für sie einen Weiterflug mit Middle East Airlines direkt nach Beirut gebucht.
Das grüne Kleid und die langen braunen Haare seiner Frau wehten im böigen Hamburger Wind. Seine Tochter trug ein rotes Kleidchen. Sie schwenkte aufgeregt ihr dazu passendes rotes Lackköfferchen, in das sie ihre Lieblingspuppe gepackt hatte.
Es sah vor dem riesigen weißblauen Flugzeug aus wie ein flatternder roter Schmetterling.
Es war der 22. März, Frühlingsanfang. Auf der Rückfahrt in die Stadt sah Hussein in den gepflegten Parkanlagen Hamburgs Spaziergänger, die den würzigen Geruch der wärmer werdenden Erde atmeten. Kinder spielten. Die ersten Krokusse blühten und auf der Alster blähten sich die bunten Segel zahlreicher Boote vor der Silhouette der Stadt, die vom schlanken Hochhaus des »Plaza-Hotels« und einem Dutzend Kirchtürmen überragt wurde.
Als Hussein in seinem Büro am Hafen eintraf, war er froh, daß er in den nächsten Tagen viel zu tun hatte, das würde ihn ablenken, bevor er selbst das Flugzeug nach Beirut besteigen konnte. Eine Schiffsfracht aus Bandar-Abbas war angekommen, einem am Indischen Ozean gelegenen iranischen Hafen. Er mußte die neuen Teppiche nach Größen und Qualitäten sortieren und die Preise kalkulieren.
Abends wartete er vergeblich auf einen Anruf seiner Frau aus Beirut. Auch am Geburtstag seines Vaters meldete sie sich nicht und nicht am Tag danach. Hussein wurde unruhig. Er versuchte immer wieder die Nummer eines Freundes in Beirut anzuwählen, den sie als Kontaktmann vereinbart hatten. Schließlich rief er die internationale Auskunft an. Eine Frauenstimme sagte: »Die Verbindungen nach Beirut sind zusammengebrochen.« Auch die Fernschreiber funktionierten nicht.
Am Abend schaltete er den Fernseher ein, um die »Tagesthemen« zu sehen. Nach den Nachrichten und nach Politiker-Interviews aus Bonn, sagte ein sorgenvoll dreinblickender Moderator: »Erst vor wenigen Minuten erhielten wir diesen Filmbericht unseres Korrespondenten aus Beirut.«
Hussein stürzte zum Fernsehgerät und drehte den Ton lauter.
»... in der libanesischen Hauptstadt wird nach einer längeren Feuerpause wieder heftig gekämpft. Alle Nachrichtenverbindungen in die Stadt sind unterbrochen. Der Flughafen wurde geschlossen. Diese Bilder erreichten uns deshalb mit mehr als 24 Stunden Verspätung über Zypern.«
Auf dem Bildschirm erschien der Kopf eines Reporters in Beirut. Er hielt das Mikrofon so dicht an den Mund, daß es fast seine Lippen berührte. Er atmete hastig und betonte das letzte Wort jeden Satzes. Im Hintergrund waren Gewehrfeuer und dann schwere Detonationen zu hören. Der Reporter sagte:
»Wieder einmal hat sich die Hoffnung auf eine längere Waffenruhe in der libanesischen Hauptstadt als trügerisch erwiesen. Seit gestern liefern sich die Milizen der Christen auf der einen und der Schiiten und der Drusen auf der anderen Seite anhaltende Gefechte. Und zum ersten Mal – seit sich die US-Marines nach dem Bombenattentat auf ihr Hauptquartier aus Beirut zurückgezogen haben – greifen die Amerikaner wieder in die Kämpfe ein. Das Schlachtschiff ›New Jersey‹ nimmt vom Meer aus Stellungen der Moslems in den Schuf-Bergen unter Beschuß ...«
Plötzlich krachte es laut aus dem Fernsehlautsprecher. Der Mann auf der Mattscheibe zuckte zusammen. Das Bild wackelte sekundenlang. Dann fuhr das Zoom-Objektiv der Kamera über den Kopf des Fernseh-Korrespondenten hinweg und holte einen Ausschnitt aus der dunstig-blauen Berglandschaft im Hintergrund näher heran: aus einem Trümmerhaufen, der eben noch eine Gefechtsstellung oder eine Siedlung gewesen war, stieg schwefelgelber Qualm in den Himmel. Der Reporter setzte erneut an: »... das aus dem Zweiten Weltkrieg stammende, 45 000 Tonnen große Schlachtschiff ›New Jersey‹ liegt zehn bis zwölf Meilen vor der libanesischen Küste. Die schweren Bordgeschütze haben eine Reichweite von mehr als 20 Meilen. Seit gestern nachmittag feuert die ›New Jersey‹ ...«
Die Kamera schwenkte hastig von den Bergen über zerschossene Häuser im Vordergrund, hinter denen Männer, Frauen und Kinder Deckung suchten, aufs Meer hinaus. Der Kameramann veränderte die Bildschärfe, bis am Horizont, wo das Blau des Wassers und das Blau des Himmels übergangslos ineinanderflossen, flimmernd ein großer grauer Schatten auftauchte. Blitze zuckten daraus hervor, wie aus dem Rachen eines feuerspeienden Seeungeheuers.
Hussein Ali Bakir saß wie erstarrt in einem Sessel, stützte die Ellbogen auf die Knie und preßte seine Hände gegen die klopfenden Schläfen.
Nach einer flimmernden Schnittstelle war der Fernsehreporter wieder im Bild. Er saß jetzt offenbar in einem Studio und faßte das dramatische Geschehen routiniert zusammen: Gestern nachmittag habe die »New Jersey« überraschend mit der Beschießung drusischer Miliz-Stellungen in den Schuf-Bergen begonnen. Dabei habe es auch einige Fehlschüsse gegeben: zwei oder drei der gewaltigen Granaten – jedes einzelne Geschoß transportiere mehr als eine Tonne Sprengstoff – seien in die südlichen Vororte Beiruts eingeschlagen. Dabei solle es nach bisher unbestätigten Berichten mehr als 40 Tote und mehrere 100 Verletzte gegeben haben. Der Marktplatz des Ortsteils Bir el Abed, in dem überwiegend Schiiten wohnten, gleiche einem Trümmerfeld.
»Wir werden Sie morgen weiter über die Vorgänge in Beirut informieren«, sagte der Moderator, verabschiedete sich und verwies auf den anschließenden Wetterbericht.
Diese Nacht verbrachte Hussein nahezu schlaflos. Er wälzte sich unruhig auf dem breiten französischen Bett hin und her und seine rechte Hand griff oft auf die leere Seite hinüber, auf der sonst seine Frau lag. Gegen Morgen schlief er erschöpft und traumlos ein. Er überhörte den Alarmton seines Radioweckers und wurde erst wach, als das Telefon läutete. Es war schon nach zehn. Noch immer schlaftrunken nahm er den Hörer ab.
»Hier ist das islamische Zentrum Hamburg. Spreche ich mit Hussein Ali Bakir?«
»Ja – was ist denn los?«
»Herr Bakir, wäre es Ihnen möglich, noch heute vormittag in die Moschee zu kommen?« fragte der Mann am anderen Ende der Leitung, offenbar ein Deutscher. »Imam Ghobal möchte Sie sprechen.«
»Können Sie mir sagen, worum es geht?«
»Nein, der Imam wird es Ihnen sagen. Bitte kommen Sie bald.« Die Stimme des Mannes klang beruhigend, mitfühlend, dachte Hussein, nachdem er den Hörer aufgelegt hatte. Oder sogar mitleidig ...?
Er wurde nervös. Er zog sich schnell an, frühstückte nicht und fuhr den gleichen Weg zur Moschee, den er vor wenigen Tagen zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter gefahren war: über den Harvestehuder Weg und die Krugkoppelbrücke, über die Sierichstraße, die Fährhausstraße bis zur Schönen Aussicht.
Auf einer kleinen Rasenfläche am Straßenrand vor der Moschee lagen jetzt sorgfältig gestapelt die in Scheiben gesägten Stücke des umgestürzten Kastanienstammes.
Die Tür zum kleinen Büroraum links hinter dem Eingang der Moschee stand offen. Ein graubärtiger Mann kam hinter dem Nußbaumschreibtisch hervor und näherte sich ihm zögernd, mit gemessenen Schritten. »Mein Name ist Ali Wagner«, sagte er, »ich bin der Sekretär des islamischen Zentrums. Ich habe Sie vorhin angerufen ...« Der Mann zögerte und sagte: »Der Imam wartet im Gebetsraum.« Dann ergriff er plötzlich Husseins Hände und drückte sie lange. Hussein sah ihn verwirrt an und folgte ihm.
Der große Gebetsraum schien menschenleer. Erst nach einer Weile entdeckte Hussein zwei Männer, die – etwas im Schatten – direkt vor der Mirhab am Boden knieten. Er sah nur ihre runden, vorgebeugten Rücken, ihre Hinterköpfe und die Sohlen ihrer Socken. Ihre Stirnen berührten den Boden.
Sie hörten ihn nicht, als er über die Strohmatten nähertrat. Unschlüssig stand er hinter den beiden Betenden, bis sie sich – plötzlich und ohne ein Wort miteinander gewechselt zu haben – gleichzeitig erhoben. Gleichzeitig auch drehten sie sich zu ihm um, so als hätten sie ihn in genau diesem Moment erwartet.
Der Mann, den er nicht kannte, war jünger als der Imam, etwa 30 Jahre alt. Er hatte kurzes, in die Stirn gekämmtes Haar und einen schmalen Bart, der ein intelligentes, jetzt blasses und übernächtigtes Gesicht umkränzte. Das Weiße in seinen Augen war rot unterlaufen. Er trug Kleidung, die zu leicht war für diese Jahreszeit in Hamburg: Jeans, T-Shirt, eine dünne Popelin-Jacke.
»Dies ist unser Bruder Mojtaba. Er ist gestern spät aus Beirut gekommen«, sagte der Imam auf arabisch.
Der Mann aus Beirut griff in die Tasche seiner Jacke und holte langsam einen verschmutzten, grünen deutschen Reisepaß hervor, schlug sorgsam die Seite mit dem Paßbild auf und reichte ihn Hussein.
»Ich glaube, das ist der Ausweis deiner Frau?«
Hussein griff hastig danach. Er erkannte ihr Bild sofort.
Der Imam trat einen Schritt auf ihn zu, umarmte ihn, zog seinen Kopf zu sich heran und küßte ihn auf beide Wangen. Dann sagte er:
»Du mußt jetzt sehr tapfer sein, Hussein, deine Frau und dein Kind sind tot!«