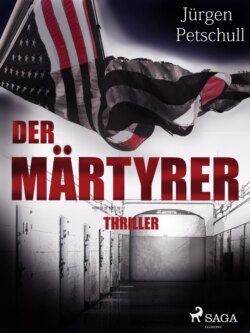Читать книгу Der Märtyrer - Jürgen Petschull - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеHamburg/Beirut, März–April 1984
Die Worte klangen in dem leeren Gebetsraum der Moschee nach. Hussein Ali Bakir stand regungslos da, mit einem seltsam eingefrorenen Gesichtsausdruck: sein Mund hatte sich halb geöffnet, aber es kam kein Laut hervor; seine Augen waren weit aufgerissen, aber sie wirkten leblos; seine Ohren schienen gehört zu haben, was der Imam gesagt hatte, aber eine Art Schutzmechanismus blockierte noch den Weg der Worte zu seinem Verstand.
In die Stille hinein sagte Mojtaba, der Mann aus Beirut, stokkend:
»Sie sind in Süd-Beirut umgekommen, in der Nähe von Bir el Abed. Die Amerikaner haben von See her geschossen ... zwei Granaten sind auf einem Marktplatz eingeschlagen ... es hat viele Tote gegeben. Die meisten waren Frauen und Kinder ...«
Unschlüssig hielt er ein kleines, silberfarbenes Notizbuch in den Händen, in das Miriam Bakir die Adressen von Freunden und Bekannten notiert hatte. Auf der ersten Seite stand unter der Rubrik »Bei einem Unfall bitte sofort benachrichtigen« der Name und die Hamburger Telefonnummer ihres Mannes.
Hussein stand noch immer wie erstarrt. Dann löste sich der Schock ganz plötzlich. Sein Gesicht zitterte. Die Augen flakkerten, der Körper wurde durchgeschüttelt. Die Beine gaben nach. Er sank auf die Knie, und sein Oberkörper klappte nach vorn, bis die Stirn wie zum Gebet den Boden berührte, aber seine Arme schlangen sich um seinen Kopf, als wenn er sich vor Schlägen schützen wolle. Erst war ein Wimmern zu hören, das schließlich in ein haltloses Schluchzen überging.
Später wußte er nicht mehr, ob er minuten- oder stundenlang so dagehockt hatte. Er spürte Hände an seinen Schultern, die ihn sanft aufrichteten. Es war der Mann aus Beirut. Neben ihm stand jetzt der Sekretär aus dem Büro des islamischen Zentrums. Der hielt ein Glas mit einer wässrig-milchigen Flüssigkeit in der Hand, in der Diazepam-Tabletten aufgelöst waren, ein starkes valiumähnliches Schlafmittel.
Hussein trank in langen, hastigen Zügen. Sie betteten ihn in einer Ecke der Moschee auf Strohmatten und Kisten. Bevor er in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf fiel, sah er den Imam Mohammed Musa Ghobal aufrecht mit erhobenen Händen vor der Mirhab stehen. Der Imam zitierte aus dem Koran den 169. Vers der al Imram-Sure.
»Du darfst nicht glauben, daß diejenigen, die um Allahs Willen getötet worden sind, wirklich tot sind. Nein, sie sind im Jenseits lebendig und der Herr versorgt sie ...« Und er fügte den 42. Vers der al Fadschr-Sure hinzu: »Allah nimmt die Seelen zu sich zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die noch nicht gestorben sind, während des Schlafens.«
Der Imam schlug den Koran zu und sagte: »Du, mein Bruder, wirst deine Frau und dein Kind am Tag des Jüngsten Gerichts im Jenseits wiedersehen – wenn du tust, was deine Aufgabe ist. Das verspreche ich, im Namen Allahs des Allmächtigen und Barmherzigen.«
Als Hussein nach einigen Stunden wieder zu sich kam, saß Mojtaba neben ihm und ließ die 33 Perlen des Tasbih, der rosenkranzähnlichen Gebetskette, unablässig durch seine Finger gleiten.
»Es ist besser, wenn du jetzt nicht allein bist«, sagte er nach einer Weile bestimmt. »Ich werde dich in deine Wohnung fahren und bei dir bleiben.«
Husseins Augen waren verklebt, seine Gelenke und Muskeln noch weich von der Wirkung der Tabletten.
Mojtaba stützte ihn, als sie den Gebetsraum verließen. Im Vorraum erkannte er einen Mann, der offenbar auf ihn gewartet hatte: der Reporter Jörg Peters.
Der blätterte abwesend in den ausgelegten Zeitschriften und Broschüren. Er hatte gerade in der Bibliothek sein Gespräch mit dem Imam, dem Vertrauten des Ayatollah Chomeini, beendet. Der Imam hatte ihm dabei auch von dem Schicksal des Mannes erzählt, den die Reporter noch vor wenigen Tagen mit seiner Frau und seinem Kind vor der Moschee fotografiert hatten – als Beispiel für die Unmenschlichkeit der »imperialistischen, kolonialistischen amerikanischen Kanonenbootpolitik«, wie er sagte.
Jörg Peters witterte eine Geschichte für sein Blatt, eine vom Schicksal dieses Mannes ausgehende Reportage. Der Reporter hatte es immer gehaßt, nach Verbrechen, Katastrophen, Aufständen und Militäraktionen mit den Hinterbliebenen der Opfer reden zu müssen. Er kam sich dann vor wie einer, der sein Geld mit dem Leid anderer verdiente. Aber es gehörte zu seinem Beruf, und andererseits – so redete er sich ein – konnten solche Reportagen mehr bewirken als Analysen und Leitartikel.
Er mußte den Mann jetzt ansprechen, bevor er vielleicht nicht mehr für ihn zu erreichen war.
Jörg Peters ging auf Hussein Ali Bakir und dessen Begleiter zu und sagte etwas hilflos: »Es tut mir leid.« Und dann: »Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann ...«
Hussein sah durch ihn hindurch und ging weiter, ohne ihn zu beachten. Erst als er den Ausgang der Moschee erreicht hatte und Mojtaba ihm die Tür aufhielt, drehte er sich um.
»Bitte geben Sie mir die Fotos«, sagte er, »es sind die letzten Bilder von meiner Frau und meiner Tochter.«
Jörg Peters versprach es und fragte schnell nach Husseins Adresse und Telefonnummer.
»Der Imam kann sie Ihnen geben.«
»Werden Sie nach Beirut fliegen?«
»Ja.«
»Kann ich Sie begleiten?«
»Nein«, sagte Hussein und ging, immer noch von dem anderen Araber geführt, nach draußen.
Es war dunkel geworden. Mojtaba steuerte Husseins Wagen nach dessen Wegbeschreibung durch den Hamburger Verkehr zum Isemarkt. Hussein war jetzt merkwürdig ruhig. Er wunderte sich selber darüber. Erst in seiner Wohnung wurde er wieder von einem Weinkrampf geschüttelt – als er im Flur die Mäntel seiner Frau hängen sah, im Badezimmer ihr Parfüm roch, als er im Kinderzimmer Plüschtiere und andere Spielsachen seiner Tochter in die Hand nahm. Alles war so, als würden sie gleich wieder zur Tür hereinkommen.
Er öffnete den Kühlschrank und goß sich ein Glas halb voll Wodka.
»Keinen Alkohol mehr!« sagte Mojtaba, nahm ihm das Glas weg und schüttete den Wodka in den Ausguß.
»Wir Moslems trinken keinen Alkohol!«
Hussein gehorchte.
»Gestern haben sie aus Beirut berichtet«, sagte er nach längerem Schweigen und schaltete kurz vor acht das Fernsehgerät im Wohnzimmer ein. Diesmal sendete die »Tagesschau« einen kurzen Filmbericht, den amerikanische und französische Kamerateams gedreht hatten. Erst Luftaufnahmen des amerikanischen Schlachtschiffes »New Jersey« vor der libanesischen Küste; dann Bilder von Bord: die Nahaufnahme von der Hand eines jungen Soldaten, der im Gefechtsraum einen Messinghebel umlegte; die großen Geschützrohre, aus denen die raketenartigen Granaten mit zweifacher Schallgeschwindigkeit in Richtung Libanon jagten; die Einschläge aus der Ferne gesehen und zerborstene Gebäude und Bombenkrater in Beirut aus der Nähe.
Schließlich schwenkte die Kamera über die zwischen den Trümmern nebeneinander aufgereihten verstümmelten Leichen. Viele Frauen waren darunter. Das Bild zitterte, als die toten Kinder zu sehen waren – eine Großaufnahme zeigte einen kleinen roten Spielzeugkoffer. Der Deckel war aufgeklappt, in dem Köfferchen lag eine Puppe.
»O Gott«, schrie Hussein. »Das ist ihr Koffer!«
Mojtaba sprang aus seinem Sessel hoch und riß die Leitungsschnur aus der Steckdose, in dem Moment, in dem der Moderator sagte, ein Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums in Washington habe inzwischen bedauert, daß bei der Beschießung von Artilleriestellungen in den Schuf-Bergen durch die »New Jersey« einige Geschosse ihr Ziel verfehlt hätten und dadurch auch Zivilisten getötet worden seien.
Hussein hörte es nicht mehr.
»O Gott«, schrie er noch einmal und trommelte mit den Fäusten auf seine Knie. »Warum haben sie das getan?«
»Weil sie uns hassen«, sagte Mojtaba, »weil sie anders sind als wir, weil wir nicht ihren Glauben haben, weil sie uns unterdrücken wollen, weil sie uns ihre Macht und ihre militärische Überlegenheit spüren lassen wollen. Weil sie die Israelis und die Christen unterstützen.« Nach einer Pause fügte er hinzu: »Du tust so, als wenn du das nicht weißt!?«
Beide schwiegen.
Dann sagte Hussein unvermittelt und mit einem Nachdruck, daß es wie ein Schwur klang: »Ich hasse die Amerikaner!«
»Das reicht nicht! Du mußt auch gegen sie kämpfen, mit uns kämpfen – gegen die Amerikaner, gegen die Israelis, gegen die Christen. Die wollen uns unser Land, unsere Freiheit, unsere Würde nehmen. Deshalb ermorden sie auch unsere Frauen und Kinder!«
Hussein senkte die Hände, die er vors Gesicht geschlagen hatte, und sah Mojtaba an.
»Wer hat dich zu mir geschickt? – Wer bist du?«
»Ich bin ein Libanese und ein gläubiger Schiit«, antwortete der Mann aus Beirut, »und ich bin ein Freiheitskämpfer.«
»Wie heißt du?«
»Für dich bin ich Mojtaba, das ist mein Kampfname. Es bedeutet ›der Erwählte‹, wie du vielleicht weißt.« Mojtaba lächelte flüchtig.
»Zu welcher Organisation gehörst du?«
»Das wirst du im Libanon erfahren.«
Hussein blickte ihn an, als nehme er ihn jetzt zum ersten Mal richtig wahr.
»Bist du meinetwegen nach Hamburg gekommen?«
»Ja.«
»Wer hat dich geschickt?«
»Dein Vater!«
Hussein machte ein Gesicht, als könne er nicht glauben, was er gehört hatte.
»Ja, dein Vater!« sagte Mojtaba. »Er ist ein großartiger alter Mann. Er kann selber nicht mehr kämpfen, aber er unterstützt unseren Kampf mit seinem Geist und seinem Geld.«
»Mein Vater ...?«
»Ich kenne deinen Vater seit langer Zeit, und dein Bruder war mein Freund. Dein Vater ist stolz auf deinen Bruder, weil er im Kampf gegen unsere Feinde gefallen ist. Mit dir wollte er nichts mehr zu tun haben, weil du ihn enttäuscht und belogen hast, weil du hier in der Fremde unseren Glauben, unsere Prinzipien und unseren Kampf verraten hast wie ein feiger Deserteur.«
»Aber ich ...«
Mojtaba unterbrach ihn.
»Dein Vater war sehr glücklich, als er jetzt deine Tochter, sein Enkelkind, zum ersten Mal gesehen hat, und deine Frau hat ihm sehr gefallen. Er will dir verzeihen, wenn ...«
Draußen auf den Gleisen, die auf einem Stahlgerüst über die Isestraße führen, fuhr geräuschvoll eine Hochbahn vorüber.
»... wenn du jetzt, nach allem, was passiert ist, dein Leben änderst. Wenn du nach Beirut zurückkommst und mit uns kämpfst und den Mord an deiner Tochter und deiner Frau rächst! Dein Vater hat mich zu dir geschickt, um dir das zu sagen!«
Hussein antwortete nicht.
Er spürte Mojtabas Blick unablässig auf sich gerichtet. Er dachte: Ob sie Schmerzen gehabt haben? Ob sie lange leiden mußten oder gleich tot waren? Zwischen Aufwallungen von Trauer und Selbstmitleid spürte er wieder Haß und Wut – Haß und Wut auf die, die sie umgebracht hatten. Und er dachte an seinen Vater.
»Wann fliegen wir«, fragte er endlich.
»Übermorgen geht ein Direktflug von Frankfurt nach Beirut«, sagte Mojtaba und lächelte jetzt, sichtlich erleichtert.
»Ich habe zwei Plätze für uns gebucht.«
Hussein nickte.
»In drei Tagen wird in Beirut eine große Trauerfeier für die Opfer des amerikanischen Attentats stattfinden. Es wird eine Demonstration werden, zu der viele tausend Menschen kommen.«
»Was soll aus meinem Geschäft werden und aus der Wohnung und dem Auto?«
»Wir haben Freunde hier in Hamburg, die einen guten Anwalt kennen. Du solltest ihm morgen eine Vollmacht geben. Er wird alles für dich verkaufen«, sagte Mojtaba und fügte hinzu: »Wir können das Geld gut gebrauchen.«
Hussein sah ihn fragend an.
»Für Waffen und Medikamente«, sagte der Mann aus Beirut, »hauptsächlich für Waffen.«
Hussein nickte wieder, diesmal so, als habe er nichts anderes erwartet.
In der Nacht zum Dienstag schlief Mojtaba auf der Couch in Husseins Wohnzimmer tief und fest wie jemand, der eine anstrengende Arbeit erfolgreich beendet hat.
Hussein lief unruhig hin und her. Er versuchte vergeblich, sich zu konzentrieren, suchte dann Ausweise, Privatpapiere und Fotos zusammen, packte bereits Koffer und Taschen und schrieb kurze Abschiedsbriefe: an seine Schwiegereltern, an seine Sekretärin, an einige Bekannte in Hamburg. Dann schlief auch er ein.
Am nächsten Nachmittag fuhren sie zu einem Anwaltsbüro in die Hamburger Innenstadt. Hussein war schon nicht mehr erstaunt, daß dort bereits ein Schriftstück vorbereitet war, mit dem der junge Anwalt bevollmächtigt wurde, für ihn sein gesamtes Hab und Gut zu verkaufen. Er unterzeichnete das Papier. Der Erlös sollte auf ein Bankkonto nach Luxemburg überwiesen werden.
Den Abend verbrachte er allein zu Hause. Mojtaba hatte gesagt, er müsse seine Freunde in Hamburg besuchen.
Am Mittwochvormittag nahmen sie ein Taxi zum Flughafen. Sie machten einen Umweg über den Harvestehuder Weg, eine der schönsten Alleen Hamburgs, die an der Außenalster entlangführt. Im Alsterpark liefen Jogger in bunten Trainingsanzügen. Frauen schoben Kinderwagen vor sich her. Ältere Leute ruhten auf den Bänken aus und blickten über das Wasser, auf dem Segelboote kreuzten. Die ersten Trauerweiden trugen helles Grün. Die japanischen Kirschbäume blühten.
Hussein dachte daran, daß er hier im vergangenen Frühjahr mit Miriam und mit Eva Fatima spazierengegangen war.
»Eine schöne Stadt«, sagte Mojtaba, der ihn von der Seite beobachtet hatte. »Beirut war auch eine schöne Stadt.«
Sie flogen um zehn Uhr ab Hamburg-Fuhlsbüttel mit dem Lufthansa-Flug 708 nach Frankfurt. In Frankfurt hatten sie fast zwei Stunden Aufenthalt, denn der Start von Middle-East-Airlines-Flug 226 nach Beirut hatte sich verspätet.
Während des Fluges sprachen sie kaum.
»Sie müßten bald da sein«, sagte der Mann mit der Kalaschnikow, der voranging.
»Glaubst du, daß er kommt?« fragte ihn der Bärtige, der ihm mit einem M 16-Schnellfeuergewehr in der Hand folgte.
»Er kommt bestimmt«, sagte der dritte, der eine an einem breiten Tragegurt über seine Schulter hängende Bazuka schleppte.
»Die Frage ist, ob er nur zur Beerdigung kommt oder ob er ganz hierbleibt?«
Manchmal, als sie durch enge Gassen gingen, schrammte das Metall der langen, rohrartigen Panzerfaust gegen die von Einschüssen zernarbten Hauswände und Mauern.
Die drei Männer gingen gebückt, schnell, aber nicht hastig, durch die stinkende menschenleere Ruinenlandschaft des Stadtteils Bachoura – Kriegshandwerker, die Feierabend hatten.
Hinter ihnen waren vereinzelt Schüsse zu hören. Dann kurze, tackernde Salven. Gelegentlich auch dumpfe Detonationen. Wie immer kurz vor Sonnenuntergang lebte der Stellungskampf an der Barrikade zwischen dem christlichen Ostteil und dem moslemischen Westen der Stadt auf. Der Nachtdienst hatte auf beiden Seiten mit der Arbeit begonnen, und nach dem Schichtwechsel demonstrierten Scharfschützen und Kanoniere hüben wie drüben ihre Anwesenheit und Feuerkraft. Bald würde es wieder ruhig sein.
Die drei Waffenträger, Amir, Belal und Toufik, bewegten sich weiter von der Front weg, nach West-Beirut hinein. Vor ihnen zeichnete sich gegen den Abendhimmel die Silhouette der Stadt ab: von Granaten durchlöcherte Hausfassaden, zerfetzte Baumkronen, die Moschee an der Rue Chamiq, deren Minarett angeschossen war wie ein Tonröhrchen in einer Schießbude – noch ein Treffer, und die bereits vornüber hängende Spitze würde auf den angrenzenden alten islamischen Friedhof kippen.
Nach einigen hundert Metern waren die ersten Lichter zu sehen. Glühbirnen in dunklen Fensterhöhlen, abgeblendete Autoscheinwerfer, das matte Leuchtschild einer »Mobil-Oil«-Tankstelle. Vor einem finsteren Haus mit der dunkelblauen Neonschrift »Café Raphael« an der Fassade bogen die drei Männer links in eine breite Toreinfahrt ein, die von bewaffneten Posten bewacht wurde. An den Wänden klebten verschlissene Plakate mit Porträts von Chomeini und Musa Sadr, dem seit Jahren verschollenen Führer der libanesischen Schiiten, und Fotos von Märtyrern, von im Kampf gefallenen jungen Männern.
Zwei schlaffe schwarze Fahnen wehten auf den Dächern der verwinkelten Gebäude, die sich rings um einen asphaltierten Innenhof scharten. Unkraut wucherte aus aufgeplatzten Löchern und Ritzen. Früher waren hier Werkstätten, Krämerläden und Wohnungen gewesen. Jetzt war in diesem dunklen Winkel zwischen der »Grünen Linie« – den Barrikaden zwischen West- und Ost-Beirut an der Rue Damas – und dem großen Friedhof an der Rue Basta eines der Hauptquartiere der Hezbollah, der »Partei Gottes«.
Nach ihrer Rückkehr wuschen sich Amir, Belal und Toufik an einem Wasserhahn auf dem Hof – erst seit ein paar Tagen gab es wieder eine funktionierende Wasserleitung – Hände, Arme, Gesichter und Oberkörper. Von der etwa 800 Meter entfernt gelegenen großen Moschee an der lauten Rue Basta tönte die von Lautsprechern verstärkte Stimme des Muezzin herüber. Er rief zum Sonnenuntergang-Gebet.
»Allahu Akbar ... Hayya Ala-s-Salat ...« – »Gott ist der Größte ... eilt zum Gebet ...«
Es war jetzt kurz nach 18 Uhr.
Als die drei Männer ihre Waffen vor sich auf den Boden legten und gemeinsam mit zwei Dutzend anderen Kämpfern niederknien wollten, war am Himmel ein Brummen zu hören, das schnell näher kam und lauter wurde. Amir, vor dem die Kalaschnikow lag, sah die Boeing zuerst.
»Sie kommen tatsächlich noch«, sagte er, »ihr Flugzeug hat Verspätung.«
Der Pilot der Middle-East-Airlines-Maschine hatte schon vor der libanesischen Küste die Landescheinwerfer eingeschaltet. Auch die Beleuchtung in der Kabine brannte. Die Leute an den Flugabwehrgeschützen sollten sie schon von weitem als Passagiermaschine erkennen. Die Boeing flog eine leichte Kurve und setzte im Geradeausflug von Norden nach Süden zur Landung an.
Hussein saß auf einem Fensterplatz an der linken Seite. Im Westen sank der Sonnenball ins Mittelmeer. Im Osten stand bereits ein schmaler Mond über dem bis zu 3000 Meter hohen Libanon-Gebirge. Im Zwielicht unter ihnen tauchte Beirut auf.
An der St. Georges-Bucht, an der früher mehr als ein Dutzend Luxushotels gestanden hatten, erkannte er das 20 Stockwerk hohe ausgebrannte »Holiday Inn«, das wie ein Mahnmal aus der Trümmerlandschaft ragte. Dahinter das völlig zerstörte Bankenviertel. Daneben ein breiter, dunkler Streifen links und rechts von der Rue Damas, die nun die Grenzlinie zwischen Ost- und West-Beirut bildete.
Tief unter ihnen – sie flogen jetzt etwa in 1000 Meter Höhe – blitzte rote Leuchtspurmunition auf. In der dunklen Gegend rings um den kreisrunden Place d’Etoile, an dem der Bezirk Bachoura beginnt, wurde geschossen.
Rechts unter sich sah er das von hohen Bäumen bewachsene Gelände der amerikanischen Universität und gleich dahinter das gelbe Hochhaus der Uni-Klinik. Dann überflogen sie eine gleißend helle Lichterkette, die quer zur Flugrichtung verlief: die Rue Hamra, die belebte Einkaufsstraße von West-Beirut, die früher als die Champs-Élysées des Nahen Ostens gegolten hatte. Da, in der Nähe eines sauber ausgeschnittenen Quadrats, in der Nähe des kleinen Volksparks, mußte irgendwo das Geschäft seines Vaters liegen.
Hussein fühlte Beklommenheit in sich aufsteigen. Ob sein Vater auf ihn wartete?
Auf einer Bank in dem kleinen Park, der jetzt unter ihnen vorüberhuschte, hatte er händchenhaltend mit seiner ersten Freundin gesessen. Sechzehn war er damals und noch im Ortsteil Maazra zur Schule gegangen. Sie hieß Cathrine und war die Tochter eines französischen Cafébesitzers. Vermutlich war sie längst verheiratet und hatte zwei, drei Kinder.
Die Maschine flog jetzt parallel zur Mittelmeerküste, direkt über die breite Küstenstraße, die nach Süden führt. An der Straße lag das Geschäft des Autohändlers, dem er aus Hamburg gebrauchte BMWs und Mercedes geliefert hatte. Das Landefahrwerk klappte mit einem Ruck aus dem Bauch der Boeing 727. Nun war der Swimmingpool des »Summerland-Hotels« unter ihnen, ein blau beleuchteter Fleck im Dunkel. Gleich hinter dem Luxushotel tauchten die armseligen Palästinenserlager Sabra und Chatilla auf. Das Licht einiger weniger Neonlaternen fiel auf die Steinbaracken. Ein paar Kilometer weiter in Richtung der Schuf-Berge lag Bir el Abed. Dort waren sie gestorben.
Die Gummireifen prallten auf die asphaltierte, löchrige Landepiste, der Pilot bremste zwei-, dreimal kurz hintereinander. Middle-East-Airlines-Flug 226 rollte langsam auf das Flughafengebäude zu. Aus der Neonschrift »Beirut International Airport« waren mehrere Buchstaben herausgeschossen.
»Willkommen daheim«, sagte Mojtaba.
Sie kamen schneller als die anderen Passagiere durch die Paß- und Zollkontrollen. Auch die bewaffneten Milizionäre der Amal, die vor dem Flughafengebäude noch einmal Absperrungen errichtet hatten, winkten sie durch. Sie grüßten Mojtaba geradezu respektvoll, wie es Hussein schien.
Mojtaba verstaute ihr Gepäck in einem verbeulten Nissan Patrol-Geländewagen, den er vor seinem Abflug nach Hamburg offenbar sorglos neben einer Baustelle geparkt hatte. Inzwischen war es dunkel geworden. Auf dem Weg in die Stadt sahen sie überall Schützenpanzerwagen der libanesischen Armee und Milizionäre, denen Kalaschnikows von der Schulter baumelten und die breite Patronengurte trugen. Bewaffnete Motorrad-Patrouillen rasten an ihnen vorüber. Sie konnten die Straßensperren unkontrolliert passieren, sobald Mojtaba seinen Kopf aus dem Seitenfenster steckte.
Sie kamen an einem großen grauen Beton-Neubau einer Moschee vorüber, die direkt an der Flughafenstraße lag. Scheinwerfer beleuchteten die schwarze Fahne an der Spitze des Minaretts und das große Bild des Ayatollah Chomeini an dem schlanken Turm.
Die Straße führte durch ein Kiefernwäldchen, in dem während des israelischen Einmarsches im Sommer 1982 heftig gekämpft worden war, durch halbfertige Siedlungen, über dreckige, von großen Pfützen bedeckte Sandstraßen, an denen kleine Marktbuden standen. Gerupfte Hühner und Gänse und Hälften frischgeschlachteter Hammel hingen an den Decken der Verkaufsstände. Hungern mußte auch während des endlosen Bürgerkrieges niemand im fruchtbaren Libanon.
Nach 15 Minuten erreichten sie die Innenstadt. Mojtaba konnte jetzt nur noch Schrittempo fahren. Dichter, stinkender Feierabendverkehr verstopfte die Straßen. Zwischen intakten, modernen Appartementhäusern und eleganten Modegeschäften von Yves St. Laurent und »Boss« klafften immer wieder große Bombenkrater und Trümmerflächen – noch nicht vernarbte Erinnerungen an die Überlegenheit der israelischen Luftwaffe.
Nach weiteren 20 Minuten erreichten sie die Rue Hamra mit ihren Restaurants, Banken und Boutiquen. Arabische und amerikanische Musik dröhnte durcheinander aus Lautsprechern. Es roch nach gegrilltem Fleisch und orientalischen Gewürzen und nach schwerem Parfüm, das Straßenhändler mit rollenden Verkaufskarren in Form von Geruchsproben versprühten. Mädchen in hautengen Jeans, Damen in teuren Haute-Couture-Kleidern und verschleierte Frauen im Schador spazierten über West-Beiruts Einkaufsstraße. Bilder von Chomeini und Musa Sadr, vom Amal-Chef Nabih Berri und dem syrischen Staatspräsidenten Assad hingen an den Hauswänden. Mojtaba parkte seinen Jeep in der Rue Makissi in der Nähe des »Cavallier-Hotels«. Sie stiegen aus. Die letzten hundert Meter schoben sie sich mühsam durch das dichte Menschengedränge, vorbei an zahlreichen Geschäften, deren Schaufenster von mannshohen Sandsackbarrikaden geschützt wurden. Vor einem unscheinbaren Laden, über dem matte Leuchtschriften für »Blaupunkt«-Radios und »Everready«-Batterien warben, blieb Mojtaba stehen. Hussein wäre an dem Geschäft seines Vaters vorübergegangen. Hassan Ali Bakir hatte seinen Elektroladen um ein Schaufenster vergrößert. Zögernd betrat Hussein das Geschäft. Packungen mit Glühbirnen waren auf Radiogeräte gestapelt, die auf veralteten Fernsehapparaten standen, die wiederum auf Kühltruhen plaziert waren. Der unbestimmbare Geruch von Plastikmaterial, Staub und öligem Bohnerwachs erinnerte ihn an seine Kindheit.
Drei Verkäufer in grauen Kitteln bedienten einige späte Kunden. Den ältesten der Angestellten kannte Hussein noch. Abdullah schien nicht überrascht. Er führte sie durch einen Lagerraum hinter dem Laden, eine winklige, durchtretene Treppe hinauf in den ersten Stock des alten Hauses und klopfte in einem bestimmten Rhythmus an eine schwere, abgegriffene Holztür. Hinter der Tür hörten sie schlurfende Schritte. Innen wurden mehrere Riegel ausgehakt und dann ein Schlüssel umgedreht. Hussein fühlte, wie seine Halsschlagader klopfte, wie immer, wenn er sehr nervös war. Mojtaba stand gelassen neben ihm.
Die Tür öffnete sich. Hussein sah zum ersten Mal seit sechs Jahren seinen Vater. An einem anderen Ort hätte er ihn wohl nicht wiedererkannt.
Der jetzt 70 Jahre alte Hasan Ali Bakir schien kleiner geworden zu sein, gebückt und sichtbar gebrechlich. Sein früher volles Haar war weiß und durchsichtig dünn. Braune Altersflecken sprenkelten seine Gesichtshaut. Die Augen lagen tief in den Höhlen. Er trug eine zweigeteilte Brille, mit verschieden starken Glashälften. Die Brille saß tief auf seiner Nasenspitze.
Hasan Ali Bakir blickte ihn über den Brillenrand an und sagte: »Kommt herein.« Seine Stimme kratzte. Er drehte sich um und ging in seiner zu großen schwarzen Hose und einer zu weiten blauen Hausjacke über den knarrenden Dielenboden des Flurs ins Wohnzimmer.
»Setzt euch!« sagte er und ließ sich in einen großen, abgenutzten Ledersessel fallen. Der alte Mann wirkte verloren darin. Mit einer Handbewegung wies er Hussein und Mojtaba zwei Sitzplätze auf den Lederkissen zu, die auf einem in der Mitte abgeschabten Teppich lagen. Ein alter »Ghom«, wie Hussein als Fachmann bemerkte.
Hussein war unsicher geworden. Er hatte eine Geste erwartet: daß sein Vater ihn an sich drücken würde wie einen verlorenen, zurückgekehrten Sohn; daß er ihm wenigstens die Hand gegeben oder ein Wort des Mitgefühls oder einen Willkommensgruß gesagt hätte. Doch der Alte saß wortlos und steif in seinem Sessel, sah erst Mojtaba an und dann ihn und schwieg noch immer. Hussein merkte, wie ihm vor Enttäuschung und Selbstmitleid Tränen in die Augen traten, aber es gelang ihm, seine Gefühle zu unterdrücken. Er hielt dem prüfenden Blick seines Vaters stand. Der klatschte schließlich matt in die Hände. Eine Frau kam herein, offenbar die Haushälterin.
»Bring uns Tee!« befahl Hasan Ali Bakir.