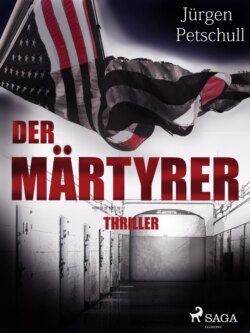Читать книгу Der Märtyrer - Jürgen Petschull - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеBeirut, Frühjahr 1984
Der Alte schlürfte vernehmlich seinen Tee, stellte die Tasse auf ein Messingtablett und atmete tief und asthmatisch, bevor er zu sprechen begann – in langen Sätzen, mit großen Pausen, mehr zu sich selbst als zu den beiden jungen Männern.
»Manche Leute sagen, der alte Hasan Ali Bakir hat kein Glück gehabt in seinem Leben. Seine Frau ist vor ihm gestorben, sein ältester Sohn ist im Kampf gefallen und sein jüngster Sohn hat ihm in der Fremde Schande bereitet, denn er hat seinen Vater belogen, hat gegen die Pflichten des Koran verstoßen und lange Zeit ein liederliches Leben geführt ...«
Die linke Hand des alten Mannes griff nach einer Gebetskette, die auf einem achteckigen Zedernholztischchen lag, das an seinem Sessel stand. Er ließ die gelblichen Elfenbeinperlen durch die Finger gleiten. Seine Lippen bewegten sich währenddessen lautlos. Minutenlang war es still im Raum, nur der Verkehrslärm drang gedämpft von der Straße herauf. Hussein hatte den Eindruck, als verliere sich sein Vater in Erinnerungen.
Der alte Mann hatte in seiner Jugend auf den steinigen Äckern seiner Vorväter in der Gegend des Litani-Flusses im Südlibanon hart gearbeitet und wenig geerntet. Er war schließlich nach Westafrika ausgewandert wie viele arme libanesische Schiiten in den vierziger und fünfziger Jahren. Er handelte in Ghana, auf dem Markt von Accra, mit Aluminiumtöpfen und Elektrogeräten und machte bald ein eigenes Gemischtwarengeschäft auf. Seine beiden Söhne wurden in Accra geboren, in einem Haus am Rande der Stadt.
Husseins Vater und seine Landsleute hatten Erfolg in Westafrika. In den sechziger Jahren spielten geschäftstüchtige Libanesen im Handel an der westafrikanischen Küste eine wichtige Rolle, wie die Inder an der Ostküste Afrikas oder tüchtige jüdische Kaufleute einst in manchen deutschen Städten. Wie die Juden und wie die Inder, so verloren auch die Libanesen ihre Existenz: Einheimische warfen Steine in die Geschäfte der Fremden, plünderten, legten Feuer und vertrieben die Inhaber.
Hussein wußte, daß sein Vater als armer Mann in den Libanon zurückgekommen war. Mit 59 Jahren hatte er in Beirut noch einmal ganz von vorne angefangen, kurz bevor der Bürgerkrieg ausbrach. Seit 11 Jahren gehört ihm nun das kleine Elektrogeschäft in einer Nebenstraße der Rue Hamra. Ein paarmal schon hatten Granatsplitter und Maschinengewehrgarben die Schaufensterscheiben zertrümmert. Jedesmal hatte Hasan Ali Bakir neues Glas eingesetzt. Schließlich stapelte er vor dem Haus Sandsackbarrikaden auf und zahlte Schutzgelder gleichzeitig an die Milizen der Drusen und der Amal. Seither blieb sein Laden weitgehend von Einschüssen verschont.
Mahmud, Husseins ältester Bruder, hatte einmal das Geschäft übernehmen sollen, aber er war 1982 bei Gefechten mit den israelischen Invasionstruppen in der Nähe von Sidon gefallen. Ein paar Monate später legte sich seine Mutter, die ihr Leben lang eine ergebene Dienerin seines Vaters gewesen war, nachmittags zur Ruhe. Sie faßte sich im Schlaf an ihr Herz und wachte nicht mehr auf.
»Nein, unsere Familie hat wirklich kein Glück gehabt«, wiederholte Husseins Vater, legte die Gebetskette zurück und wendete sich seinem Sohn zu. »Und dennoch haben wir kein Recht, uns zu beklagen, denn es ist uns nicht schlechter und nicht besser ergangen als vielen tausend, vielen zehntausend anderen Familien unseres Volkes auch.«
Der Alte blickte lange in sich versunken auf den Boden, bevor er fortfuhr: »Manchmal denke ich, ob es nicht sein kann, daß wir in diesem irdischen Leben von Gott so schwer geprüft werden, weil das wahre Glück im Paradies nur durch Tapferkeit und Leid errungen werden kann – steht es nicht so im Koran?«
Hasan Ali Bakir hob den Kopf. Seine Augen suchten die seines Sohnes. »Du hast deine Frau und dein Kind verloren, wie ich auch. Deshalb weiß ich, welcher Schmerz in dir ist; aber kann es nicht sein, daß das Schreckliche, was auf dem Marktplatz von Bir el Arbed geschehen ist, von Gott vorbestimmt war, damit wir, Vater und Sohn, wieder zueinanderfinden ...?«
Hussein bemerkte ein flüchtiges Zucken im Gesicht seines Vaters. Der alte Mann schloß einen Moment lang die Augen. Hussein glaubte, sein Vater werde weinen, aber der redete mit rauher Stimme weiter. »Ich habe dich damals nach Deutschland geschickt, weil du in einem Land, in dem Frieden herrscht, studieren solltest. Während der Jahre, in denen du nicht hier warst, hat sich Mojtaba um mich gekümmert. Er ist der Sohn eines verstorbenen Freundes aus dem Südlibanon. Mojtaba und seine Freunde sind meine Freunde geworden, und ich habe viel von den jungen Leuten gelernt. Jetzt habe ich Mojtaba nach Hamburg geschickt, damit er dich holt und ich dir sagen kann, was ich von dir erwarte!«
Hasan Ali Bakir trank einen Schluck Tee.
»Ich erwarte von dir, Hussein, daß du, nach allem, was passiert ist, hier in unserem Land bleibst; daß du zusammen mit Mojtaba und seinen Freunden kämpfst, daß ihr diejenigen bestraft, die unser Volk knechten, diejenigen, die deinen Bruder, deine Frau und deine Tochter getötet haben!«
Hussein blickte seinen Vater an. Er war noch nicht zu einer Antwort bereit, aber als er die Augen sah, die zugleich baten und forderten, schob er seine Zweifel beiseite. Er nickte und sagte in dem gleichen förmlichen Ton, in dem sein Vater gesprochen hatte:
»Ich werde tun, was du wünschst!«
Hasan Ali Bakir erhob sich umständlich aus seinem Sessel. Auch Hussein und Mojtaba standen auf. Der Alte ging auf seinen Sohn zu, umarmte und küßte ihn, so wie ihn der Imam in der Moschee in Hamburg umarmt und geküßt hatte. Auch Hussein drückte seinen Vater an sich.
Mojtaba stand daneben wie der Zeuge einer feierlichen Abmachung.
Sie blieben noch eine Stunde bei seinem Vater und aßen Lammfleisch mit Artischocken, das die Haushälterin hereingebracht hatte. Sie saßen lange Zeit schweigend beisammen. Dann erzählte der Alte, Miriam habe mit der Frau eines Bekannten eine Stadtrundfahrt durch Beirut gemacht. »Sie wollte auch auf einem Markt Fleisch und Gemüse einkaufen, denn am Abend wollte sie ein deutsches Gericht für mich kochen.« Dabei seien sie von dem Bombardement des amerikanischen Schlachtschiffes überrascht worden. »Sie sind von der Druckwelle eines Granateinschlages gegen eine Hausmauer geschleudert worden. Sie müssen gleich tot gewesen sein.«
Zur Überraschung von Hussein sagte Mojtaba nach den Essen, es sei nun Zeit für sie beide zu gehen. »Meine Freunde warten auf uns. Vielleicht wirst du einige noch kennen.«
Als sie das Haus verließen und zum parkenden Wagen gingen, blickte Hussein zurück. Er sah seinen Vater hinter dem durch grüne Klappläden halbgeschlossenen Fenster der Wohnung stehen. Er konnte es nicht genau erkennen, aber er hatte den Eindruck, als lächele der alte Mann.
Während der Fahrt schwiegen sie. Mojtaba lenkte seinen japanischen Geländewagen über die jetzt menschenleere und nur noch dürftig beleuchtete Rue Hamra, dann in die Rue Banque Liban und weiter in den Ortsteil Bab Idriss hinein, in dem das zerstörte Bankenviertel liegt. Nur vereinzelt brannten ein paar Lichter. Die Autoscheinwerfer huschten über Schutthalden, zerschossene Wände und ausgebrannte Autowracks. Manchmal erfaßte der Lichtstrahl ein paar Katzen und streunende Hunde und schemenhafte Gestalten mit geschulterten Gewehren. Mojtaba fuhr in die Rue Basta und hielt, nachdem er den großen alten Friedhof halb umrundet hatte, in der Nähe des »Café Raphael«, über dessen Tür die blaue Neonreklame inzwischen erloschen war.
Sie stiegen aus, nahmen das Gepäck von den Rücksitzen und gingen damit durch die Einfahrt mit den Plakaten von Musa Sadr und Chomeini in das Quartier der Hezbollah-Kämpfer. Die Posten mit den Kalaschnikows grüßten.
Es war jetzt halb zehn.
Mojtaba führte Hussein über einen asphaltierten Innenhof zu einem langgestreckten zweistöckigen Gebäude. Im Erdgeschoß war die ehemalige Werkshalle einer Tischlerei untergebracht. An den Wänden standen noch Hobelbänke, Fräsen und Sägen. Die Fenster hatte man mit Decken und Tüchern zugehängt, damit das Licht der nackten Glühbirnen nicht nach draußen fiel. An einem Dutzend schäbiger Tische saßen etwa fünfzig Männer in abgewetzten Kampfuniformen oder in schmuddeligen Jeans und T-Shirts. Hinter ihnen standen griffbereit ihre Schußwaffen.
Amir, Toufik und Belal saßen an einem Tisch in der hintersten Ecke und spielten Schach. Amirs Bauernfiguren wurden durch Pistolenkugeln vom Kaliber 9 mm dargestellt. Seine Dame, eine größere Gewehrpatrone, bedrohte den gegnerischen König. Über ihren Köpfen hingen grellbunte Plakate, auf denen die Heldentaten der Märtyrer verewigt waren: heroische Gesichter, geballte Fäuste, hochgereckte Kalaschnikows; explodierende Autobomben-Lastwagen und gesprengte Passagierflugzeuge; aber auch sterbende Jünglinge und weinende Mütter ganz in Schwarz.
Als Mojtaba und Hussein die Mitte des Raumes erreicht hatten, stellte Mojtaba das Gepäck ab und klatschte laut in die Hände, bis sich alle Blicke auf sie richteten. Er legte seine Hand auf Husseins Schultern und rief: »Dies ist Hussein, der Sohn von Hasan Ali Bakir. Er ist aus Hamburg in Deutschland zu uns gekommen. Hussein wird bei uns bleiben und mit uns arbeiten und mit uns kämpfen. Er ist mein Freund. Gott schütze ihn!« Die meisten Männer antworteten mit zustimmendem Gemurmel, einige klatschten.
Mojtaba schob Hussein zum Tisch der Schachspieler.
Amir, Toufik und Belal standen auf und umarmten Mojtaba, dann schüttelten sie dem Neuankömmling die Hand.
Während Mojtaba ihre Namen nannte, versuchte sich Hussein zu erinnern: alle drei kamen ihm bekannt vor, aber es mußte sechs oder mehr Jahre her sein, seit er sie zum letztenmal gesehen hatte. Die dunklen Bärte hatten ihre Gesichter verändert. Amir, an dessen Händen und Unterarmen ihm großflächige Narben auffielen, die offenbar von Brandwunden stammten, sagte: »Wir haben früher ein paarmal in der Schulmannschaft zusammen Fußball gespielt.«
Toufik, ein gutaussehender junger Mann, trug ein Goldkettchen mit der Hand der heiligen Fatima am Hals und ein Che Guevara-T-Shirt. Er erzählte Hussein, daß er ihm mal ein Mädchen ausgespannt habe. »Cathrine, die Tochter des Cafébesitzers ...« Und Belal, der jüngste, in dessen Gesicht noch Pubertätspickel sprossen, hatte früher in einem Nachbarhaus der Familie Bakir in Maazra gewohnt.
Sie wollten alles über Husseins Leben in Hamburg wissen, aber er hatte keine Lust mehr zu erzählen und blieb wortkarg. Deshalb berichteten die drei, offenbar um ihm zu imponieren, überschwenglich von ihren Abenteuern im Bürgerkrieg in Beirut und von ihren Einsätzen gegen die Israelis im Südlibanon und gegen die US-Marines.
Hussein fühlte sich müde und zerschlagen, und er war deshalb erleichtert, als Mojtaba sagte: »Ich glaube, Hussein will lieber schlafen. Er hat anstrengende Tage hinter sich, und wir müssen morgen früh zur Trauerfeier.« Da erst schien den dreien bewußt zu werden, warum er eigentlich nach Beirut zurückgekehrt war, und sie sagten, es täte ihnen leid, was mit seiner Frau und seiner Tochter geschehen sei.
»Wir werden ihren Tod rächen«, verkündete Toufik pathetisch.
Amir forderte ihn auf, seine Sachen mitzunehmen und ihn zu begleiten, er könne in seinem Zimmer schlafen, dort sei noch ein Feldbett frei. Sie verließen, von den neugierigen Blicken der anderen verfolgt, den Versammlungsraum und tappten über den dunklen Hof in ein Nebengebäude, in dem die Schlafunterkünfte lagen.
Das Zimmer erinnerte mehr an eine Zelle. Zwei Feldbetten standen auf nacktem Betonboden. Die Wände waren aus Leichtbetonsteinen gemauert, unverputzt. Ein kleines, hochgelegenes Loch in der Außenwand ließ Luft herein, die nach Urin und Desinfektionsmitteln roch. »Wenn du mal pinkeln mußt – die Klos sind gleich draußen«, sagte Amir. Er zündete einen Kerzenstummel an, der auf einem wackligen Tisch stand, von dem die hellblaue Farbe abblätterte.
Sie wuschen sich über einem alten Steinbecken auf dem halbdunklen Flur, an dem wie in einer Kaserne Schlafstube an Schlafstube lag. Bevor sie sich auf die mit grauem Segeltuch bespannten Feldbetten legten, knieten sie nebeneinander auf dem Betonboden und beteten. Amir drückte das Kerzenlicht mit Daumen und Zeigefinger aus. Hussein drehte sich im Halbdunkel auf den Rücken und starrte die Decke an. Er vernahm das Surren von Insekten und in großer Entfernung hin und wieder Schüsse. Durch das Fensterloch konnte er einen Fleck des vom Mondlicht erhellten Himmels über Beirut sehen. Sein neuer Zimmernachbar unterbrach die Stille.
»Bist du eigentlich früher in der Armee gewesen?«
»Nein, ich bin noch zur Schule gegangen, als die Wehrpflicht eingeführt wurde«, antwortete Hussein, »und dann bin ich gleich nach Deutschland ausgewandert.«
»Kannst du mit einer Kalaschnikow umgehen?«
»Ich glaube schon, das habe ich als Pfadfinder bei der Amal gelernt.«
»Du weißt aber wahrscheinlich nicht, wie man Minen legt und Autobomben baut?«
»Nein.«
»Das bringen wir dir bei, das ist eine Spezialität von Mojtaba – vielleicht nimmt er dich mit nach Baalbek und in unser Ausbildungslager im Bekaa-Tal. Da wirst du alles lernen, was du für unseren Krieg wissen mußt.«
Auf dem Flur kamen Stiefelschritte näher, und durch die Leichtbauwände hindurch hörten sie aus den Nebenzimmern die gedämpften Stimmen von Mojtaba, Toufik und Belal.
»Wir haben schon zwei Flugzeuge entführt, zuletzt eine jordanische ›Alia‹ nach Amman und wieder zurück nach Beirut«, sagte Amir stolz. »Hier haben wir die Maschine gesprengt. Es hat einen gewaltigen Feuerball gegeben.«
»Ich habe in Deutschland Bilder davon im Fernsehen gesehen«, sagte Hussein.
»Das sollte eine Warnung für den Verräter Hussein von Jordanien sein, damit er aufhört, den Israelis und den Amerikanern in den Arsch zu kriechen.«
»War Mojtaba auch dabei?«
»Hat er dir nichts erzählt?«
»Wir haben bisher kaum über ihn gesprochen. Wir hatten ja mit meinen Problemen genug zu tun«, antwortete Hussein.
Amir schien zu überlegen, bevor er weiterredete.
»Hast du schon mal etwas von Scheich Raghib Tair gehört?«
»Ich glaube ja, früher hat mir mein Vater von ihm erzählt. Er stammt, wenn ich mich richtig erinnere, aus derselben Gegend wie meine Familie.«
»Scheich Raghib Tair hat in Maarakeh in der Gegend von Sour gelebt. Er war ein Imam und einer der Führer unseres Freiheitskampfes im Südlibanon, ein sehr frommer Mann. Sie haben ihn umgebracht, als er gerade von einer Reise in den Iran zurückgekehrt war. Nachts haben ihm die Mörder von hinten drei Kugeln in den Kopf geschossen und seine Leiche vor die Tür seines Hauses gelegt.«
»Warum erzählst du mir das?«
»Weil Mojtaba der Sohn des Scheichs ist ...!«
Das Feldbett knarrte, als Amir sich mit dem Gesicht zur Wand drehte, um zu schlafen. Durch das Fensterloch fiel ein matter Schein auf seine Kalaschnikow, die er an das Kopfende seines Bettes gelehnt hatte. Bald schnarchte Amir vernehmlich.
Hussein lag noch lange Zeit mit geschlossenen Augen wach.
Flüchtige Bilder flackerten in seinem Gedächtnis auf, wie schlecht zusammengesetzte Filmsequenzen: die vom Sturm gefällte Kastanie vor der Hamburger Moschee – der Imam während der Freitagspredigt – die beiden Reporter in Hamburg – Miriam und Eva Fatima auf der Flugzeug-Gangway – feuerspeiende Geschützrohre auf dem Fernseh-Bildschirm und tote Frauen und Kinder – der Iman, der zu ihm sprach »Du mußt jetzt tapfer sein, Hussein ...«
Erst allmählich verblaßten die Bilder. Hussein Alir Bakir fiel zum erstenmal seit Tagen in einen tiefen, erschöpften Schlaf.
Wie Mojtaba es vorhergesagt hatte, wurde die Beerdigung am nächsten Tag zu einer Protestdemonstration der schiitischen Bevölkerung von Beirut gegen das Bombardement der amerikanischen Mittelmeerflotte. Mehr als vierzigtausend Menschen folgten den Särgen der auf dem Marktplatz getöteten Frauen und Kinder. Bewaffnete Einheiten der libanesischen Armee und Kämpfer der Amal-Miliz marschierten am Anfang und am Ende der Trauerprozession. In der Mitte rollten drei Mercedes-Militärlastwagen im Schrittempo. Auf den Ladeflächen lagen primitive, rombenförmige Holzsärge, von schwarzen Trauerfahnen bedeckt. Kleine handgeschriebene Zettel an den Stirnseiten nannten die Namen der darinliegenden Toten.
Die Särge von Miriam und Eva Fatima waren bereits zugenagelt gewesen, als Hussein und Mojtaba zum Ausgangspunkt des Umzuges im Armenviertel von Bir el Abed gekommen waren. Es sei besser, wenn die Särge geschlossen blieben, sagte ein Sanitäter des »Roten Halbmonds«, als Hussein fragte, ob er seine Frau und seine Tochter noch einmal sehen könnte. Die meisten Toten, fuhr der Mann fort, seien übel zugerichtet worden. Er händigte Hussein das rote Spielzeugköfferchen seiner Tochter aus, die Handtasche seiner Frau und auch ein Halskettchen, das man ihr abgenommen hatte.
Hussein klappte das goldene Herzchen auf, das an der Kette hing. Darin war ein winziges Foto. Es zeigte ihn und seine Frau mit der erst einige Wochen alten Tochter Eva Fatima. »Sie hat es immer getragen, Tag und Nacht«, sagte Hussein. Mojtaba nahm das Kettchen, legte es ihm um den Hals und machte den Schnappverschluß zu. »Damit du weißt, für wen du nun zu kämpfen hast!«
Während des Trauermarsches hielten sich Mojtaba, Amir, Belal und Toufik stets in Husseins Nähe. Der Weg führte aus der Vorstadt über die Küstenstraße in das Geschäftsviertel von West-Beirut, durch die Rue Hamra, an Bachoura vorüber und parallel zur »Grünen Linie« bis zu einem Pinienwäldchen an der Avenue du Novembre, in dem auf einer kleinen Grünfläche nebeneinander Gräber ausgehoben worden waren.
Über den Köpfen der marschierenden Menge wehten die grünschwarzen Fahnen der Amal und die schwarzen Flaggen der Hezbollah.
An der Küstenstraße verharrte der Zug eine Weile. Tausende von Fäusten und von Gewehren wurden drohend gegen das Meer erhoben, auf dem irgendwo hinter dem Horizont das Schlachtschiff »New Jersey« liegen mußte. Im Rhythmus, den Einpeitscher durch Megaphone vorgaben, skandierte die Menge immer wieder dieselben Schlachtrufe: »Tod den Amerikanern!« – »Tod den Zionisten!« – »Reagan ist ein Verbrecher!«
Aus der Gruppe der Hezbollah erscholl der Ruf »Chomeini ist unser Führer!« Im Zug wurden Transparente mitgeführt, auf denen der Kopf des amerikanischen Präsidenten zu einer teuflischen Fratze verzerrt war. Darunter stand: »Scheitan Bozorg« – »Der Obersatan!«
Frauen im Schador trugen vergrößerte Fotos im Goldrahmen mit sich, Bilder ihrer getöteten Angehörigen. Zehn- bis fünfzehn Jahre alte Jungen schleppten schwere Gewehre und lange Patronengurte. Vor den Gräbern im Pinienwäldchen warfen sich schwarzgekleidete Klageweiber, die ihre Gesichter mit Ruß beschmiert hatten, auf die Knie, schrien ihren Schmerz hinaus und trommelten mit bloßen Händen auf den steinigen Boden.
Als die Hinterbliebenen der Opfer rotbraune Erde auf die Särge schaufelten, durchbrachen zwei israelische Phantom-Düsenjäger die glasige Wolkendecke, die an diesem Tag über Beirut hing. Die Maschinen donnerten so tief über die Trauergemeinde hinweg, daß die Köpfe der beiden Piloten im Cockpit zu erkennen waren. In ohnmächtiger Wut feuerten Milizionäre einige hundert Kugeln aus amerikanischen und sowjetischen Gewehren in die Richtung, in der die Kampfflugzeuge längst wieder hinter den Wolken verschwunden waren.
Bei der Abschlußkundgebung in der Moschee von Bir el Abed sprach Scheich Fadlallah, den viele libanesische Schiiten für den Nachfolger des verschwundenen Imam Musa Sadr halten, persönlich das Totengebet. Fadlallah, ein imposanter, großgewachsener Mann mit dichtem Vollbart, trug zum langen schwarzen Gewand auch einen schwarzen Turban, der ihn als einen der direkten Nachkommen des Propheten Mohammed auswies. Als Fadlallah die Gläubigen zum Gebet aufrief, verbeugten sich Zehntausende gen Mekka. Es sah aus, als ob die Straßen mit menschlichen Körpern gepflastert wären.
Ein iranischer Mullah zitierte die Worte des Koran-Gelehrten und Revolutionärs Morteza Motahari: »Das Blut der Märtyrer ist nie verschwendetes Blut, denn jeder Tropfen dieses Blutes bringt Tausende frischer Tropfen hervor und dieses frische Blut wird wieder in den Körper der Gesellschaft gepumpt werden.«
Erst als die Veranstaltung beendet war, als die Menschen sich in alle Himmelsrichtungen zerstreuten, bemerkte Hussein, daß seine persönliche Trauer in der Masse verlorengegangen war. Er hatte sich von der Stimmung, von den Gesängen, vom kriegerischen Geschrei, vom Zorn der Zehntausende so sehr mitreißen lassen, daß er kaum noch an seine Frau und seine Tochter gedacht hatte. Als ihm das bewußt wurde, erschrak er.
Er ging am frühen Abend allein in die Moschee mit dem zerschossenen Minarett am Hezbollah-Quartier in Bachoura. Er betete für Miriam und Eva Fatima. Er bat Gott auch um Kraft und Tapferkeit für sein neues Leben, das nun beginnen sollte.
An diesem Abend noch, ungefähr zur selben Zeit, traf sich Mojtaba im Flughafengebäude des Beirut International Airport mit einem Mann, dem man erst bei genauer Beobachtung ansah, daß er sich gerade erst seinen Bart abrasiert hatte: einige Hautstellen an Wangen und Kinn waren blasser als die übrigen Gesichtspartien. Gelegentlich drückte er nervös mit Daumen und Zeigefinger auf seine Augen – die Kontaktlinsen, gegen die er seine gewohnte Hornbrille ausgetauscht hatte – irritierten ihn noch.
Mojtaba hätte den Transitpassagier allein schon deshalb kaum wiedererkannt, weil er ihn noch nie in einem gutsitzenden europäischen Anzug mit modischer Krawatte und elegantem Aktenköfferchen gesehen hatte.
»Du hast dich sehr verändert, Bruder«, sagte Mojtaba lächelnd, als der Mann sich ihm am verabredeten Treffpunkt vor dem »Duty Free Shop« im ersten Stock zu erkennen gegeben hatte. »Du siehst jetzt tatsächlich aus wie einer von diesen Halsabschneidern aus dem Ölgeschäft.«
Die beiden Männer setzten sich mit dem Rücken zur Wand unter einen der Lautsprecher, aus dem abwechselnd libanesische und internationale Popmusik rieselte, so daß es sehr schwer gewesen wäre, ihre Unterhaltung mitzuhören. Sie tauschten Informationen aus.
Mojtaba berichtete von der Massendemonstration am Vormittag in Beirut und daß die Hezbollah ihren Frontabschnitt an der »Grünen Linie« und ihren Einflußbereich in den südlichen Vororten weiter ausgedehnt hätte; von Anschlägen auf die letzten noch in den Randbezirken Beiruts stationierten Soldaten der israelischen Invasionsarmee und von andauernden politisch-religiösen Auseinandersetzungen mit der gemäßigten Amal-Partei.
»In letzter Zeit«, so erzählte Mojtaba, »laufen immer mehr Amal-Kämpfer zu uns über.«
Der frischrasierte Mann erzählte, er sei gerade in Teheran und in Damaskus gewesen.
»Die Syrer und Iraner werden uns wieder mehr Leute und mehr Waffen schicken. Ich habe gesagt, daß wir genug Koran-Lehrer haben, was wir brauchen, sind Ausbilder für unsere neuen Kämpfer.«
Mojtaba nickte.
»Wie nennst du dich denn jetzt?« fragte er.
»In meinem kuwaitischen Paß steht Omar Fahredi.«
»Warst du in Kuwait?«
»Da komme ich gerade her. Unsere Brüder in den Gefängnissen dort werden ungeduldig. Sie erwarten, daß wir sie herausholen. Du weißt, einige von ihnen hat man wegen der Bombenanschläge im letzten Dezember zum Tode verurteilt. Es wird Zeit, daß wir eine Aktion starten, die aller Welt klarmacht, wozu wir in der Lage sind, ähnlich wie bei den Bombenanschlägen gegen die Amerikaner in Beirut.«
»An was für eine Aktion denkst du?« fragte Mojtaba.
»Ich weiß noch nichts Genaues, aber die Palästinenser haben große Erfolge mit Flugzeugentführungen gehabt.«
»... was man von unseren Aktionen nicht sagen kann«, warf Mojtaba ein.
»Wen interessiert denn in Europa oder in Amerika schon, wenn wir Maschinen aus Jordanien oder aus dem Nahen Osten entführen?« sagte der Mann, der sich Omar nannte. »Wir müssen uns auf amerikanische oder israelische oder deutsche Linienmaschinen konzentrieren, auf Flugzeuge, in denen amerikanische oder israelische Passagiere sitzen. Wir brauchen Geiseln, wenn wir weltweites Interesse für unseren Kampf bekommen wollen.«
Nach einer Weile fuhr er fort: »Unser Problem ist, daß wir zwar genug Leute haben, die mit der Kalaschnikow und mit Sprengstoff umgehen können, aber zu wenig, die intelligent genug sind für die Leitung solcher Unternehmen, die ein, zwei Fremdsprachen sprechen und sich im Ausland unauffällig und selbstsicher bewegen können.«
Mojtaba überlegte, dann sagte er: »Ich hätte da vielleicht jemanden ...«
Er erzählte von Hussein aus Hamburg, der jetzt nach Beirut zurückgekommen sei, um den Tod seiner Frau und seiner Tochter zu rächen. »Er spricht Englisch und Deutsch perfekt, und er war schon ein erfolgreicher Geschäftsmann; er kennt sich im Ausland aus, aber er hat noch keine Kampferfahrung. Wir müßten ihn ausbilden.«
»Würdest du deine Hand für ihn ins Feuer legen?«
»Ja!«
»Wie alt ist er?«
»Sechsundzwanzig.«
»Wäre er bereit, für unsere Sache zu sterben?«
»Ich glaube ja – wenn er darauf vorbereitet wird.«
»Gut«, sagte Mojtabas Gegenüber, »dann bring ihn nach Baalbek. Laß ihn in unserem Lager ausbilden und stell ihn auf die Probe. Er muß sich erst bewähren, bevor wir ihm solche Aufgaben anvertrauen können, von denen wir gesprochen haben.«
Lautes Knacken im Lautsprecher über ihren Köpfen unterbrach ein trauriges libanesisches Lied, in dem das Sterben von Beirut besungen wurde. Eine Ansagerin rief auf arabisch, englisch und griechisch den Flug nach Athen auf.
»Wie lange, glaubst du, wird er brauchen?« fragte Omar.
»Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr«, sagte Mojtaba.
»Ich werde unseren Brüdern in Athen und in New York sagen, daß sie sich Gedanken über eine geeignete Aktion machen sollen.«
Der Mann, der sich Omar nannte, zeigte am Ausgang 2 des Beiruter Flughafens ein Ticket der Middle East Airlines nach Athen vor mit einem bereits angehefteten roten Flugschein der amerikanischen Gesellschaft TWA für den Weiterflug über Rom nach New York. In seinem abgenutzt aussehenden Paß, der ihn als Bürger des Scheichtums Kuwait auswies, war ein sehr echt wirkendes Visum für die Vereinigten Staaten von Amerika eingestempelt. Als er Mojtaba zum Abschied umarmte, sagte der Mann: »Allah schütze dich.«
»Friede sei mit dir.«
Mojtaba ließ Hussein Zeit, sich an sein neues Leben und an seine neuen Freunde zu gewöhnen. Amir und Toufik nahmen ihn mit an die Front von Bachoura. Sie zeigten ihm die Maschinengewehrstellungen in den zerstörten Häusern an der Barrikade, sie ließen ihn mit dem M 16-Gewehr und der Kalaschnikow auf Stellungen der Heckenschützen der christlichen Miliz schießen.
Hussein gewöhnte sich schnell wieder an den Umgang mit den Waffen, an denen er als 16jähriger Pfadfinder ausgebildet worden war. Nach ein paar Tagen zielte er auf einen christlichen Milizionär auf der anderen Seite der Barrikade, der mehr als 300 Meter entfernt war. Hussein schoß dreimal. Sie hörten einen schnell ersterbenden Schrei, und kurz darauf sahen sie Gestalten, die einen leblosen Körper hinter sich herschleiften. Seine neuen Kameraden gratulierten ihm überschwenglich zu seinem offenbar tödlichen Treffer.
Ein anderes Mal gelang es ihm mit der Bazuka, der russischen Panzerfaust, ein ganzes Stockwerk mit einer Maschinengewehrstellung der Kataib-Miliz in Trümmern zu schießen. Es war ein Zufallstreffer, denn mit dem unhandlichen Gerät war es schwer, genau zu zielen. Er hatte das Abschußrohr ungefähr in Richtung der feindlichen Stellung gehalten, gefeuert und war wieder in Deckung gesprungen. In der Stellung der Christen, so erfuhren sie am nächsten Tag, hatte es zwei Tote und vier Schwerverletzte gegeben.
Manchmal wunderte sich Hussein selbst, wie schnell er den Übergang in sein neues Leben schaffte. Nicht einmal das Töten ging ihm nahe.
Er versuchte, nicht daran zu denken, ob seine Opfer Frauen und Kinder gehabt hatten wie er.
Er war im Krieg, er war jetzt Soldat. Er brauchte keine Entschuldigung, vor sich nicht und nicht vor anderen.
Und dennoch wollte er manchmal allein sein und über sein radikal verändertes Leben nachdenken. Dann schulterte er seine Kalaschnikow und schwang sich auf eine alte 250er Honda, die er von seinem letzten Bargeld aus Hamburg gekauft hatte. Er fuhr durch die bizarre Trümmerlandschaft des östlichen Teils von West-Beirut zu einer Landzunge an der St. Georges-Bucht, an eine Stelle, an der er als Schuljunge oft gesessen hatte, um die ein- und auslaufenden Schiffe zu beobachten.
Niemand hätte in dem bewaffneten Motorradfahrer noch den aufstrebenden jungen Geschäftsmann aus Hamburg wiedererkannt. Mit seinem Stoppelbart, mit der gefleckten Armeekampfjacke und den speckigen Jeans, die durch den roten Staub, durch Öl- und Dreckflecke eine undefinierbare Farbe angenommen hatten, mit der Kalaschnikow und dem breiten Patronengurt, der lässig um seine Taille hing, sah Hussein Ali Bakir aus wie die meisten anderen schiitischen Kämpfer auch – als gehöre er schon jahrelang dazu. Er setzte sich in das hohe Unkraut, das nach Kamille duftete, und starrte über die Fischerboote hinweg, die in der Ufernähe dümpelten, auf das Meer hinaus.
Er versuchte, sich darüber klarzuwerden, wofür er kämpfte und wogegen. Was war das Ziel des Hasses, den er in sich spürte, seit er die Nachricht vom Tod seiner Frau und seiner Tochter erhalten hatte?
Seine Augen versuchten vergeblich, irgendwo am Horizont das amerikanische Schlachtschiff »New Jersey« auszumachen. Er fragte sich, was das für Männer waren, die die Geschütze bedienten? Wer hatte ihnen den Befehl zum Bombardement gegeben? Die Offiziere? Ein Admiral? Oder der amerikanische Präsident selbst?
Hussein warf ein paar Steine ins Wasser. Während Möwen dort, wo die Steine versunken waren, vergeblich nach Beute tauchten, suchte er Antworten auf seine Fragen. Er kam endlich zu dem Schluß: der Präsident selbst mußte den Beschuß von Beirut befohlen haben. Präsident Ronald Reagan war schuld am Tod von Miriam und Eva Fatima ... Aber nicht nur er, sondern alle, die ihn gewählt hatten, und auch alle, die nicht verhinderten, was seine Politik anrichtete.
Er würde sich an allen rächen. An allen Amerikanern.
Gott, so dachte Hussein, werde ihm beistehen – denn hatte er nicht allen Menschen gerechten Lohn und gerechte Strafe versprochen?
Er fühlte sich erleichtert, als er kurz vor Sonnenuntergang zurück in die zerbombte Stadt fuhr, zurück in die stickige Enge des Hezbollah-Quartiers von Bachoura.
»Wo bist du solange gewesen?« fragte Amir, als Hussein sein Motorrad auf dem Hof abstellte. »Mojtaba wartet schon auf dich.«
Mojtaba erklärte ihm bei Essen, er solle gemeinsam mit Belal zum Koran-Unterricht und zur politischen Schulung in die halbzerstörte Moschee neben dem alten Friedhof gehen. Ein Imam werde dort über die islamische Revolution im Iran und im Nahen Osten sprechen.
Der Geistliche sprach über den Heiligen Krieg zwischen den von Israel und Amerika unterstützten Christen und den Moslems im Libanon. Hussein brauchte einige Zeit, um die komplizierten Schilderungen über die Auseinandersetzungen zwischen moslemischen Sunniten, Drusen und Schiiten im Libanon zu verstehen.
»Das hat nichts mit unserem Glauben zu tun«, erklärte der Imam, »es geht um soziale und machtpolitische Konflikte: die Sunniten sind immer die reichen Leute im Libanon gewesen, und die Schiiten waren immer die armen, unterdrückten Bauern.« Zu vergleichen sei der Kampf dieser beiden großen islamischen Fraktionen mit dem Bürgerkrieg der Katholiken gegen die Protestanten in Nordirland.
Wie die Streitigkeiten und Kämpfe innerhalb der Schiiten zu erklären seien, wollte Hussein wissen.
»Wie du weißt, verehren alle Schiiten im Libanon den verschwundenen Imam Musa Sadr – Friede sei mit ihm –, der vor Jahren nach Libyen gereist ist und nie wieder lebend gesehen wurde. Musa Sadr hatte die Amal als religiös-politische Organisation der Schiiten gegründet. Aber unter seinem Nachfolger, Nabih Berri, ist die Amal zu einer politischen Gemeinschaft verkommen und hat unsere religiösen Ziele verraten. Wir aber«, so fuhr der Imam fort, »wir kämpfen für eine islamische Revolution im Libanon, so wie sie Ayatollah Chomeini im Iran vollbracht hat. Deshalb auch ist Chomeini unser Vorbild und unser Führer. Deshalb haben wir die Hezbollah gegründet, die Partei Gottes.«
Im Koran-Unterricht in der Moschee hörten Hussein und seine Mitschüler Kassetten mit den Lehren und Predigten des Ayatollah Chomeini.
Der Imam wies seine Schüler besonders auf eine Rede hin, in der Chomeini über das »Quital« sprach, das »Töten im Namen Allahs«. Die Stimme des Ayatollah erklang aus dem Lautsprecher: »Brüder, sitzt nicht zuhause, so daß der Feind angreifen kann. Geht zur Offensive über und seid gewiß, daß der Feind sich zurückziehen wird ... Vergeßt nicht, daß Töten auch eine Form der Gnade ist. Es gibt Übel, die nur geheilt werden können, indem man sie ausbrennt!«
Als Hussein später Mojtaba nach dem Sinn dieser Worte fragte, antwortete der, dies sei als Befehl an alle gläubigen Moslems zu verstehen, die Feinde des Islam und deren Verbündete mit aller Macht aus der arabischen Welt zu vertreiben: die Israelis aus Palästina und dem Libanon, die Amerikaner aus dem Libanon und allen Ölstaaten, und die Sowjets aus Afghanistan. »Dafür kämpfen wir«, sagte Mojtaba, »und du bist durch dein Schicksal auserwählt, mit uns zu kämpfen.«
Am Ende seines ersten Monats in Beirut teilte Mojtaba Hussein eher beiläufig mit, daß sie in ein oder zwei Wochen gemeinsam nach Baalbek ins Bekaa-Tal fahren würden. »Ich habe dort zu tun, und du sollst in Baalbek zum heiligen Krieger ausgebildet werden!«
Vorher müßten er selbst und Amir jedoch noch ein Kommandounternehmen im Süden ausführen. Hussein fragte, ob er mitkommen könne, erhielt aber von Mojtaba die Antwort, dafür sei es noch zu früh.
Drei Tage nach der Abreise der beiden saß Hussein in dem schmuddeligen »Café Raphael« und blätterte in dort ausliegenden zerfledderten Zeitungen.
In einer alten Ausgabe der französischen Zeitung »Le Monde« entdeckte er einen Artikel über die verworrene Situation im Libanon, der überschrieben war: »Wer sind Allahs heilige Krieger?« Hussein las:
»Eine Geheimorganisation, die sich Dschihad Islam – Islamischer heiliger Krieg – nennt, kämpft im Libanon und im gesamten Nahen Osten für eine Revolution nach dem Vorbild des Umsturzes im Iran.
Mut, religiöser Fanatismus und skrupelloser Terror haben die Kämpfer Gottes zu den gefürchtesten Gegnern der militärisch übermächtigen Israelis und der Amerikaner werden lassen. Selbstmord-Kommandos des Dschihad Islam jagten mit Autobomben die amerikanische Botschaft und das US-Marinehauptquartier in Beirut in die Luft und die Unterkünfte der israelischen Armee im immer noch besetzten Süden des Libanon. Kommandos des Dschihad Islam überfielen Militärpatrouillen, legten Minen, entführten Flugzeuge. Mehr als fünfhundert Tote gehen bereits auf das Konto der überall und nirgends auftauchenden Heiligen Krieger ...«
Hussein riß diesen Artikel heraus, faltete ihn sorgfältig zusammen und steckte ihn in die Tasche seiner Armeejacke. Ein Zeitungsjunge brachte die neueste Ausgabe der größten Beiruter Zeitung »An Nahar« in das Café. Auf der ersten Seite fiel Hussein eine Meldung ins Auge. Die Überschrift lautete: »Selbstmordkommando sprengt israelischen Militärkonvoi.« Der Fahrer eines mit Sprengstoff beladenen blauen Mercedes-Pkws, so hieß es, sei in der Nähe der Stadt Sour in eine Patrouille der israelischen Besatzungsarmee gerast. Er habe sich selbst in die Luft gejagt und fünf israelische Soldaten getötet, die in drei Jeeps gesessen hätten. Während der Verwirrung, die dem Bombenanschlag folgte, hätten Scharfschützen aus einem Hinterhalt zwei weitere Israelis erschossen und mehrere schwer verletzt. Die Meldung endete: »Mit einem Anruf, der im Beiruter Büro der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press einging, bekannte sich die Organisation Dschihad Islam zu dem Anschlag.«
Zwei Tage später kamen Mojtaba und Amir spätabends zurück. Als sie den großen Aufenthaltsraum des Hezbollah-Quartiers betraten, standen die anderen Männer auf und klatschten Beifall. Mojtaba und Amir sahen erschöpft aus. Amirs linker Arm war verbunden. Als sie allein auf ihrem Zimmer waren, fragte Hussein, was passiert sei.
»Die Verletzung ist harmlos«, sagte er, »nur eine Fleischwunde von einem Streifschuß. Es hat stark geblutet, aber diesmal hätten sie uns beinahe erwischt.«
Hussein sah ihn fragend an.
»Habt ihr die israelische Patrouille bei Sour überfallen?«
Amir befühlte seinen bandagierten Arm und nickte. »Danach sind wir in eine Straßenkontrolle der Israelis geraten. Sie hatten das ganze Gebiet abgesperrt. Wir mußten in die Berge flüchten und uns verstecken. Deshalb hat es so lange gedauert.«
»In der Zeitung stand, der Dschihad Islam habe sich zu dem Anschlag bekannt. Seid ihr der Dschihad Islam, Mojtaba und du und die anderen?«
»Den Dschihad Islam gibt es nicht«, antwortete Amir, »wir gehören manchmal dazu, wir und viele von denen, die du hier kennengelernt hast.«
»Wer hat das Sprengstoff-Auto gefahren?« erkundigte sich Hussein.
»Den kennst du nicht. Ein siebzehnjähriger Junge aus Tyros. Murschid hieß er. Er war ein tapferer Kerl. Er hat gesungen und gebetet, als er mit Vollgas in den Tod gerast ist.«
Hussein versuchte gleichgültig zu bleiben, doch der andere bemerkte Angst, aber auch Bewunderung in seinen Augen.
»Der Junge hat es geschafft«, sagte Amir, »der ist jetzt im Paradies!«