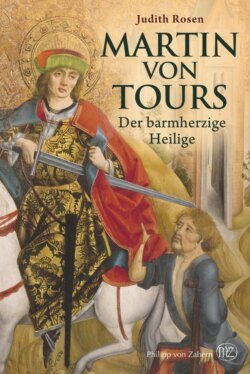Читать книгу Martin von Tours - Judith Rosen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|36|Der Mönch Brictius, der Historiker Babut und die Matrone Foedula
ОглавлениеZu den Gegnern Martins in seinem engsten Umfeld gehörte der Diakon und spätere Priester Brictius (370–444).62 Er warf seinem Bischof „haltlosen Aberglauben, eingebildete Visionen und lächerliche Narreteien“ vor. Während Sulpicius den Namen des Kritikers und seine bösen Vorwürfe in der Martinsvita verschwieg, ließ er im dritten Dialog den Martinsschüler Gallus eine hässliche Szene berichten, die sich in dem kleinen Hof vor Martins Klosterzelle in Marmoutier abgespielt hat: Martin saß dort gern, „wie ihr alle wisst“, auf einem Holzstuhl. Zornbebend stürzte Brictius eines Tages in den Hof und fiel über Martin her. Er beschimpfte ihn grob und schrie ihm seine angeblichen Sünden ins Gesicht:63 Dabei wurde Brictius selbst von vielen beschuldigt, er verschaffe sich nicht nur Pferde und Sklaven aus dem Barbarenland, sondern auch hübsche Mädchen. Als Gipfel der Verfehlungen hielt Brictius seinem Bischof vor, dass er sein früheres Leben mit seinem Soldatenstand befleckt habe. Im Übrigen sei er, Brictius, heiliger als Martin, weil dieser ihn von Kindheit an in seinem Kloster aufgezogen habe. Welche Gründe trieben den Ziehsohn Martins zu seinem Ausbruch? Am Vortag war er von Martin aus unbekannten Gründen ausgeschimpft worden. Der Erzähler Gallus gab zu bedenken, Martin aber von Beginn an den eigentlichen Grund für Brictius’ Wutausbruch erkannt: Zwei Dämonen hätten den jungen Mann verführt. Martin habe so lange gebetet, bis die bösen Geister von ihrem Opfer abgelassen hätten und Brictius reumütig zu seinem Lehrer zurückgekehrt sei und um Verzeihung gebeten habe. Besonders beschämend war, dass Brictius von Martin großzügig gefördert worden war und er es unter seiner Obhut zum Kleriker gebracht hatte.
Es sollte nicht die einzige Kontroverse bleiben, die Lehrer und |37|Schüler miteinander austrugen. Der Mönchsvater sah von Sanktionen ab und entzog zum Erstaunen der Mitbrüder dem renitenten jungen Mann nicht einmal die priesterliche Würde. „Wenn Christus den Judas geduldig ertragen hat, warum soll ich den Brictius nicht ebenso ertragen?“, erklärte Martin sein barmherziges Verhalten.
Auch in den Dialogen blieb Sulpicius seiner Erzählstrategie treu und bettete Vorwürfe gegen Martin in eine wundersame Geschichte, die den Angriffen ihre Berechtigung nahm. Der „schwarze Peter“ lag beim Kritiker Brictius, der seine Emotionen nicht zu kontrollieren vermochte. Doch selbst der maßlose Kritiker, immerhin Martins Pflegekind, musste entlastet werden. Und wer konnte ein besserer Sündenbock sein als zwei Dämonen, über die der betende Bischof die Oberhand behielt?
Bereits im ersten Dialog zitierte Sulpicius die Stimme eines anonymen „Unglücklichen“, den er als „Mensch mit diabolischer Stimme“ diffamierte. Handelte es sich auch an dieser Stelle um Brictius, der zudem frech behauptete, in der Martinsvita werde es mit der Wahrheit nicht allzu genau genommen?64 Der Biograph verfolgte wie in der „Hofszene“ die bewährte Verteidigungsstrategie: Aus dem Ankläger spreche der Teufel. Denn Martins Wundertaten leugnen sei dasselbe, als wolle man Christi Wunder in den Evangelien bezweifeln.65 Nach diesem hoch gegriffenen Vergleich verunglimpfte Sulpicius’ Gesprächspartner Postumianus die Feinde Martins: „Unglücksraben, erbärmliche Wichte und Schlafmützen“ seien sie, Männer, die vor lauter Scham einen roten Kopf bekämen, weil Martin ihnen ihr Unvermögen vor Augen geführt habe.
Sulpicius bezog mit den Schlusskapiteln des ersten und dritten Dialogs wie schon am Ende der Vita Stellung in einer aktuellen Auseinandersetzung, die vor allem den Bischofsstuhl von Tours betraf. Ausgerechnet Brictius war zu Martins Nachfolger gewählt worden, und das auf dessen Empfehlung und Gebet.66 Zu Beginn seiner Amtszeit kehrte er mit eisernem Besen durch Stadt und Kloster, überwarf sich mit den Weggefährten Martins und tyrannisierte |38|dessen Schüler, die sich keinen anderen Rat wussten, als sich zu Sulpicius nach Primuliacum zu flüchten. Nach diesen Erfahrungen ist es verständlich, dass Sulpicius seinen Mitunterredner Postumianus im dritten Dialog wenig Gutes über Brictius sagen ließ: „Denn obwohl er klug ist, denkt er weder an die Gegenwart noch an die Zukunft. Die erbarmungswürdige Lage des Menschen ist zu bedauern.“ Auch spreche er, Postumianus, nicht als sein Feind, sondern als sein Freund und hätte nichts lieber, als dass er sich Martin angliche.67 Sulpicius rechnete offensichtlich damit, dass der Gescholtene über kurz oder lang den Dialog in Händen halten und merken werde, dass der Autor Insiderwissen verarbeitet hatte. Aus Freundschaft habe Postumianus Kritik geübt, damit Brictius seine tyrannischen Allüren ablege und dem großen Vorbild Martin nacheifere. Auch Sulpicius eiferte Martin nach: Er wollte Frieden stiften zwischen dem kindisch handelnden Brictius und den Martinsanhängern in seiner Kommunität.
In der umfassenden Einleitung zu seiner Sulpiciusausgabe überschrieb der Althistoriker Fontaine seinen Überblick über die verschiedenen Martinsbilder: „Die Martinsfrage von Brictius bis Babut“. Ausführlich diskutierte der Verfasser die Glaubwürdigkeit der Vita und schlug zu Recht eine Brücke von Brictius zu Babut, dem schärfsten modernen Martinskritiker. Zwar wurde seit dem Humanismus und der Reformation die Glaubwürdigkeit des Sulpicius immer wieder in Zweifel gezogen, vor allem in Zeiten, in denen Wundergläubigkeit und Heiligenverehrung allgemein abgelehnt wurden. Doch erst Babut versuchte 1912 den Nachweis, Martin sei von Kopf bis Fuß ein literarisches Produkt des Sulpicius. Er habe dem Bischof von Tours einen Heiligenschein verpasst, den dieser zu Lebzeiten nie verdient habe. Der Biograph berichte zum Großteil erfundene Wundergeschichten eines unbedeutenden Landbischofs, der ohne ihn bereits im Altertum in Vergessenheit geraten wäre. Babut unterstellte Sulpicius Hochstapelei (imposture) und ein Lügengeflecht (tissu de contes mensongers) |39|und stimmte den zeitgenössischen Kritikern des Biographen und des Bischofs zu: Sulpicius könne man nichts glauben, und seine Wahrheitsbeteuerungen seien wertlos.68 Ein Jahr nach dem Erscheinen von Babuts Saint Martin de Tours veröffentlichte Pater Hippolyte Delehaye, der bedeutende Erforscher der christlichen Hagiographie im Kreis der Bollandisten und Mitherausgeber der Acta sanctorum, eine Replik auf Babuts Versuch der Entmystifizierung der Martinsvita.69 Babut, der im Ersten Weltkrieg gefallen war, sprang postum 1921 der Mediävist Marc Bloch bei, den die Gegenargumente Delehayes nicht überzeugt hatten.70 An Babut schieden sich fortan die Geister. Seine Behauptung, Sulpicius habe aus der lateinischen Übersetzung der Vita Antonii des Athanasius einzelne Abschnitte auf Martin übertragen, hat Delehaye in einer sorgfältigen Analyse widerlegt.71 Ein eher sachlicher Streitpunkt war die Chronologie, die Sulpicius für Martins Leben bis zur Bischofsweihe bot. Den Biographen trieb der Wunsch, Martins Hinwendung zum Christentum schon in frühen Jugendjahren beginnen zu lassen und dementsprechend die Dauer seiner Militärzeit herabzuspielen. Aus diesem Grund übernahm er wohl widersprüchliche Angaben aus Martins späterer Umgebung.
Ein Kernproblem sind die Wundergeschichten, vor allem die Totenerweckungen.72 Babut zufolge hat sich Sulpicius besonders die Apostelgeschichte und noch intensiver die apokryphen Apostelakten zum Vorbild genommen. In diesen Schriften gelten Totenerweckungen als Beweis der Apostolizität. Um seinen Vergleich zu rechtfertigen, argumentiere Sulpicius: Martin werde von allen anderen als „wahrhaft apostolisch“ (vere apostolicus) angesehen.73 Bei den Wunderheilungen neigte Bloch eher Delehaye zu, der Martin tatsächlich Wunderkraft zubilligte.74
Fontaine entschied sich für eine salomonische Rolle. Um ein rechtes Maß zwischen der früheren blinden Gläubigkeit und der modischen Hyperkritik zu finden, zitierte der Kommentator den besten Kenner des römischen Gallien, Camille Jullian: „Alles glauben wie |40|man das früher getan hat, war sehr bequem; alles ablehnen, wie man das heutzutage oft tut, ist nicht weniger bequem.“75 In seinen Notes Gallo-romaines, die zwischen 1910 und 1923 erschienen und in seiner Histoire zusammengefasst wurden, suchte der Historiker den Mittelweg zu gehen und arbeitete bei Sulpicius die historischen Fakten jenseits der hagiographischen Überhöhung Martins heraus.
In seinem Kommentar von 1000 Seiten ging Fontaine noch einen Schritt weiter und unterschied vier Kategorien von Wundern: eine „evangelische“, die dem Vorbild der Evangelien folgte. Dazu gehörten Totenerweckungen, Heilungen und Exorzismen. Es handle sich um „objektive“ Wunder, die am schwersten zu bestreiten seien. Die zweite Kategorie umfasste solche Wunder, deren Ursache ein simples Ereignis war, von Martins Umgebung zu einem Wunder stilisiert und von Sulpicius in eine literarische Form gegossen. Die dritte Kategorie, die sich von der zweiten nicht scharf trennen lässt, sind folkloristische Wunder: Eine populäre Erzählung wurde auf Martin übertragen. Schließlich die vierte Kategorie: Es handelt sich hier um pure literarische Erfindungen, die Martin angedichtet wurden.76 Die vier Kategorien müssen im Einzelnen geprüft werden, doch kommt Fontaine zu dem Schluss: „Es scheint vernünftig zu sein, die Authentizität eines beträchtlichen historischen Kerns zu verteidigen, eingeschlossen die Wunderberichte, die bisher am meisten verdächtigt wurden.“77
Jüngere Monographien zu Martin und Sulpicius Severus wie die von Stancliffe und Ghizzoni gingen eher wieder einen Schritt hinter Fontaine zurück: Die Heilwunder des Arztes Martin sind am ehesten glaubwürdig: zumal nach modernem Verständnis psychologische Erkenntnisse zu ihrer Erklärung beitragen. Schwieriger einzuordnen sind Martins Begegnungen mit Dämonen. Denn sie entspringen dem Teufelsglauben seiner Zeit. So bekräftigte Stancliffe: „Wir ziehen es vor, unsere ganze Aufmerksamkeit auf eine natürliche Ursache zu konzentrieren; und selbst wenn wir nicht wissen, wie eine solche Ursache wirkt, nehmen wir ihre Existenz |41|an.“78 Die Autorin weigerte sich also, aus Unkenntnis der natürlichen Ursache auf ein Wunder zu schließen. Loyen dagegen schob zwar der Hoffnung auf Erkenntnis keinen Riegel vor, bürdete aber die Entwirrung des Knäuels der nachfolgenden Wissenschaftlergeneration auf: „Vielleicht werden unsere Enkel in diesen komplexen Problemen klarer sehen.“79 Zur Lösung beitragen könne eine vergleichende Religionsgeschichte, welche die Thaumaturgie in anderen Kulturen untersuche.80 Fast verärgert verwarf Gnilka diesen hilflosen Rationalismus.81 Eine gelassenere Beurteilung des Wunderproblems bietet der von J. Pichler herausgegebene Sammelband.82
Mit den anspruchsvollen Überlegungen der Wissenschaftler belasteten sich Martins Zeitgenossen weniger. Eine Zeit, die noch an übernatürliche Kräfte, rätselhafte Vorgänge und wundersame Rettung glaubte, war eher bereit, Wunder zuzulassen. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge, und er ist wohl auch die Voraussetzung, dass Wunder überhaupt geschehen können.
In der Vienner Kirche St. Petrus bei Lyon wurde ein Grabstein aus der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts gefunden.83 Im oberen Teil umrahmen zwei Palmzweige und zwei Tauben eine crux ansata, ein Henkelkreuz, das sich aus den griechischen Buchstaben XP, der Abkürzung für Christus, zusammensetzt. Die Symbole weisen den Grabstein als christlich aus. Gesetzt wurde er für eine Matrone namens Foedula. Sie scheint in guten Verhältnissen gelebt zu haben, denn ein Grabstein, in den Symbole und mehrere Zeilen Widmung eingeritzt wurden, war kostspielig. Foedula und ihren Erben war die Botschaft der Inschrift, die in elegischen Distichen gefasst ist, offensichtlich so wichtig, dass sie viel Geld dafür ausgaben:
Foedula, welche die Welt unter dem Erbarmen Gottes verlassen hat,
liegt in diesem Grab, das ihr der nährende Glaube bereitet hat.
Einst unter der Rechten des edlen Martin getauft,
hat sie ihre Sünden abgelegt und ist im Quell Gottes neu geboren worden.
|42|Während ihr nun die Märtyrer den geeigneten Platz bereiten,
verehrt sie die edlen Gervasius und Protasius.
Durch diese Grabinschrift hat sie die verdiente Ruhe gewonnen.
Sie, die in der Gemeinschaft der Heiligen hier liegt,
hat ihren Glauben bekannt.
Jedem Besucher ihres Grabes bekannte Foedula ihren Glauben, der sie in ihrem irdischen Leben genährt und begleitet hatte. Ebenso wichtig wie der Glaube war ihr das Zeugnis, wer sie getauft hatte: der edle (procer) Martin. Mit dem eingängigen Bild „unter seiner Rechten“ deutet sie an, wie zu ihrer Zeit noch getauft wurde: Der Taufbewerber wurde völlig untergetaucht. Wären Martins Berühmtheit, sein Charisma und auch seine Wundertaten lediglich das literarische Konstrukt eines Beifall heischenden Autors gewesen, hätte sich Foedula mit den zwei ebenfalls edlen Märtyrern Gervasius und Protasius, die sie im Anschluss nannte, zufrieden gegeben. 386 hatte Bischof Ambrosius von Mailand die Gebeine der beiden Märtyrer gefunden, mit ihnen eine Kirche geweiht und die Verehrung der beiden Blutzeugen in Gallien angeregt. Aus der Korrespondenz des Bischofs Paulinus von Nola ist bekannt, dass er vor seiner Taufe, also vor 389, Martin in Vienne begegnet ist.84 Daher hat Martin der Matrone Foedula wahrscheinlich die Taufe zwischen 387 und 388 in Vienne gespendet. Der Grabstein ist nicht nur ein steinernes Zeugnis für die tiefe Verehrung, die Foedula für den Bischof von Tours empfand, den sie wie die beiden Märtyrer zu ihrem Fürsprecher im Himmel ausgewählt hatte, sondern er belegt auch, dass Martin außerhalb seiner Diözese Tours bekannt war und missionierte. Zwischen Tours und Vienne liegen immerhin mehr als 500 Kilometer.
Historiker freuen sich über sogenannte „Überreste“ wie Inschriften. Gehören sie doch zu der Gruppe von Quellen, die im Gegensatz zu vielen schriftlichen Zeugnissen, historischen Werken oder auch Viten, das historische Geschehen unmittelbar abbildet. Sie sind ob jektiv. |43|Da die Grabinschrift der Foedula eine Glaubensbotschaft vermittelte, also nicht völlig absichtslos in den Stein gemeißelt wurde, gehört ihr Grabstein zu der Sondergruppe der Monumente. Er ist das wirksamste Mittel gegen eine Hyperkritik wie die von Babut. Belegt er doch, dass Martins Ruf weder eine bloße Erfindung seines Bewunderers Sulpicius war noch sich auf einen engeren Schülerkreis in seiner Diözese beschränkte.
So ist die Grabinschrift der frommen Matrone Foedula die erste und unverdächtige Erwähnung des heiligen Martin. Ungewollt ist sie ein frühes Beispiel für seine spätere Verehrung in ganz Gallien und darüber hinaus. Für die nicht weiter bekannte Frau aus Vienne war das, woran Gelehrtengenerationen zweifelten und zweifeln, Wirklichkeit.