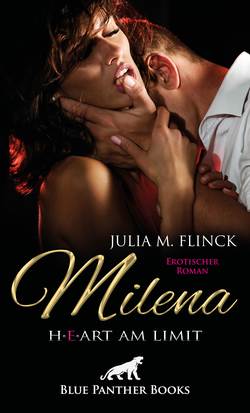Читать книгу Milena - Heart am Limit | Erotischer Roman - Julia M. Flinck - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. Dinners for Two
Ein paar Wochen später fragte Ben: »Was machst du eigentlich im Sommer, wenn ich in Urlaub fahre?«
Wir lagen gerade entspannt im Bett, er auf dem Rücken und ich in seinem Arm, den Kopf auf seiner Brust.
»Leiden und still vor mich hinschmachten«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
Das Ganze lief allmählich gefährlich aus dem Ruder. Wie war das bei anderen Frauen? Ich hatte ja keinerlei Erfahrung mit Affären. Zogen andere Frauen einen Schlussstrich, bevor sie zu tief im Schlamassel hingen? Oder wanderten die meisten ebenso am Rande des Abgrunds wie ich?
»Du müsstest mal mit mir zusammen in Urlaub fahren«, unterbrach Ben diesen beunruhigenden Gedanken, »spätestens am dritten Tag würdest du mich anflehen ›Bitte-bitte, nicht!‹, damit ich dich nicht totficke.«
Ich hob den Kopf und grinste ihn an. »Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher …«, murmelte ich und begann, an seiner Brustwarze zu spielen.
Zuerst umkreiste ich sie mit der Zunge. Dann knabberte ich sanft an ihr. Vibrierte mit den Zähnen, biss ganz zart in die Warze hinein und zog genüsslich daran.
Er stöhnte auf, konnte kaum stillhalten. »Du hast recht«, stieß er mühsam hervor, »ich bin mir wirklich nicht so sicher …«
Während mein Mund sich weiterhin mit seinen Brustwarzen beschäftigte, nahm ich mein Lieblingsspielzeug in die Hand und fing an, es zu streicheln und zu massieren. Es dauerte nicht lange, bis ich das gewünschte Ergebnis erzielt hatte.
»Du weckst Tote auf …«, murmelte Ben gequält.
»Gefällt es dir nicht?«
»Schon. – Aber du bist eine Nymphomanin.«
»Bin ich nicht.«
»Doch. Du willst immer.«
»Mein Lieber, eine Nymphomanin schläft mit jedem – ich dagegen will nur ständig mir dir schlafen. Das ist ein großer Unterschied.«
»Ist es nicht – Jesus, Maria …«
Wir diskutierten noch ein wenig über Nymphomaninnen. Aber letztendlich bekam ich doch meinen Willen.
Als wir danach noch eine Weile beieinanderlagen und ich ihn wieder streichelte und liebkoste, beschwerte er sich: »Ständig hast du deine Hände irgendwo bei mir oder fummelst an mir herum!« Vermutlich befürchtete er, dass ich noch nicht genug hatte und gleich noch ein drittes Mal wollte.
»Ich fummle nicht«, gab ich zurück, »man nennt das Zärtlichkeit. Und stell dir vor, man kann das genießen! Ich zum Beispiel brauche das.«
»Du sollst dich nicht zu sehr an mich gewöhnen. Hol dir deine Streicheleinheiten zu Hause.«
Als ob ich zu Hause noch welche bekommen hätte! Mit dieser Bemerkung verletzte mich Ben, und er tat es absichtlich.
»Ich will meine Streicheleinheiten aber von dir«, verlangte ich trotzig.
Keine Reaktion.
Ich richtete mich auf und fragte: »Sag, ist es Stress für dich, wenn ich da bin?« Natürlich hatte ich Angst vor seiner Antwort.
Sekundenlang sahen wir uns schweigend in die Augen.
Dann zog er mich wieder an sich und antwortete leise: »Es ist Entspannung pur für mich, wenn du bei mir bist.«
***
Natürlich konnten Ben und ich nicht zusammen in Urlaub fahren. Aber ich schaffte es immerhin, mich vor Ostern für zwei Tage von zu Hause abzuseilen. Offiziell besuchte ich eine ehemalige Schulfreundin, die jetzt in der Nähe von Marbach wohnte. Von dort aus dauerte es keine zwanzig Minuten bis Steinlingen (die Welt ist ja so klein!). Also plante ich in Wirklichkeit einen längeren Abstecher zu Ben …
So ganz glücklich war der darüber anscheinend nicht. Vielleicht wurde es ihm doch zu viel. Zu viel Nähe. Er sagte ständig, »das mit uns« sei für ihn nur Sex, und dass er nichts weiter für mich empfinde. Aber vermutlich wusste Ben irgendwann selbst nicht mehr so genau, was er eigentlich empfand. Auch ich konnte meine Gefühle nicht richtig einordnen. Auf jeden Fall gab es eine starke sexuelle Abhängigkeit. Und obendrein war ich verliebt – und zwar hoffnungslos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lebte in ständiger Panik vor dem Tag X. Wir hatten vereinbart, uns nicht mehr zu treffen, sobald Ben eine Beziehung mit einer seinem Alter entsprechenden Frau hätte. »Seinem Alter entsprechend« – wie sich das anhörte. Als wäre ich uralt. Mein Gott, was waren schon fünfzehn Jahre Altersunterschied! Hatte ein Mann eine fünfzehn Jahre jüngere Frau, hatte keiner etwas dagegen. Aber umgekehrt … Ich dagegen fand inzwischen, dass es für eine Frau toll war, einen jüngeren Mann zu haben. Warum auch nicht? Alt wurden sie schließlich von allein!
Da Ben meistens in und um Stuttgart ausging und ständig neue Bekanntschaften machte, konnte das mit der Beziehung praktisch jederzeit passieren. Ich war mittlerweile so weit, dass ich mich mehr davor fürchtete, ihn zu verlieren, als davor, dass unser Verhältnis aufflog. Er spürte, dass ich mehr für ihn empfand, als mir guttat. Und manchmal hatte ich das Gefühl, als nutzte er dieses Wissen gnadenlos aus.
***
Am Gründonnerstag um die Mittagszeit fuhr ich also wie geplant zu meiner Freundin Rosalie. Eigentlich stammte sie aus Karlsruhe, war aber kurz nach ihrer Hochzeit ins schwäbische Kirchberg umgezogen. Ihre Ehe war leider kinderlos geblieben. Und der Mann, für den sie vor etwa zehn Jahren Heimat und Freunde aufgegeben hatte, um mit ihm hier zu leben, hatte sie längst wegen einer anderen Frau verlassen. Trotzdem war sie in Kirchberg geblieben, wo sie einen Bioladen betrieb. Inzwischen wohnte sie mit zwei Katzen in einem kleinen Häuschen am Ortsrand, an dessen Haustür ich jetzt klingelte.
Es war fast anderthalb Jahre her, dass wir uns zuletzt gesehen hatten. Dementsprechend stürmisch fiel die Begrüßung aus, als nach wenigen Sekunden die Tür aufging.
»Milena, Liebes, grüß dich!«, rief Rosalie und riss mich in ihre Arme. »Schön, dass du da bist!«
»Hallo Rosalie, wie geht es dir?«, stieß ich kurzatmig hervor, während ich versuchte, mich aus ihrer Umklammerung zu winden. Rosalies Körper hatte etwa das Doppelte an Masse von meinem, vielleicht war die Umarmung deshalb so kräftig geraten.
Sie ließ mich los und antwortete: »Ja, ganz gut so weit, komm rein, ich hab uns einen Nudelauflauf gemacht!«
Ich wusste, Widerstand war zwecklos, also ließ ich mich zum Verzehr von zwei Portionen des wirklich sehr leckeren Auflaufs überreden. Außerdem wollten wir einen Ausflug zum Landgestüt in Marbach machen, und mit vollem Bauch würde eine Besichtigung sicher mehr Spaß bringen als mit knurrendem Magen. Während des Essens tauschten wir die neuesten Neuigkeiten aus. Die meiste Zeit allerdings ließ ich Rosalie reden. Es schien mir besser, nichts über die Einzelheiten meines derzeit wahrlich chaotischen Lebens preiszugeben. So beschränkte ich mich auf ein paar harmlose alltägliche Dinge über meinen Job und die Familie. Ich hatte Rosalie schon vor unserer Verabredung gesagt, dass ich nur ein paar Stunden Zeit für sie hätte, weil ich auf dem Heimweg noch eine ehemalige Kollegin in Pforzheim besuchen wolle. Daher fiel es gar nicht weiter auf, dass ich eigentlich nichts über mich selbst erzählte.
Als wir nach dem Essen noch gemütlich einen Kaffee schlürften, fragte ich: »Soll ich dich mitnehmen nach Marbach?«
»Nein!«, winkte Rosalie energisch ab. »Ich fahre mit meinem Auto. Dann kannst du dich nach dem Gestüt gleich auf den Weg nach Pforzheim machen.«
»Das ist echt lieb von dir!«, entgegnete ich mit einem dankbaren Lächeln. »Aber wir sollten trotzdem wirklich langsam los, sonst wird es knapp mit der Besichtigung.«
Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Es war einigermaßen mild und vor allem trocken, sodass wir einen ausgedehnten Spaziergang auf dem herrlichen Marbacher Gestütsgelände machen konnten. Allein, dass es dort Pferde gab, war zu Hause ein guter Vorwand für diesen Zweitagestrip gewesen. Allerdings konnten mich nicht einmal die vielen schönen Pferde von dem Gedanken an mein wirkliches Vorhaben ablenken. Nach etwa anderthalb Stunden verabschiedete ich mich schließlich von Rosalie und machte mich (angeblich) auf den Weg nach Pforzheim. Natürlich fuhr ich stattdessen zu Ben. Und blieb zum ersten Mal die ganze Nacht bei ihm.
Nach dem Frühstück am Karfreitag sammelte ich meine verstreuten Klamotten ein. Walter, Bens Vater, hatte sich angemeldet. Er wollte uns Fisch bringen und mit uns zu Mittag essen. Ich hielt es für angebracht, schleunigst dafür zu sorgen, dass er meine Unterwäsche nicht vor mir kennenlernte. Außerdem war ich leicht nervös. Ich wusste, dass er nicht begeistert davon war, dass sein Sohn ein Verhältnis mit einer wesentlich älteren – dazu auch noch verheirateten – Frau hatte. Logisch. Damit wäre ich an seiner Stelle vielleicht auch nicht unbedingt einverstanden gewesen. Um einen guten Eindruck zu machen, hatte ich dieses Mal nur »anständige« Kleidung mitgenommen. Als es kurz vor halb zwölf klingelte, trug ich eine ganz biedere Jeans und dazu ein elegantes Shirt. Ben drückte den Türöffner und kam zurück zu mir ins Bad. Ich war gerade dabei gewesen, ihm nach dem Duschen den Rücken einzucremen. Seufzend beeilte ich mich, mit meiner angenehmen Tätigkeit fertig zu werden, damit wir seinen Vater an der Tür in Empfang nehmen konnten, sobald er oben angekommen war.
Irgendwie hatte ich erwartet, dass Ben und Walter sich ähnelten. Doch auf den ersten Blick konnte ich keinerlei Ähnlichkeiten erkennen. Vor mir stand ein fast kahlköpfiger, magerer Durchschnittstyp mit grauem Dreitagesbart. Er schien großflächig tätowiert zu sein, zumindest gaben die hochgeschobenen Ärmel seines Pullovers den Blick auf diverse bunte Unterarm-Tattoos frei. Laut Ben war er siebenundvierzig Jahre alt, also gerade mal zehn Jahre älter als ich. Ohne diese Hintergrundinformation hätte ich Walter locker auf Mitte oder gar Ende fünfzig geschätzt! Falls Bens Mutter mit ihren fünfundvierzig nur annähernd so verbraucht aussah wie ihr Ex-Mann, würde das einiges erklären. Ben hatte sich nämlich schon mehrfach darüber geäußert, dass ich nur acht Jahre jünger sei als sie. Kein Wunder, dass er keine dauerhafte Beziehung mit einer älteren Frau eingehen wollte, wenn er befürchtete, dass seine Partnerin in wenigen Jahren für seine Mutter gehalten werden würde!
»Hallo Walter!«, begrüßte Ben seinen alten Herrn. Dass er ihn beim Vornamen und nicht »Papa«, »Paps« oder dergleichen nannte, fand ich durchaus passend.
»Hi Benny!«, lautete die Erwiderung.
Das allerdings hörte sich für meine Ohren ein bisschen seltsam an. Wenn man bedachte, wie Ben auf Frauen im Allgemeinen (und auf mich im Besonderen) wirkte, schien mir die Verniedlichung seines Namens irgendwie grotesk. Es folgte ein gegenseitiges Schulterklopf- und Faust-Ritual (halt eben so ein typisches »Männer-Ding«), bevor Ben schließlich auf mich zeigte: »Das ist Milena!«
»A-ha …«, sagte Walter gedehnt und bedachte mich mit einem taxierenden Blick, » … das dachte ich mir schon.« Sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen, während er mir die Hand reichte: »Hallo Milena!«
Ich fühlte mich etwas unwohl, als ich sie ergriff. Trotzdem versuchte ich, einen souveränen Eindruck zu machen.
»Hallo Walter«, erwiderte ich schlicht.
Dann gingen wir ins Wohnzimmer und setzten uns aufs Sofa. Das heißt, Ben und Walter saßen auf dem Sofa und unterhielten sich. Ich hatte mich vorsichtshalber in den Sessel gedrückt und ließ nun die unvermeidliche Musterung über mich ergehen.
Eine Weile machten wir artig Konversation. Draußen herrschte ein Wettermix aus Sonne, Wolken und Schneeschauern. Typisch April eben. Im Gegensatz zu seinem Sohn hatte Walter sein Motorrad bereits angemeldet und war auch damit hergefahren. Nun juckte es Ben natürlich gewaltig, die kurzen sonnigen Abschnitte zu nutzen und einen kleinen Ausflug zu machen.
»Du kannst ruhig ein bisschen wegfahren – Walter wird mich schon nicht fressen«, schlug ich ihm vor und versuchte, mit dem kleinen Scherz meine Nervosität zu überspielen. Bei dem Gedanken, mit diesem Mann allein im Wohnzimmer zu sitzen, beschlich mich nämlich ein leises Gefühl von Panik. Aber ich gönnte Ben die Freude, außerdem wollte ich die eventuell anstehende unangenehme Diskussion lieber ohne ihn hinter mich bringen. Er ließ sich das nicht zweimal sagen und flitzte aus dem Zimmer, um Jeans und T-Shirt gegen seine Motorradkluft zu tauschen. Kurz darauf zog er die Tür hinter sich ins Schloss.
Anfangs saßen wir ziemlich betreten da, Walter und ich. Aber dann unterhielten wir uns erstaunlich gut. Natürlich musste er mir sagen, dass der Altersunterschied zwischen Ben und mir wirklich sehr groß sei – als ob mir dieser Umstand nicht schon selbst aufgefallen wäre. Und dass ich mich sowieso von meinem Mann scheiden lassen müsse, weil unsere Ehe kaputt und nicht zu retten sei. Das wiederum befremdete mich etwas. Woher wollte ausgerechnet Walter so genau wissen, was mit meiner Ehe nicht in Ordnung war? Er kannte mich doch gar nicht, genauso wenig wie meinen Mann! Wahrscheinlich schloss er von sich auf andere – er hatte sich von seiner Frau getrennt, als seine Söhne zwölf und vierzehn Jahre alt gewesen waren. Zuvor hatte er die Mutter seiner Jungs ständig betrogen, das hatte Ben mir schon erzählt. Wahrscheinlich konnte so jemand sich nicht vorstellen, dass man sich fast zwanzig Jahre lang treu sein konnte. Dass eine Beziehung, die so lange Bestand hatte, nicht zwangsläufig wegen einer einzigen Affäre zerbrechen musste. Ich sagte ihm, dass Oliver der Vater meiner Kinder sei und ich noch immer sehr viel für ihn empfände. Dass er sich nur seit zwei oder drei Jahren kein bisschen mehr für mich interessiere und ich das Gefühl hätte, für ihn ein Möbelstück zu sein, das einfach zum Inventar gehört.
Ben hatte gleich, nachdem er unsere Familie kennengelernt hatte, zu mir gesagt: »Der Oliver wartet wohl auch darauf, dass seine Frau endlich ein bisschen ruhiger wird …« Damit hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen: Je mehr ich unternehmen wollte, desto mehr zog Oliver sich in seiner phlegmatischen Art zurück. An einem der ersten Male, an denen Ben wegen seines Andromeda-Jobs am Wochenende bei uns übernachtete, saßen wir im Minotaurus an einem kleinen Tisch und tranken zusammen eine Cola.
»Dass dein Mann dich immer allein weglässt, verstehe ich nicht«, meinte Ben zu mir.
»Ich glaube, manchmal stinkt es ihm auch ganz gewaltig«, antwortete ich leicht verärgert. »Aber was soll er denn dagegen tun! Ich wollte eigentlich nie ohne ihn weggehen. Doch warum zum Teufel sollte ich zu Hause bleiben, nur weil er nicht mit mir ausgehen will?«
Ben sah mich nachdenklich an. Dann sagte er: »Milena, ich wüsste schon, was ich tun würde. Ich würde dich übers Knie legen und dir mal richtig den Arsch versohlen – dann würdest du schon zu Hause bei mir bleiben.«
Mein Unterkiefer klappte herunter. Ich wollte eine schlagfertige Antwort geben, doch bei so viel Dreistigkeit blieb mir einfach die Spucke weg! Er grinste zwar, aber ich hatte schon damals den leisen Verdacht, dass er das vollkommen ernst meinte.
Davon erzählte ich Bens Vater natürlich nichts. Ich hielt mich an die wesentlichen Fakten. Und, wie erwartet, verstand er überhaupt nichts. Vielleicht gab es da auch nichts zu verstehen. Manche Dinge sind eben, wie sie sind – egal, wie man sie dreht und wendet. Walter jedenfalls kam nicht umhin, mich noch darüber aufzuklären, wie unheimlich sensibel sein Sohn doch sei, auch wenn man ihm das nach außen hin überhaupt nicht anmerke. Dass er wegen Sandra Schlimmes durchgemacht habe und nicht noch einmal so verletzt werden dürfe. Und dass Ben eine richtig gut aussehende Freundin haben wolle und so weiter. Danke schön. Sooo hässlich fand ich mich eigentlich nicht, aber das war eben alles Geschmackssache. Jedenfalls dachte ich mir: Vom Vater hat er diese übermäßige Sensibilität ganz sicher nicht geerbt.
Ben kam (endlich!) von seiner Spritztour zurück. Gerade rechtzeitig, um mich vor einer weiterführenden Diskussion über Ehebrecher und Scheidungsgründe zu bewahren. Ich war heilfroh, dass ich nun nichts weiter zu tun brauchte, als seinem Vater in der Küche ein wenig zur Hand zu gehen.
Als wir später beim Essen saßen, meinte Walter plötzlich warmherzig: »Ihr passt richtig gut zusammen. Ihr seht aus wie ein frisch verliebtes Paar!«
Was war das jetzt für eine Nummer? Unsere Diskussion über den Altersunterschied und die widrigen Umstände lag gerade mal eine Stunde zurück! Zuweilen neige ich dazu, sarkastisch zu sein, doch angesichts der ohnehin schon schwierigen Situation unterdrückte ich eine entsprechende Antwort.
»Nicht wahr«, konnte ich mir jedoch nicht verkneifen mit einem süffisanten Lächeln zu erwidern, »vor allem Ben sieht so glücklich aus …«
Der so glücklich aussehende Ben bestrafte mich am Nachmittag, warum auch immer, mit Liebesentzug. Wahrscheinlich hatte er Schwierigkeiten, das Mittagessen und vor allem den Kommentar seines Vaters zu verdauen. Ich wusste, dass es ihm nicht passte, wie die Dinge sich entwickelten. Dass ich ihm zu nahe kam und er Angst hatte, sich selbst eines Tages dabei zu ertappen, dass er diese Nähe zuließ. Nur weil ich älter war als er, trug ich in seinen Augen die alleinige Verantwortung für den ganzen Schlamassel – schließlich hätte ich ja wissen müssen, wohin das letztendlich führte! Das war für Ben logisch. Und vor allem so bequem! Unzufrieden und frustriert fuhr ich nach Hause.
***
Die restlichen Osterfeiertage verbrachte ich im üblichen Wechselbad der Gefühle: Wut, Enttäuschung, Sehnsucht und Angst. Ich verfluchte Ben. Und vermisste ihn schrecklich. Dementsprechend mies war meistens meine Laune. Oliver hatte sich wohl schon an meine depressiven Verstimmungen gewöhnt. Jedenfalls schien es ihn nach wie vor nicht zu interessieren, was denn eigentlich mit mir los war. (Und wenn doch, war er bemerkenswert gut darin, das zu verbergen.) Ehrlich gesagt legte ich inzwischen auch keinen Wert mehr darauf. Fast drei Jahre lang hatte ich versucht, sein Interesse an mir und unserer Ehe zu wecken. Oder vielmehr wiederzuerwecken. Mittlerweile hatte ich es aufgegeben. Meine Gedanken kreisten nur noch um Ben und unser nächstes Date.
Schon am Dienstag nach Ostern war es so weit: Völlig unerwartet hatte es sich ergeben, dass ich ihn besuchen konnte. Oliver musste geschäftlich auf ein zweitägiges Seminar nach Freiburg. Die ursprüngliche Planung sah vor, dass er abends nach Hause und frühmorgens wieder nach Freiburg fahren würde. Jetzt aber übernahm die Firma doch die Kosten für eine Übernachtung im Hotel. Das bedeutete weniger Stress für Oliver. Und für mich ein zusätzliches Date mit Ben. Wenn es nun noch bei unserer inzwischen festen Donnerstags-Verabredung bliebe, hätte ich tatsächlich in den letzten zwei oder sogar drei Wochen mehr Zeit mit Ben als mit meinem Mann verbracht. Zumindest effektiv gesehen. Obwohl, rein auf die Effektivität bezogen, war das seit Beginn unserer Affäre so.
Dieses Date mit Ben jedenfalls entpuppte sich als eines unserer schönsten. Da wir beide nicht arbeiten mussten, konnte ich bereits am frühen Nachmittag bei ihm sein. So hatten wir richtig viel Zeit füreinander. Schon bei der Begrüßung zog Ben mich sanft, aber bestimmt ins Schlafzimmer, wo wir uns tatsächlich ganz normal und im Bett liebten. Eben wie ein ganz normales Paar. Zum Abendessen ließen wir uns die Lasagne schmecken, die Ben schon vor meiner Ankunft zubereitet hatte, und die er nur noch mal kurz in den Ofen schieben musste. Obwohl ich daheim mit den Mädchen schon ein warmes Mittagessen gehabt hatte, schaffte ich eine bemerkenswert große Portion. Das lag sicher an Ben. Entweder er hatte besonders lecker gekocht oder meinen Bedarf an Kalorien drastisch erhöht – wahrscheinlich beides.
»Lass uns noch ein bisschen rausgehen«, schlug er nach dem Essen vor, während wir die Küche aufräumten.
»Gern«, stimmte ich ihm zu.
Es war erst Viertel vor sieben, somit gäbe es mindestens noch eine gute Stunde Tageslicht. Das reichte sogar für einen ausgedehnten Spaziergang. Ich zog mir also eine leichte Jacke über. Ben brauchte keine Jacke, er als Mann war nicht so eine Frostbeule wie ich. Schließlich hatten wir immerhin stolze siebzehn Grad Außentemperatur.
Zwei Minuten später verließen wir Bens Wohnung.
»Ich soll dich von Walter grüßen«, sagte er beiläufig.
Ich ignorierte das flaue Gefühl in meiner Magengegend und fragte ebenso beiläufig: »Hat er sonst noch etwas gesagt?«
»Klar. Er sagt viel, wenn der Tag lang ist.«
Ich verdrehte die Augen. Typisch Mann! »Über uns, meine ich. Oder besser gesagt über mich.«
»Ach so. Das meinst du.«
Was sonst, dachte ich, schwieg aber. Das flaue Gefühl wurde stärker, egal, wie sehr ich es zu ignorieren versuchte.
Hand in Hand schlenderten wir einen Weg entlang, der hinter den Häusern am Feldrand verlief. Ich rechnete schon gar nicht mehr mit einer Antwort, als Ben meinte: »Du gefällst ihm.«
»Aha.«
»Dass wir etwas miteinander haben, gefällt ihm nicht«, erläuterte Ben näher, »aber nur wegen des großen Altersunterschieds.«
»Ah so. Das ist ja mal ganz was Neues«, bemühte ich mich erfolglos, meine sarkastische Ader zu unterdrücken.
Ben legte den Arm um meine Schultern. »Ja«, lachte er, »das habe ich auch gedacht.« Mit einem ernsten Unterton fügte er hinzu: »Er meinte, du wärst eher etwas für ihn. Aber ich habe ihm gleich gesagt, dass das überhaupt nicht infrage kommt.«
Das flaue Gefühl in meiner Magengegend wich blankem Entsetzen. Woher nahmen Männer eigentlich immer dieses grenzenlos übersteigerte Selbstbewusstsein? Walter hatte sicher schon sehr, sehr lange nicht mehr in einen Spiegel gesehen! Wie sonst rechnete er sich Chancen aus bei einer Frau, die meist für die große Schwester ihrer Töchter gehalten wurde?
Ich schüttelte fassungslos den Kopf. Dann erwiderte ich: »Danke! Wenigstens gibt es einen Punkt, in dem wir uns hundertprozentig einig sind.«
Wir gingen zurück, da es schon dämmerte. Außerdem wollte Ben sich noch einen Film ansehen. Gerade rechtzeitig zum Beginn um Viertel nach acht kuschelten wir uns gemütlich auf die Couch. Es lief eine sogenannte Highschool-Komödie, die ich zwar schon gesehen hatte, aber trotzdem recht amüsant fand. Ben war ganz begeistert von der Hauptdarstellerin. Meiner Meinung nach war sie keine Schönheit, aber durchaus attraktiv. Zweifellos hatte sie eine tolle Ausstrahlung. Außerdem war sie blond, und das allein war wohl für Ben Grund genug, auf sie abzufahren. Seine Vorliebe für Blondinen war mir schon vorher aufgefallen. Meine (zugegeben manchmal etwas zerzausten) dunklen Locken bezeichnete er wenig schmeichelhaft als »Wischmopp«. Nun, ich passte also nicht in sein übliches Beuteschema, denn ich war weder jung noch blond. Aber anscheinend war der Sex mit einem älteren, dunkelhaarigen Wischmopp auch nicht zu verachten … Ich war mir sicher, dass Ben generell bei Frauen, also auch bei Blondinen, gute Chancen hatte – an mangelnder Gelegenheit konnte es also nicht liegen. Verstehe einer die Männer!
»Was genau findest du denn so toll an ihr?«, fragte ich ihn in der nächsten Werbepause. Aus reiner Neugierde.
Er sagte: »Dass sie überhaupt nicht geschminkt ist und trotzdem so toll aussieht.«
Unfassbar! Egal, ob jung oder alt: Männer waren in manchen Dingen so was von unbedarft! Sie mochten in Bezug auf Naturwissenschaften oder Technik über mehr Potenzial verfügen. Doch was Frauen und ihre Schmink- und Schönheitstricks betraf, steckten sie noch im tiefsten Mittelalter – was Mann nicht sehen konnte, war nicht da. Oder eben Zauberei. Ich räusperte mich und überlegte, wie ich Ben über seinen Irrtum aufklären könnte, ohne sein bisheriges Frauenbild dadurch ungünstig zu beeinflussen.
»Ich finde auch, dass ihr Make-up sehr natürlich wirkt«, begann ich vorsichtig.
»Ach was«, fiel Ben mir ins Wort, »die trägt gar kein Make-up.«
»Doch, mein Lieber, tut sie. Man nennt das ›nude‹, weil es so ungeschminkt aussieht.«
Ben schnaubte: »Pah! Wofür soll das denn gut sein? Und überhaupt, das wäre ja voll die Verarsche …«
Ich dachte: Willkommen in der Realität! Laut sagte ich: »Na ja, mit dem richtigen Make-up unterstreicht man ja nur die optischen Vorzüge. Das muss nicht bedeuten, dass man sich anmalt, als wäre man in einen Tuschekasten gefallen. Nicht nur im Film, sondern generell in den Medien gibt es keine ungeschminkten Leute! Nicht mal in einem läppischen Interview. Und das gilt übrigens nicht nur für die Frauen. Auch die Männer, sogar die Nachrichtensprecher, tragen Make-up.«
Ben winkte genervt ab. »Ist ja auch egal …«
Die Werbepause war zu Ende, er wollte sich wieder auf Jane Smith konzentrieren. Doch ich war mir sicher, dass er sie und alle anderen Schauspielerinnen (sowie zukünftig Frauen überhaupt) nun mit ganz anderen Augen sehen würde.
Nach dem Film ging ich ins Bad, um mir die Zähne zu putzen. Als ich gerade so richtig konzentriert am Bürsten war, kam Ben herein. Ohne ein Wort stellte er sich hinter mich. Ich spürte seine Härte, als er sich an mich drückte, und mindestens zehntausend Volt durchjagten meinen Körper. Ben umarmte mich von hinten, öffnete meine Hose und zog sie mir langsam herunter. Dann mit einem Ruck den Slip. Er streichelte mich mit seinem besten Stück zwischen den Beinen. Ich keuchte (Zähneputzen ist ja so anstrengend), beugte meinen Oberkörper nach vorn und streckte ihm mein Hinterteil bereitwillig entgegen. Aufreizend langsam drang er in mich ein. Langsame, feste, tiefe Stöße … meine Beine begannen zu zittern – ich wusste nicht, wie lange ich noch stehen könnte. Das schien er zu bemerken, denn er setzte sich auf den Toilettendeckel, ohne sich aus mir zurückzuziehen. Er hielt mich einfach fest und zog mich auf seinen Schoß. Ich bekam fast einen Kreislaufkollaps und hatte Angst, dass er mich dann wieder vom Boden aufsammeln müsste. Deshalb stöhnte ich: »Ins Bett … Ich will ins Bett …«
Manchmal tat er, was ich ihm sagte – meistens eher nicht. Auf jeden Fall erbarmte er sich, stand mit mir zusammen auf und schob mich Richtung Schlafzimmer. Dabei hatte ich ihn weiterhin fest in mir. Flüchtig kam mir der Gedanke, wie aufregend es wäre, wenn ich ihn den ganzen Tag in mir hätte. Egal ob ich ging, stand, saß oder lag. Egal wo ich gerade war – ob zu Hause, beim Einkaufen oder im Büro. Vermutlich, nein: ganz sicher würde ich dann in einer geschlossenen Anstalt enden.
Wir kamen im Schlafzimmer an, wo Ben mich vor sich aufs Bett stieß. Das heißt, ich durfte nur den Oberkörper auf der Matratze abstützen, während er es mir im Stehen besorgte. Diesmal richtig. Fest und schnell. Immer schneller … bis er zuckte und langsamer wurde, noch ein paarmal tief in mich hineinstieß und schließlich stillhielt. (Nun würde es bestimmt sehr, sehr lange dauern, bis ich wieder in der Lage wäre, unbefangen meine Zähne zu putzen …)
Danach machten wir es uns wieder im Wohnzimmer gemütlich. Wir sahen fern und unterhielten uns dabei, als würden wir das jeden Abend tun. Es war schön. Es fühlte sich gut an. Zu gut.
Plötzlich und unvermittelt sagte Ben: »Geh nach Hause zu deinem Mann und deinen Kindern.«
Fassungslos starrte ich ihn an. Ich wollte ihn fragen, was das jetzt sollte. Aber noch bevor ich den Mund aufmachte, wurde mir klar: Wir hatten eine Grenze überschritten, alle beide. Wir hatten uns nicht mehr an die Spielregeln gehalten.
Schweigend packte ich meine Sachen. Ben brachte mich zum Wagen.
»Wann sehen wir uns?«, fragte ich, um einen beiläufigen Ton bemüht.
»Vorerst nicht.«
»Was heißt ›vorerst‹?«, flüsterte ich bitter. »Sag es lieber gleich, du brauchst mich nicht hinzuhalten.«
Schweigen.
Ich wusste, was jetzt kommen würde. Und er wusste es auch.
Er holte tief Luft: »Also gut, ziehen wir einen Schlussstrich. Es ist besser so.«
Darauf hatte ich schon lange gewartet. Jetzt passierte es also. Ich sagte hölzern: »Ich wünsche dir alles Gute. Und – vergiss mich nicht.«
»Nein«, erwiderte er tonlos, »ich vergesse dich nicht.«
Wie betäubt startete ich meinen Wagen und fuhr los. Es war, als hätte mir jemand mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen, nur die erlösende Ohnmacht war ausgeblieben. Zwei Ortschaften weiter hielt ich an, denn ich bekam keine Luft mehr. Ich parkte am Straßenrand und versuchte, erst einmal tief durchzuatmen. Mein Atem ging nicht schnell, jedes Luftholen war anstrengend. Mein Herz schlug ganz langsam. In meinem Hals hatte ich einen riesigen Kloß und meine Gedanken schienen gelähmt. Trotzdem musste ich irgendwie die lange Heimfahrt schaffen. Ich versuchte, ganz nüchtern über alles nachzudenken. Ben hatte das einzig Richtige getan. Es war wirklich besser so, das wusste ich, und wir hätten das schon viel früher tun sollen. Meine Augen füllten sich endlich mit Tränen, die langsam über mein Gesicht rollten. Zu weinen machte auch keinen Sinn, aber immerhin konnte ich jetzt, wo der dicke Kloß sich löste, wieder leichter atmen. Und überhaupt, was stellte ich mich denn so an. Ich musste froh sein, dass ich sozusagen noch mit einem blauen Auge davongekommen war! Es hätte schlimmer sein können.
Es war schlimmer. Warum zum Teufel fühlte es sich an, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen? – So ist das eben: Man stellt sich den gefürchteten Augenblick ständig vor, um sich möglichst gut darauf vorzubereiten. Und wenn es dann so weit ist, erwischt es einen trotzdem, und zwar volle Breitseite. Ich zwang mich, mit dem Weinen aufzuhören. Schließlich wollte ich nicht wie ein verquollenes hysterisches altes Weib aussehen, wenn Oliver am nächsten Tag nach Hause käme. Wie sollte ich das denn erklären? Wo ich mir doch offiziell einen gemütlichen Frauenabend mit meiner Freundin Andrea gemacht hatte.
Anderthalb Stunden später kam ich bei Andrea an. Sie fragte natürlich sofort, was denn passiert sei. Worauf ich natürlich sofort wieder in Tränen ausbrach. Sie versuchte, mich zu trösten. Auch sie versicherte mir, dass es besser so sei. Fein, dann waren sich ja alle einig. Was natürlich nichts daran änderte, dass ich mich einfach beschissen fühlte.
Weit nach Mitternacht ging ich schließlich nach Hause und schlich in mein Bett, ohne dass die Mädchen wach wurden. Ich schlief auch sofort ein, weil ich total erschöpft war. Das war gut so, jedenfalls besser, als den Rest der Nacht zu grübeln. Dafür würde ich die nächste Zeit sicher noch mehr als genug Gelegenheit haben. Doch als ich ein paar Stunden später aufwachte, kam dafür gleich der Dampfhammer – schlagartig fiel mir mein ganzes Elend wieder ein. Den nächsten Hammer bekam ich im Badezimmer vor dem Spiegel: Natürlich sah ich aus wie ein verquollenes hysterisches altes Weib. Zum Glück fiel mir eine gute Ausrede ein: Ich war allergisch auf Andreas Langhaarkatzen und hatte wohl zu viel mit ihnen geschmust. Das stimmte wirklich. Zumindest das mit der Allergie. Doch darauf fiel Janine natürlich nicht herein. Sie brauchte mich nur kurz anzusehen und wusste sofort Bescheid. Ohne eine einzige Frage zu stellen, nahm sie mich ganz fest in den Arm und flüsterte nur: »Es tut mir so leid …«
***
Man glaubt es kaum, aber ich überstand die nächsten Tage. Wie ein Roboter machte ich meine Arbeit und funktionierte zu Hause wie immer. Nur im Büro unterliefen mir leider ein paar krasse Fehler, was Herr Abel aber zum Glück auf meinen gesundheitlichen Zustand zurückführte und mir nicht ankreidete. Zu allem Übel war ich nämlich auch noch krank geworden. Er schätzte sich also glücklich, dass ich überhaupt zur Arbeit kam. Das war wieder einmal typisch: Monatelang hatte ich zu wenig Schlaf gehabt, zu viel geraucht und getrunken, war mit nassen Haaren in der Kälte herumgelaufen, und es war nicht das Geringste passiert. Zu Hause hatte ich während dieser Zeit mehrmals fast eine Art Lazarett geführt, die ganze Familie war abwechselnd krank gewesen – nur ich nicht. Dafür gab es eine ganz simple Erklärung: Endorphine. Schließlich hatte ich ständig unter Strom gestanden, mein Körper hatte vermutlich jede Menge dieser kleinen Dinger produziert. Es handelte sich also um eine einfache chemische Reaktion, Glückshormone stärken bekanntlich das Immunsystem. – Und kaum hatte ich Liebeskummer, haute mich der erstbeste zufällig vorbeikommende Erreger völlig um.
Am darauffolgenden Samstag hielt ich es beim besten Willen nicht mehr aus – ich rief Ben an. Wie konnte ich nur. Besaß ich denn kein bisschen Stolz? Nein, besaß ich nicht. Es war mir völlig gleich, was er von mir dachte. Oder was ich hinterher von mir denken würde. Ich wollte wenigstens mit ihm sprechen! Ich sagte ihm, dass ich es nicht ohne ihn aushielte, und jammerte ihn fürchterlich voll.
Er sagte: »Milena, ich muss mir über einiges klar werden. Gib mir zwei Wochen Zeit, dann sehen wir weiter.«
Obwohl das Gespräch nur kurz gewesen war, fühlte ich mich tatsächlich etwas besser. Bis zum Mittwoch – dann packte mich erneut die Panik: Der Donnerstag stand bevor. In den letzten Monaten für mich der schönste Tag der ganzen Woche. Ich konnte nicht anders – ich schickte ihm eine SMS:
Können wir morgen Abend nicht wenigstens chatten? Ich weiß nämlich nicht, wie ich sonst den verdammten Donnerstag überstehen soll.
Kurze Zeit später piepte mein Handy.
Nein, das ist keine besonders gute Idee.
Ich hatte nichts anderes erwartet.
Doch gleich darauf kam eine zweite Nachricht:
Komm lieber persönlich vorbei. Und wehe du fragst jetzt, ob ich das ernst meine, dann werde ich mächtig sauer.
Ich weinte vor Erleichterung.
Vierundzwanzig Stunden später befand ich mich auf der Autobahn, auf der ich mich mittlerweile fast schon zu Hause fühlte. Leider stand ich längere Zeit im Stau, was meine Vorfreude jedoch nicht dämpfen konnte. Im Stau stehen ist langweilig. Außer man trägt halterlose Strümpfe und einen Rock, der im Sitzen ziemlich weit hochrutscht. Dann kann es durchaus interessant und lustig werden! Ich fuhr – oder besser gesagt: kroch – auf der mittleren Spur, wo ich abwechselnd von einem Lieferwagen rechts und von einem PKW links überholt wurde. Der Typ im Lieferwagen kurbelte extra die Scheibe ein Stück herunter und streckte den Kopf aus dem Fenster, damit er besser in meinen Wagen glotzen konnte. Wahrscheinlich hatte er noch nie einen Golf von innen gesehen. Oder noch keine halterlosen Strümpfe? Jedenfalls befürchtete ich die ganze Zeit, dass er für einen noch längeren Stau sorgen würde, indem er das mit dem Gasgeben und Bremsen nicht mehr geregelt bekäme. Männer sind aber auch so was von leicht abzulenken!
In dem Wagen links neben mir saßen vier junge Kerle, die anfangs taten, was sie anscheinend für Flirten hielten, dann allerdings mit ihrer Körpersprache eindeutig zweideutig wurden. Nun, mein Körper spricht manchmal ebenfalls eine recht deutliche Sprache, zum Beispiel mein Mittelfinger. Nachdem ich mich auf diese nicht sehr höfliche Art und Weise von ihnen verabschiedet hatte, würdigte ich die linke Spur keines Blickes mehr und konzentrierte mich voll und ganz auf den Lieferwagen. Ich lächelte den Fahrer unschuldig an, was ihn vollends aus dem Konzept brachte: Er rammte beinahe das Fahrzeug vor sich. Gut, ich gebe zu – mein Lächeln war vielleicht doch nicht ganz so unschuldig. Aber was konnte ich denn dafür, dass bei Männern das Gehirn zuweilen schlechter durchblutet wird als manche vom Kopf wesentlich weiter entfernt liegenden Körperteile?
Irgendwann löst auch der längste Stau sich auf, und so brachte ich den Rest der Strecke doch recht zügig hinter mich und kam endlich bei Ben an. Mir war flau im Magen vor Nervosität – schließlich wusste ich nicht, wie die Begrüßung ausfallen würde. Er erwartete mich nicht an der Tür. Stattdessen saß er im Wohnzimmer auf dem Sofa und sah fern.
Leicht irritiert setzte ich mich neben ihn und sagte: »Hallo Ben. Wie geht es dir?«
Er antwortete nicht, sondern nahm mich einfach fest in den Arm. Alle Unsicherheit und Nervosität waren schlagartig weg. Zehn Tage hatte ich es ohne ihn aushalten müssen – ich war ganz schön auf Entzug. Während wir uns küssten, machten sich meine Hände selbstständig. Bevor ich es richtig bemerkte, öffneten sie die Knöpfe seiner Hose, einen nach dem anderen. Ich zog meine Zunge aus seinem Mund und kniete mich auf den Boden, streifte ihm die Jeans ab. Dann den Slip.
Ich nahm mein Lieblingsspielzeug in den Mund – aber Ben packte mich im Nacken, zog mich hoch und forderte heiser: »Zieh dich aus!«
Zaghaft wehrte ich mich, doch er schob mir einfach den Rock hoch, riss meinen Slip herunter und sagte heftig: »Ich will dich jetzt endlich haben!«
Bevor ich noch irgendetwas erwidern konnte, lag ich schon auf dem Sofa, ein Bein an der Wand, das andere angewinkelt auf dem niedrigen Wohnzimmertisch – und Ben dazwischen, der tief in mich eindrang.
Er nahm mich so stürmisch, dass ich laut jammerte: »Ben, du tust mir weh!«
Doch er keuchte nur: »Hör auf zu schreien, sonst mach ich’s noch fester!«
***
Ben war nicht immer so ungeduldig. Er nahm sich manchmal sehr viel Zeit für mich und konnte ausgesprochen liebevoll sein. Das erste Mal Oralsex mit ihm werde ich nie vergessen …
Ben begann damit, mich ausgiebig und zärtlich zu massieren. Seine Hände kneteten meinen Rücken und den Nacken, bis ich ganz entspannt war. Irgendwann drehte er mich um und fing an, mich zu streicheln. Langsam wanderten seine Finger über meine Brüste und meinen Bauch, immer tiefer …
Er öffnete sanft meine Schenkel, kniete sich dazwischen und sagte: »Mach die Beine weiter auseinander, damit ich dich richtig anschauen kann.«
Ich sträubte mich, da es mir ein wenig unangenehm war, mich ihm so »offenherzig« zu präsentieren. Bis zum Vortag hatte ich nämlich noch ein dezentes, sorgfältig gestyltes kleines Dreieck da unten getragen. Doch Ben hatte von mir verlangt, komplett alles zu entfernen. Er wollte mich ganz nackt. Also war ich beim Waxing gewesen und hatte eine nur mäßig angenehme »Schönheitsbehandlung« hinter mir.
Ben sagte: »Du musst dich nicht schämen, du bist wunderschön! Also spreize die Beine so weit, wie es geht, damit ich dich besser lecken kann.«
Ich erwiderte zögernd: »Das hat bisher noch nie einer durchgehalten – es dauert bei mir viel zu lange. Vergiss es, sonst hast du morgen Muskelkater in der Zunge.«
Er sah mir in die Augen und befahl: »Du sollst tun, was ich dir sage!«
Auch das gehörte zu den Spielregeln. Also tat ich, was er verlangte. Ben beugte sich über mich und strich ganz zart über die Innenseite meiner Schenkel, zuerst mit den Fingern, dann mit der Zunge.
Ich stöhnte gequält auf und murmelte: »Das schaffst du nicht – außerdem bin ich schon jetzt viel zu nass.«
»Hör auf zu quengeln! Du bist jetzt still und genießt!«
Offensichtlich wollte er mich zu meinem Glück zwingen. Also gut. Mit einem resignierten Seufzen ergab ich mich in mein Schicksal, schloss die Augen und versuchte, mich zu entspannen.
Ich fühlte, wie er seine Hand auf meinen Venushügel legte, wie er mich sanft öffnete. Dann führte er einen Finger in mich ein. Er bewegte ihn, ließ ihn in mir kreisen, zog ihn ein wenig heraus und schob ihn wieder tief in mich hinein. Irgendwann spürte ich seinen Atem. Dann seine Zunge. Sie umkreiste meine Perle, rieb sich an ihr, glitt zusammen mit seinem Finger in mich hinein. Ich fühlte die Feuchtigkeit meiner Lust, wie sie langsam aus mir heraustropfte. Ben zog seinen Finger heraus. Bestimmt würde er jetzt gleich aufhören, weil ich zu nass wurde. Oliver hatte es immer gestört, wenn ich fast am Zerfließen war … Doch Ben leckte Tropfen für Tropfen ab, umschloss meine gesamte Weiblichkeit mit seinem Mund und saugte daran. Dann begann er von vorn – spreizte mir die Schamlippen, schob wieder seinen Finger in mich hinein und bewegte ihn wie einen Penis.
Ich hielt es fast nicht aus. »Schlaf endlich mit mir«, bettelte ich, »komm, bitte!«
Er hob den Kopf und sagte ruhig: »Nein. Du lässt dich jetzt einfach fallen. Ich werde ganz bestimmt nicht aufhören, bevor es dir kommt.«
Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich zu fügen und die süße Qual noch eine ganze Weile länger zu ertragen. Ich spürte seine heiße Zunge, die an meiner Perle vibrierte und sie umkreiste, dann wieder mit sanftem Druck von oben nach unten glitt, und dachte, ich werde wahnsinnig. Als Ben merkte, dass ich kurz vor dem Höhepunkt war, zog er seinen Finger heraus und stieß, so tief und so fest es ging, seine Zunge in mich hinein – der Orgasmus machte mich fast ohnmächtig.
Keine Ahnung, wie lange es gedauert hatte, auf jeden Fall sehr lange. Ben war der erste Mann, der sich wirklich so viel Mühe mit mir gab. Dem es egal war, wie lange ich brauchte!
»Hat es dir gefallen?«, fragte er, als ich wieder ansprechbar war.
»Sehr. Das war eine richtige Premiere …«, antwortete ich schwach.
»Das ist schön. Das macht mich glücklich und sehr zufrieden. Ich weiß auch ganz genau, was du jetzt noch brauchst …«
Kurz darauf waren sicher weithin meine Schreie zu hören. Vermutlich überlegten die Nachbarn, ob sie die Polizei rufen sollten. Oder den Notarzt.
***
Im Mai stand Bens dreiundzwanzigster Geburtstag bevor, der in diesem Jahr auf einen Freitag fiel. Einige Tage vorher sagte ich zu ihm: »Schade, dass du dir an deinem Geburtstag nicht freinehmen kannst.«
»Warum?« fragte er.
»Weil wir dann besser feiern könnten. Wenn du am nächsten Tag nicht arbeiten müsstest, könnte ich dich bis zwölf Uhr nachts verwöhnen, praktisch zum Reinfeiern. Aber wenn ich das tue, bist du freitags völlig fertig.«
Er lachte. »Milena, du brauchst nicht bis zwölf Uhr, um mich fertigzumachen!«
Das war gemein. Überhaupt tat er immer so, als sei ich absolut unersättlich. Was konnte ich dafür? Sollte er doch einmal an sich heruntersehen und mir dann ehrlich sagen, wie ich es schaffen sollte, den ganzen Abend sittsam neben ihm zu sitzen und meine Hände bei mir zu behalten! Jedes Mal nahm ich mir vor, ihn in Ruhe zu lassen. Hätten wir uns jeden Tag gesehen, wäre ich nicht immer so ausgehungert nach ihm gewesen! Dann hätte ich auch nicht immer Lust auf ihn gehabt. Vielleicht.
Am nächsten Donnerstag lud ich ihn zum Essen ein, sozusagen als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Da ich mich bei ihm in der Gegend nicht auskannte, überließ ich ihm die Wahl, wohin wir gehen sollten. Er entschied sich für das »Senza Eguali«, ein beliebtes italienisches Restaurant in Stuttgart, wo er anscheinend schon öfter gewesen war.
Das Wetter war nicht unbedingt das beste, aber es regnete immerhin gerade nicht. Also beschlossen wir, das Risiko einer eventuell recht nassen Heimfahrt in Kauf zu nehmen und mit dem Motorrad zu fahren. Nun denn, ich hatte ungefähr seit hundert Jahren nicht mehr auf einem Motorrad gesessen, außerdem war ich von Natur aus ein eher ängstlicher Mensch. Andererseits freute ich mich, wieder einmal die Gelegenheit zu einer kleinen Tour zu haben. Also gab mir Ben eine Lederjacke, die mir passte wie angegossen – wobei ich nicht wirklich wissen wollte, wem sie zuvor gehört hatte – und einen Helm, in dem ich Platzangst bekam. Entweder ich besaß einen noch größeren Dickschädel als er oder es lag an meinen Haaren. Wahrscheinlich waren es die Haare. Ich musste innerlich grinsen, als ich daran dachte, dass er sie sowieso nicht mochte. Wie oft hörte ich: »Immer ist dieser Wischmopp im Weg …!« Mir gefiel meine Frisur – meistens jedenfalls. Ich war gerade dabei, mein Haar wieder wachsen zu lassen, so wie früher. Ein paar Zentimeter mehr und die Locken würden sich etwas aushängen. Dann wäre es leichter, einen Zopf zu flechten. Wie auch immer – Ben konnte das doch völlig egal sein, er musste ja schließlich nicht damit herumlaufen!
Er holte sein Motorrad aus der Garage. Irgendwie schaffte ich es sogar, meine langen Beine zu sortieren und hinter ihm auf die Sitzbank zu klettern. Vor lauter Begeisterung über diesen Erfolg vergaß ich leider, den Helm am Kinn richtig zu schließen.
Ben drehte sich zu mir um und fragte: »Vertraust du mir?«
Blöde Frage. Mit ihm wäre ich wahrscheinlich sonst wohin gefahren – mit dem Motorrad, dem Auto oder meinetwegen auch mit dem Tretroller. Ich war mir sicher, dass er gut fahren konnte. Und dass er garantiert kein unnötiges Risiko eingehen würde, wenn jemand hintendrauf saß. Außerdem wusste ich, dass er regelmäßig ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC absolvierte.
Ich sagte nur: »Ja.«
Ben nickte mir zu, schaute wieder nach vorn und gab Gas.
Am Anfang war es ganz lustig, ich freute mich wie ein Kind beim Karussellfahren. Das Beschleunigen fand ich absolut geil. Es war ein ähnliches Gefühl wie beim Reiten, wenn mein Pferd auf einer guten Geländestrecke beim Angaloppieren richtig durchstartete. Allerdings saß ich auf meinem Pferd wesentlich bequemer. Außerdem gefiel es mir nicht, wenn Ben bremsen musste oder wenn es bergab ging, denn dann rutschte ich immer nach vorn und hatte Angst, ihn beim Fahren zu behindern. Er nahm meine Hand und zeigte mir, wie ich mich bei Bedarf auf dem Tank abstützen konnte. Leider war die Landschaft recht hügelig, und so musste ich mich ziemlich oft abstützen. Die Handschuhe, die Ben mir gegeben hatte, waren mir ungefähr drei Nummern zu groß. Ich befürchtete, dass meine Hände herausrutschten, ich herunterkippte und er plötzlich mit meinen Handschuhen allein weiterfahren würde. Aber zum Glück achtete er äußerst sorgsam darauf, mich unterwegs nicht zu verlieren.
Als es auf die Autobahn ging, hatte ich das Gefühl, mir würde gleich der Kopf wegfliegen. Das lag daran, dass ich den blöden Kinnriemen nicht zugemacht hatte. Mist, ich konnte ja schlecht bei der Geschwindigkeit mit zwei Händen an meinem Helm herumbasteln! Also duckte ich mich ganz hinter Ben und hielt den Kopf so weit wie möglich unten. Er dachte sicher, ich würde mich in meiner Panik verstecken und mich nicht einmal mehr trauen, nach vorn zu schauen. Ich konnte ihn ja nicht einfach antippen und bitten, mal eben kurz rechts ranzufahren. Es blieb mir nichts anderes übrig, als in dieser verkrampften Haltung auszuharren, bis wir in die Stadt kamen. Wahrscheinlich war ich weltweit der einzige Beifahrer, der nach einem halbstündigen Ausflug mit dem Motorrad einen ausgewachsenen zweitägigen Muskelkater davontrug.
Irgendwann waren wir schließlich da, und ich schwor mir, nie wieder auf ein Motorrad zu steigen, ohne vorher mindestens drei Mal meinen Helm zu überprüfen. Wenigstens bot das Motorradfahren einen Vorteil bei der Parkplatzsuche: Eine kleine Parklücke, nahezu direkt vor dem Restaurant, reichte für uns. Ächzend ließ ich mich von der Sitzbank rutschen und nahm den Helm ab. Ich gab ihn Ben, der sich vor Lachen kaum einkriegte, als ich ihm den Grund für meine verkrampften Muskeln erläuterte.
»Ha«, feixte er, »und ich dachte schon, du bist zu alt als Biker-Braut!«
»Pass bloß auf, Kleiner!«, gab ich zurück und boxte ihn in die Seite. Ich beugte mich nach vorn und schüttelte meine Haare auf. Dann warf ich den Kopf schwungvoll nach hinten. Jetzt noch ein bisschen zurechtzupfen – fertig.
»Was?«, fragte ich Ben, der mich grinsend beobachtet hatte.
»Ich sag nur Wischmopp«, meinte er dreist. »Können wir jetzt endlich reingehen?«
»Ja, können wir«, schnaubte ich, »und du kannst froh sein, dass der Wischmopp so pflegeleicht ist. Sonst müsstest du dich nämlich länger gedulden.«
Eine Minute später betraten wir das »Senza Eguali«. Ich war angenehm überrascht, denn die edle, aber trotzdem gemütliche Einrichtung des Restaurants sorgte sofort für eine angenehme Atmosphäre. Ben hatte das Lokal als einen »guten Italiener, bei dem ich schon öfter gegessen habe« beschrieben. Ehrlich gesagt hatte ich daraufhin eine Pizzeria erwartet. Doch es handelte sich hier um ein richtiges italienisches Speiserestaurant. Ben steuerte einen freien Tisch an und zog mich an der Hand hinter sich her. Wir schälten uns aus unseren Lederjacken, hängten diese über die Lehne an unseren Stühlen und nahmen schließlich gegenüber voneinander Platz.
Im ersten Moment kam ich mir ein bisschen seltsam vor. Zwar waren wir schon oft spazieren und hin und wieder im Autokino gewesen. Aber abgesehen davon war es das erste Mal, dass wir miteinander ausgingen. Das Andromeda zählte nicht, denn dort waren wir bisher nie als Paar aufgetreten. Ich war an den Wochenenden immer in Begleitung von Janine oder meiner Freundin Carolina unterwegs, während Ben ja meistens nur dort arbeitete.
Doch schon ein paar Minuten später fühlte die Situation sich für mich fast normal an. Ein gutes Gefühl, wie ich fand. Bei Ben war ich mir nicht ganz sicher, ob er wirklich kein Problem damit hatte, hier mit mir gesehen zu werden. Ich wirkte neben ihm nicht unbedingt wie seine Großmutter, aber er sah so verdammt jung aus! Was ihn allerdings nicht davon abhielt, mit mir umzuspringen, als hätte er mich vollkommen unter der Fuchtel.
Ich gebe zu: Er hatte mich vollkommen unter der Fuchtel. Das ging schon bei der Getränkeauswahl los. Zur Feier des Tages bestellte ich mir als Aperitif einen Prosecco und zum Essen einen sizilianischen Wein. Ben als Fahrer musste sich mit Cola und Tafelwasser begnügen.
»Du trinkst zu viel Alkohol«, bemängelte er, kaum dass der Kellner sich von uns abwandte, um unsere Bestellung weiterzugeben.
»Ich bin erwachsen und kann selbst entscheiden, wie viel ich trinken will«, gab ich genervt zurück.
»Du musst aber später auch noch fahren«, beharrte er, »vergiss das nicht!«
Ich verdrehte die Augen. Dann beugte ich mich vor und sagte halblaut: »Ich brauche es zwar nicht, dass du mich bevormundest. Aber du darfst gern dafür sorgen, dass ich den Alkohol gründlich ausschwitze, bevor ich nach Hause fahre …«
Ben war kinderleicht zu provozieren und ich wusste das. Keine Ahnung, warum ich es dann bei jeder Gelegenheit tat und einen Streit riskierte. Meist war es ja auch gar nicht so, dass wir uns ernsthaft stritten. Nur wurde Ben immer ziemlich schnell ziemlich laut. Wobei er das stets vehement abstritt: »ICH SCHREIE NICHT! ICH REDE NUR MIT ERHOBENER STIMME! DU HAST MICH NOCH NICHT SCHREIEN HÖREN!«
Zum Glück beherrschte er sich jetzt und sprach auch nicht mit »erhobener Stimme«. Dafür packte er meinen aus Leder geflochtenen Halsschmuck und zog mich daran fast über den Tisch. »Ich weiß ganz genau, was du brauchst«, zischte er direkt vor meinem Gesicht, »nämlich, dass du dich so von mir bumsen lässt! – Also pass du lieber auf, was du dir wünschst!«
Die Gäste an dem Tisch schräg hinter ihm starrten uns entgeistert an.
Ich schluckte und sagte betont ruhig: »Ben, die Leute sehen schon her …«
Er ließ mich sofort los.
Ansonsten fielen wir (hoffentlich) nicht weiter auf. Es dauerte eine Weile, bis der Kellner uns das Essen brachte – ein Indiz dafür, dass hier alles frisch zubereitet wurde. Ben ließ sich sein »Scaloppine al limone« schmecken, ich hatte mich für »Paccheri con straccetti di manzo« entschieden, eine Art Riesen-Rigatoni mit Rinderfilet-Streifen. Beides war unheimlich lecker, trotzdem machten wir uns schon bald nach dem Essen auf den Weg nach Hause, das heißt zu Bens Wohnung. Schließlich hatten wir wie immer noch etwas anderes vor … Bevor ich dieses Mal allerdings aufs Motorrad kletterte, schloss ich sehr sorgfältig den Kinnriemen an meinem Helm. So war die Rückfahrt wesentlich angenehmer für mich als die Hinfahrt.
Später, als wir nach diesem anderen »Vorhaben« entspannt im Bett lagen, sagte Ben plötzlich aus heiterem Himmel: »Du hast mich von Anfang an belogen.«
»Wie bitte?«, fragte ich erschrocken.
»Es stimmt nicht, dass es dir nur um Sex geht. Du liebst mich. Und du würdest alles für mich tun.«
Ich schluckte und erwiderte, so sachlich es ging: »Ich habe dich nicht belogen. Ich habe nie behauptet, dass es mir nur um Sex geht. Und: Ich würde nicht alles für dich tun!«
Zumindest würde ich es nicht darauf ankommen lassen, was ich für ihn tun würde und was nicht …
»Du weißt, dass das mit uns nicht geht.« Mein Gott, jetzt kam der übliche Vortrag, den ich schon auswendig kannte. Ben hätte Prediger werden sollen. Für wie beschränkt hielt er mich eigentlich? Natürlich wusste ich, dass »das mit uns« nicht ging, er hatte es mir ja schon oft genug gesagt. Aber warum musste er uns damit den Abend verderben? Jetzt war ich hier bei ihm und jetzt ging es. Alles andere war doch völlig egal! Zum Glück war es dunkel, denn ich hasste es, wenn mir die Tränen kamen und er das sehen konnte. Schließlich änderte es nichts an unserem Dilemma, wenn mich hier bei ihm das Elend packte. Heulen konnte ich auch zu Hause.
Es gelang mir, dem sich anbahnenden Drama auszuweichen und irgendwie das Thema zu wechseln. Was »das mit uns« betraf, hatte ich mittlerweile die Technik des Verdrängens richtig ausgefeilt. Das Gleiche tat ich zu Hause – ich lebte praktisch zwei Leben. Wenn ich Bens Wohnung betrat, konnte ich mein anderes Leben komplett ausblenden. Nur andersherum funktionierte das nicht ganz so gut, denn ich konnte es mir kaum abgewöhnen, an ihn zu denken, wenn ich nicht bei ihm war. Aber ich arbeitete schwer daran …
***
Im Auto auf der Heimfahrt überlegte ich mir ständig, wie es so weit hatte kommen können. Warum war das alles überhaupt passiert? Und warum waren wir uns über den Weg gelaufen? War Ben zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen? Oder ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Oder war bei ihm die Zeit richtig gewesen und nur der Ort falsch? Oder bei mir die Zeit falsch, aber der Ort richtig? Es musste doch eine Erklärung geben, wieso die Dinge sich so entwickelt hatten. Ich machte mir einen Knoten ins Gehirn und mir platzte fast der Schädel. Aber es wollte mir einfach keine plausible Erklärung einfallen.
Die nächsten Tage vergingen Gott sei Dank ohne großartige Grübelei, denn dafür ließ mir der ganz normale Alltagswahnsinn gar keine Zeit. Mein Chef und ich waren mit den Vorbereitungen für eine wichtige Veranstaltung am kommenden Samstag beschäftigt. Als Franchisegeber eines langsam, aber stetig wachsenden Unternehmens lud Herr Abel einmal im Jahr all seine Franchisenehmer zu einem großen Fest ein. Dieses Event dauerte das ganze Wochenende und fand in seinem Ferienhaus im Schwarzwald statt. Dabei sollten sich die neuen Mitarbeiter vorstellen. Gleichzeitig konnten alle Unternehmensangehörigen wichtige Informationen und Erfahrungen untereinander austauschen. Dieses Jahr wollten mehr als zwanzig Franchisenehmer aus dem ganzen Bundesgebiet anreisen. Ich sah schon meinen freien Freitag in Gefahr, aber zum Glück kam ich mit ein paar Überstunden an den anderen Tagen davon. Ich musste eben beim Haushalt ein paar Abstriche machen, einen Zahnarzttermin verschieben und die Besuche im Reitstall auf abends verlegen – was den Bedürfnissen meines Vierbeiners sicher entgegenkam. Monamour war ein sehr liebes Pferd, aber nicht unbedingt sehr arbeitswütig. Seiner Meinung nach konnte bei Zeitmangel das anstrengende Training gern ausfallen und gleich übergangslos das Monamour-Verwöhnprogramm gestartet werden. Was bedeutete: bürsten, massieren, schmusen und natürlich fressen.
Obwohl die Woche also randvoll mit Tätigkeiten war, lief erstaunlicherweise alles reibungslos, und so konnte ich am Donnerstag pünktlich Feierabend machen und mich in aller Ruhe auf mein Date mit Ben vorbereiten. Ich hatte sogar Glück und kam so früh auf die Autobahn, dass ich nicht einmal im Stau stehen musste. Wahrscheinlich war ich dabei, einen neuen Rekord aufzustellen, denn ich schaffte die Strecke trotz des beginnenden Feierabendverkehrs in knappen siebzig Minuten. Wie gesagt, das funktionierte natürlich nur ohne dicken Stau. Manchmal brauchte ich auch über zwei Stunden. Doch an diesem Abend war ich schon gegen fünf da. Ich hörte Ben in der Küche werkeln, als ich meine Sachen in der Diele abstellte und meine Schuhe auszog. Barfuß tappte ich hinüber in die Küche.
Ben stand am Herd. Vor ihm in der Pfanne brutzelte schon das Fleisch fürs Abendessen. Ich stellte mich hinter ihn und fragte: »Kann ich dir helfen?«
Er antwortete: »Nein. Aber du kannst deine Hände bei dir lassen.«
Ich nahm meine Hände von seiner Hose und verschränkte sie hinter meinem Rücken. Selbst schuld. Was musste er auch unbedingt so kochen, wenn ich in der Nähe war. Nur in Jeans. Und mit nacktem Oberkörper.
Meine Hände hielten sich gegenseitig ganz fest. Doch ich konnte nicht auch noch gleichzeitig meine Zunge beaufsichtigen … Ich drückte mich leicht an ihn und küsste ihn auf den Hals. Ließ meine Zunge in seinem Nacken kreisen. Sich genüsslich an seiner Wirbelsäule entlangtasten. Er seufzte resigniert, drehte sich blitzschnell zu mir um, schob mir seine Zunge in den Mund und drängte mich zum Küchentisch. Er hob mich auf die Tischplatte, wobei mein Rock von allein hochrutschte, und zog mir den Slip aus. Ich lehnte mich stöhnend zurück, während er meine Beine hochhob, meine Fersen auf der Tischkante abstellte und mir dabei die Knie auseinanderdrückte. Bevor ich richtig Luft holen konnte, hatte ich ihn bereits tief in mir. Die Welt um mich herum hörte auf zu existieren, ich fühlte nur noch Ben, wie er sich in mir bewegte, alles andere war weit weg. Er drückte meine Knie noch mehr auseinander, denn so konnte er genau sehen, was er mit mir tat: Wie er ganz in mir verschwand, dann wieder fast aus mir herausglitt, um gleich darauf erneut in mir zu versinken …
Der Geruch nach zu stark gebratenem Fleisch holte uns plötzlich und sehr unsanft zurück in die Gegenwart.
»Oh Scheiße!«, fluchte Ben.
Er löste sich ziemlich ernüchternd von mir, zog eilig seine Hose hoch und die Pfanne vom Herd. Ich rutschte von der Tischplatte, und zwar ganz langsam und vorsichtig. Wie immer nach solchen Aktionen hatte ich ein kleines Problem mit meinem Kreislauf. Wahrscheinlich lag das daran, dass ich Ben im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend fand.
Ich sah ihm über die Schulter und sagte: »Jetzt sind sie wenigstens schön knusprig.«
Er sagte gar nichts. Denn was sein Abendessen betraf, verstand er absolut keinen Spaß. Er ging zum Kühlschrank, um noch etwas Pflanzenfett zu holen. Die Schnitzel waren nämlich nur auf einer Seite angebraten – eine Seite angekokelt, die andere roh. Das machte nichts, denn momentan interessierte mich das Essen nicht die Bohne. Im Gegensatz zu Ben konnte ich nicht einfach einen Schalter umlegen und meine Erregung ausblenden.
Ich streichelte seinen Rücken und drückte mich an ihn. Als er die Kühlschranktür geschlossen hatte, drehte er sich zu mir um. Ich küsste ihn. Auf den Mund, den Hals, die Brust. Seine Brustwarzen übten eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Ich liebte es, mit ihnen zu spielen, an ihnen zu lecken, zu saugen und zu knabbern. Ben gefiel es auch, wenn ich das tat. Während meine Zunge auf diese Weise beschäftigt war, blieben auch meine Hände nicht untätig: Sie öffneten seine Jeans, dann rutschte ich an seinem Körper entlang nach unten, wobei ich die Hose gleich wieder mit herunterzog. Als ich auf dem Küchenboden vor ihm kniete, befreite ich seinen Schwanz, dem es in seinem Slip sicher viel zu eng war, denn er war noch immer ganz hart und streckte sich mir erwartungsvoll entgegen. Ich fasste ihn an, streichelte mit den Fingern über seine Spitze, über die samtig weiche Haut dort. Bens Atem ging schneller, als ich mein Lieblingsspielzeug fest mit der Hand umspannte und es zu massieren begann. Gleichzeitig schlängelte meine Zunge sich um seine Hoden. Mal zog sie langsame Kreise, mal schnellte sie vor und zurück.
Ben stand mit geschlossenen Augen da, eine Hand in meinem Nacken, die andere in meine Haare gekrallt. Er seufzte leise, als meine Zunge seine Hoden verließ, um sich am Schaft entlang nach oben zu tasten. Als sich meine Lippen fest um seine Spitze schlossen, hielt ich einen Moment inne. Dann saugte ich ihn langsam ein, und während er Millimeter für Millimeter in mich hineinrutschte, streichelte ihn meine Zunge mit sanftem Druck. Als ich ihn so tief aufgenommen hatte, wie es ging, ließ ich ihn in meinem Mund hin- und hergleiten, sodass er abwechselnd an den Wangeninnenseiten anstieß. Ben keuchte vor Erregung. Mein Mund ließ ihn los, damit meine Zunge wieder seine Hoden lecken und meine Hand ganz fest seinen Schwanz reiben konnte. Fester und schneller, als mein Mund das tat. Immer schneller, bis ich merkte, dass er kurz vor dem Höhepunkt war. Dann nahm ich ihn wieder in den Mund. Er kam mit einem lauten, lang gezogenen Stöhnen, während ich es genoss, seinen heißen Saft langsam meine Kehle hinunterrinnen zu lassen … Ich wartete noch ein wenig, bis er sich beruhigte und aufhörte zu zucken. Dann löste ich mich sanft von ihm und stand auf. Ben war fast ein bisschen benommen, sein Orgasmus war wohl ziemlich stark gewesen.
Er drückte mich fest an sich und sagte innig: »Du bist die Beste …«
Ich dachte: Und hoffentlich die Einzige! Doch ich erwiderte die Umarmung und sagte schlicht: »Ich weiß.«
Nach dem Abendessen entschlossen wir uns, noch ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Es war warm und sonnig. Also schlenderten wir Arm in Arm durch den kleinen Ort. Anscheinend hatte Ben kein Problem damit, dass man uns in Steinlingen in derart eindeutiger Pose zusammen sah. Mehr noch, meistens provozierte er mich auf unseren Spaziergängen die ganze Zeit. Er wusste, dass ich immer heiß auf ihn war, und es machte ihm Spaß, mich zu reizen. Ben amüsierte sich sicher köstlich über mich und meine Hilflosigkeit. So drückte er mich zum Beispiel einfach ohne Vorwarnung an irgendeinen Zaun und schob mir seine Zunge in den Mund oder er küsste meinen Hals und flüsterte mir nette Dinge ins Ohr.
Gut, es waren keine netten Dinge. Ben war niemals nett … Es waren immer Dinge, bei denen ich Atembeschwerden bekam. Diese Spielchen sind gefährlich, denn man verliert schnell den Bezug zur Realität. Ich hätte mich wahrscheinlich auf der Motorhaube des nächstbesten parkenden Autos von ihm ficken lassen und mich erst hinterher dafür geschämt … oder überhaupt nicht? – Jedenfalls hatte er die Situation immer im Griff, und das war gut so. Eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses war das Letzte, was wir brauchen konnten. Allerdings hatte er Glück, dass ich ihm körperlich unterlegen war. Und es gab im Ort auch viel zu wenige Büsche und Sträucher – sonst hätte ich ihn vermutlich einfach irgendwo hineingezerrt.
Wir gingen Hand in Hand eine stark ansteigende Straße entlang, die sich zwischen gepflegten Einfamilienhäusern hindurchschlängelte. Ab und zu wurden wir von einem Auto überholt.
Ben sagte: »Sieh mal, die fahren alle ganz langsam, damit sie besser gucken können.«
»Ach was, von hinten sieht man doch gar nicht, dass ich älter bin als du!«, gab ich ärgerlich zurück.
»Nein, das meine ich nicht«, erwiderte er ruhig. »Sie gucken nur alle, weil ich eine so schöne Frau im Arm halte.«
Das war aber verdammt dick aufgetragen. Ich zog schon den Kopf ein in Erwartung irgendeines Zusatzes. Er machte mir normalerweise keine Komplimente. Wenn er es doch tat, kam gewöhnlich, noch bevor ich mich darüber freuen konnte, ein kleiner verbaler Hammer hinterher. So in der Art: »Du hast echt tolle Beine … für dein Alter.«
Doch er sagte nichts mehr, also entspannte ich mich vorsichtig wieder. Ich sah an mir herunter. Dabei entdeckte ich weißliche angetrocknete Flecken auf meinem schwarzen Rock. Ich nahm mir vor, in Zukunft besser aufzupassen. Oder mich wenigstens untenherum ganz auszuziehen, wenn ich Ben beim Kochen half. Oder zumindest meine Kleidung genauer zu betrachten, bevor ich seine Wohnung verließ. Er sah die Spermaspuren auch – sie waren schließlich nicht zu übersehen – und sagte lachend: »Oh, sieh mal, lauter kleine Bennys!«
Ein paar Minuten später kam er dann doch noch, der verbale Hammer. Wir waren auf dem Rückweg, als uns ein junges Mädchen entgegenkam. Natürlich musste er hinter ihr herglotzen.
»Willst du ihre Telefonnummer?«, fragte ich ihn spöttisch.
»Wie willst du das denn anstellen?«, lautete die Gegenfrage.
»Ganz einfach«, erklärte ich, »wir drehen jetzt um, gehen ihr nach und ich sage zu ihr: Hallo, mein Freund hier hätte gern deine Telefonnummer.«
»Ich bin nicht dein Freund!«
Autsch, das hatte gesessen. Eine Ohrfeige hätte sicherlich nicht mehr wehgetan. »Gut, wenn wir keine Freunde sind, was sind wir dann?«
Er hatte recht. Wir hatten keine Freundschaft. Wir hatten eine Fickbeziehung. Eine Affäre, ein Verhältnis oder wie auch immer man das etwas vornehmer ausdrücken könnte. Ich betrog mit ihm meinen Mann. Und er betrog mit mir sich selbst.
Er blieb mir die Antwort auf meine Frage schuldig. Nun, ich war Kummer gewöhnt, ich kannte ihn ja schon ein Weilchen. Das waren die Momente, in denen mir bewusst wurde, wie jung er tatsächlich noch war. Ich ließ die Kränkung an mir abprallen und ging einfach darüber hinweg. Manchmal hatte es eben auch seine Vorteile, ein paar Jährchen älter und kein blondes Püppchen zu sein.
Wir überquerten die Hauptstraße und kamen an einen kleinen Bach. Auf der Brücke blieben wir stehen. Ich lehnte mich an das Geländer und sah hinunter ins Wasser. Ben umarmte mich zärtlich von hinten und drückte sich an mich.
Als auf dem Parkplatz neben der Brücke eine protzige Limousine anhielt, flüsterte er mir ins Ohr: »Schau mal, der geile alte Sack in dem Auto ist bestimmt neidisch. Was denkst du, was er tut, wenn ich dich jetzt nehme, hier auf dem Brückengeländer?«
Vermutlich wollte er diese Idee kaum in die Tat umsetzen. Sein Ziel war lediglich, mich zu provozieren. Auszuloten, inwieweit ich mich darauf einließe. Mir zu zeigen, wie leicht es für ihn war, mich auf Hochtouren zu bringen, indem er einfach nur mein Kopfkino anknipste.
Ich antwortete einigermaßen beherrscht: »Wir sollten jetzt besser zurückgehen.«
Dennoch konnte ich ein erregtes Keuchen nicht unterdrücken. Er hatte also wieder einmal gewonnen, denn er gewann sie immer, diese Spielchen. Ben lachte leise, nahm meine Hand und zog mich weiter. Ich verstand einfach nicht, warum er so viel Macht über meinen Körper hatte. Und ich schämte mich wieder einmal dafür. Doch ich rächte mich, als wir nach Hause kamen …
Wir hatten kaum die Wohnung betreten, als das Telefon klingelte. Walter, sein alter Herr, war am Apparat. Es war sehr amüsant für mich, Ben zu beobachten. Zu hören, wie er sich bemühte, normal zu sprechen, während ich ihm die Hose öffnete und sie langsam herunterzog. Um dann genießerisch meiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen: lecken … saugen … streicheln … mit den Fingern … den Lippen … der Zunge, sogar mit den Zähnen …
Dieses provokante Spielchen trieb ich immer mit ihm, wenn er telefonierte. Denn ich mochte es nicht, wenn er sich in den wenigen kostbaren Stunden, die wir für uns hatten, mit anderen Dingen beschäftigte.
Beim ersten Mal hatte er hinterher zu mir gesagt: »Das kannst du doch nicht machen! Mir einen blasen, wenn ich jemanden am Telefon hab!«
»Du siehst doch, dass ich es kann.«
Ich wusste genau, dass es ihm gefiel.
»Nein, Walter, ich bin nicht krank … Jaaa … es ist alles in bester Ordnung …« (stöhn).
Sein Vater wusste nicht, dass ich da war. Aber ich sorgte schließlich dafür, dass er es bemerkte … Ben beendete das Gespräch, indem er irgendetwas von seiner Katze erzählte, um die er sich jetzt kümmern müsse. Walter fragte sich bestimmt: welche Katze?
Als er das Telefon zur Seite gelegt hatte, sah er mich tadelnd an und sagte: »Du bist ein Luder.« Und dann fiel er auf dem Wohnzimmerboden über mich her.
***
Die nächsten Tage bemühte ich mich, meine schmerzenden Arme zu verbergen, denn ich hatte mich übel am Teppichboden verbrannt. Es dauerte eine Weile, bis sich auf meinen Ellbogen Krusten bildeten. Zum Glück trug ich selten derart auffällige Spuren, wenn ich von Ben nach Hause kam. Zumindest keine äußerlich sichtbaren. Es kam ab und zu vor, dass ich irgendwo blaue Flecke hatte. Gut, es kam öfter vor, das mit den blauen Flecken. Aber meine Haut war auch sehr empfindlich. Einmal biss er mich in den Hals, was man fast die ganze Woche sehen konnte. Doch zum Glück fiel es meinem Mann nicht auf. So genau betrachtete Oliver mich gar nicht. Nicht einmal den blauen Gebissabdruck auf meiner rechten Pobacke entdeckte er. Den hatte mir Ben beim Herumalbern auf einem unserer Spaziergänge verpasst. Er hatte unbedingt seine Inliner anziehen wollen – das Kind im Manne eben. Ich weigerte mich standhaft, ihn eine steil ansteigende Straße hochzuziehen. Das war ein Fehler, ein sehr schmerzhafter Fehler.