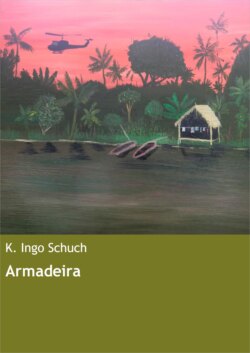Читать книгу Armadeira - K. Ingo Schuch - Страница 4
Prolog. Die Xa’o
ОглавлениеNordwestlich von Itaituba, Bundesstaat Pará, Brasilien.
Die onça duckte sich unter die Farne. Ihr Schwanz peitschte den Boden. Misstrauisch spähte sie zwischen den Bäumen hindurch und versuchte zu erkennen, ob ihr eine Gefahr drohte.
Die Katze war hungrig. Seit Wochen musste sie sich mit Kleingetier begnügen, die guti, paka und Sumpfhirsche waren längst vor dem Lärm und Gestank geflüchtet, der immer unerbittlicher den Wald durchdrang. Bereits aus großer Entfernung hatte sie heute der unwiderstehliche Duft des Blutes herangeführt. Außer dem anschwellenden Zirpen der Zikaden und dem Schnattern der Sittiche hoch oben in den Bäumen war jetzt nichts zu hören. Die Sonne war bereits hinter den Bäumen versunken, aber die onça sah auch im Dämmerlicht noch ausgezeichnet. Sie prüfte nochmals die Witterung, dann betrat sie die Lichtung. Ihr Kopf pendelte hin und her und sie war bereit, bei dem geringsten Anzeichen von Gefahr das Weite zu suchen.
Nach wenigen Schritten hatte sie ihr Ziel erreicht. Die Raubkatze stieß ein heiseres Grollen aus und fletschte die Zähne. Ihre Beute bewegte sich nicht. Das Wesen war tot. Wolken von Fliegen schwirrten um den Körper. Sie schnupperte an der Leiche. Ihre Barthaare sträubten sich, aber ihr Hunger siegte über die Abscheu vor dem fremden Geruch. Mit ihrer rauen Zunge leckte sie das getrocknete Blut auf, das aus der Halswunde ausgetreten war, dann schlug sie gierig ihre Zähne in den Kadaver.
Plötzlich kam etwas geflogen und ein brennender Schmerz fuhr ihr in die Schulter. Die onça fauchte laut vor Ärger und Überraschung und warf sich herum. Sie spannte ihre Sehnen zum Sprung auf den unsichtbaren Feind, aber etwas ließ sie zögern. Vor ihren Augen schien plötzlich alles zu verschwimmen. Mit den Zähnen versuchte sie den brennenden Stachel aus ihrem Fell zu ziehen, aber er löste sich nicht. Sie hustete und hockte sich auf den Boden. Der Schmerz wanderte in ihre Eingeweide, ihre Muskeln erlahmten. Schon bald konnte sie den Kopf nicht mehr oben halten. Die Zunge hing ihr aus dem halb geöffneten Rachen, dunkler Speichel troff zwischen den riesigen Reißzähnen hervor. Ihre Flanken zuckten bereits heftig im Todeskampf. Dann streckten sich ihre Beine. Ihre gelben Augen wurden glasig.
Padre Jerome setzte das Blasrohr mit zitternden Händen ab. Normalerweise erlegten die Xa’o mit ihren Waffen paka, Vögel oder kleinere Affen. Er wusste aber, dass das spezielle Gift, das sie zum Präparieren ihrer Pfeile benutzen, auch ein größeres Tier wie ein pekari schnell und zuverlässig tötete. Der Padre tat ein paar zaghafte Schritte auf den Jaguar zu und stieß ihn mit dem Fuß an. Das Ungeheuer war warm und weich und regte sich nicht.
Er blickte von dem toten Tier hinüber zu der Leiche des Mannes. Die Kleidung machte ihm schmerzhaft bewusst, dass es sich um Doktor Montand handelte. Der stets fröhliche Ethnologe aus Belém lag kalt und tot auf dem Waldboden. Der Zersetzungsprozess hatte bereits begonnen. Käfer krabbelten durch die leeren Augenhöhlen. Sein Kopf war bis zum Gebiss herunter gespalten, wohl durch den Hieb mit einem Buschmesser.
Der hagere Mann mit dem lichten Haar und dem notdürftig geflickten Habit wandte sich ab. Ein Wimmern entrang sich seinen bebenden Lippen in Erahnung dessen, was ihn im Zelt erwarten mochte. Durch die Blätter der Bäume drang ein letzter Lichtrest und zeichnete die Silhouetten der Gegenstände nach. Das Zelt diente der Familie als Schlafstätte. Es duckte sich gegen eine einfache, mit Palmwedeln gedeckte Hütte, auf der einige Metallkisten standen, die gleichermaßen als Schreibtisch und Kleiderschränke dienten und zudem das wissenschaftliche Gerät von Doktor Montand beherbergten.
Padre Jerome hob die Plane an und warf einen Blick ins Halbdunkel. Vitória Montand lag auf dem Boden. Sie war nackt. Man hatte ihr den Hals von einem Ohr zum anderen aufgeschnitten. Ihr Blut hatte auf der Erde eine schwarze Pfütze gebildet. Dutzende, nein hunderte Insekten labten sich an der klumpigen Masse. Jerome konnte den Anblick nicht ertragen, er erhob sich und taumelte durch den Eingang ins Freie. Würgend und spuckend erbrach er seine letzte Mahlzeit in einen Busch. Dann lies er sich auf die Knie sinken. Seine Schultern bebten, er weinte lautlos. Anklagend blickte er hoch zum Blätterdach. Er wollte etwas sagen, wollte schreien, wollte Gott alles entgegen schleudern. Aber sein Gott würde nicht antworten. Er hatte noch nie geantwortet. Hoffnungslos verbarg er sein tränennasses Gesicht in den zitternden Händen.
Plötzlich vernahm er einen erstickten Laut. Es klang wie das Winseln eines kleinen Hundes. Padre Jerome wischte sich mit dem Ärmel über die Augen, fasste das Blasrohr wie einen Prügel und erhob sich mit einem Ächzen. Vorsichtig trat er näher heran und blinzelte zwischen den Kisten hindurch. Zaghaft hob er das Deckenbündel an. Darunter kauerte ein Mädchen. Sie hatte sich zusammen gekrümmt und hielt etwas fest umklammert. Jetzt stieß es wieder einen klagenden Laut aus, dem nichts Menschliches innewohnte.
Der padre beugte sich behutsam zu dem Kind herab. »Yara!« Aus leeren Augen blickte sie durch ihn hindurch und schien seine Anwesenheit nicht zu bemerken. Das Grauen darüber, was man ihren Eltern angetan hatte, musste ihr die Sinne vernebelt haben. Wohl eine Art Schutzmechanismus. Widerstandslos ließ sie sich hochnehmen. Das Mädchen hing schlaff in seinem Armen. Ihre einfache, aus Hartholz geschnitzte Puppe hielt sie fest.
Padre Jerome überlegte nicht lange. Er musste sie von hier weg bringen, falls die hierher zurück kamen, die ihre Familie getötet hatten und die ungefähr zwei Dutzend Mitglieder des Stammes, die zerhackt und erstochen in und vor den primitiven Hütten lagen. Dem Zustand der Leichen nach zu urteilen, lag das Gemetzel schon mindestens vierundzwanzig Stunden zurück.
Er setzte das Kind behutsam an einem großen Mahagonibaum ab. Sie musste völlig dehydriert sein. Aus einem Flaschenkürbis flößte er ihr vorsichtig ein paar Schlucke Wasser ein. Das Mädchen trank gierig, ohne aus seinem apathischen Zustand zu erwachen. Hin und wieder stieß sie ein gequältes Stöhnen aus. Nun sah er, dass ihre Beinchen blutverschmiert waren. Diese Tiere! Sie hatten das Kind missbraucht und liegen lassen wie einen benutzten Gegenstand! Der Padre holte die Decke und legte sie über das Kind. Nach einer Weile schloss sie die Augen und versank in einen unruhigen Dämmerschlaf.
Padre Jerome machte sich an die Arbeit. Anfangs trug, später schleifte und zerrte er die getöteten Xa’o auf einem Haufen zusammen. Zwischendurch musste er immer wieder inne halten, weil ihm der Verwesungsgeruch fast die Sinne raubte. Hier lag Páohi, daneben seine Tochter Kahái, auch sie war offenbar geschändet worden, dort drüben der kleine Baai, der immer so zahnlos gegrinst hatte, wenn er mit den anderen Kindern Taranteln mit Stöcken zum Wettlauf angetrieben hatte.
Für die Montands hob er eine Grube aus und steckte ein aus zwei Ästen notdürftig zusammengebundenes Holzkreuz darüber. Wo die primitiven Geräte, die er im Lager gefunden hatte, nicht ausreichten, nahm er seine Hände zu Hilfe. Der Mond spendete ihm dabei sein spärliches Licht. Stunden später war es getan. Über den Leichen der Xa’o hatte er aus den Ästen und Palmwedeln der Hütten einen großen Haufen aufgetürmt.
Jetzt nahm er das Feuerzeug, das Montand gehört hatte, und entzündete den Stapel.
Nach einer Weile zauberte der Feuerschein gespenstische Schatten auf die Baumriesen, die die Siedlung umgaben. Dutzende von Faltern und anderen fliegenden Insekten flatterten sinnentleert durch den Rauch ins Feuer und versengten. Hoch in den Bäumen ertönte das aufgeregte Gebell der Brüllaffen, ein paar Papageien protestierten.
Padre Jerome stierte in die Feuersbrunst, bis ihn die Augen brannten. Er war aufgewühlt und verzweifelte fast an seinen widersprüchlichen Gefühlen, die ihn letztendlich in den Dschungel getrieben hatten. Dann rezitierte er mit sonorer Stimme aus einem uralten Klagelied:
»...aber ich rief deinen Namen an, o Herr, tief unten aus der Grube!
Du hörtest meine Stimme: Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf!
Du nahtest dich mir an dem Tag, als ich dich anrief; du sprachst: Fürchte dich nicht!
Du führtest, o Herr, die Sache meiner Seele; du hast mein Leben erlöst!
Du hast, o Herr, meine Unterdrückung gesehen; schaffe du mir Recht!
Du hast all ihre Rachgier gesehen, alle ihre Anschläge gegen mich.
Du hast, o Herr, ihr Schmähen gehört, alle ihre Pläne gegen mich, das Gerede meiner Widersacher und ihr dauerndes Murmeln über mich.
Sieh doch: Ob sie sich setzen oder aufstehen, so bin ich ihr Spottlied!
Vergilt ihnen, o Herr, nach dem Werk ihrer Hände!
Gib ihnen Verstockung des Herzens; dein Fluch komme über sie! Verfolge sie in deinem Zorn und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg! «
Die Xa’o lebten auf einer natürlichen Lichtung unweit des Flusses, der Quelle allen Lebens war. Sie hatten ihre einfachen Hütten errichtet, wie es viele Generationen vor ihnen getan hatten und rangen dem Urwald das Lebensnotwendige ab. Die Männer gingen fischen oder jagen, die Frauen bauten etwas Mais und Maniok an. Die Xa’o hatten kaum Kontakt zu Fremden, nur zu den Flusshändlern, die ab und zu mit ihren Booten den Seitenarm des Rio Anapu heraufkamen.
Eines Tages kam ein nicht mehr ganz junger weißer Mann zu ihnen. Er sah aus wie einer der Missionarios, die einst die ersten Weißen gewesen waren, denen die Xa’o vor langer Zeit begegnet waren. Der Fremde nannte sich padre Jerome und er kam ohne Waffen und ohne Versprechungen. Er war alleine und seine Augen waren ohne List. Von ihm schien keine Gefahr auszugehen und so duldeten sie ihn in ihrer Mitte.
Der padre kam immer wieder. Mit der Zeit hatten die Xa’o sich daran gewöhnt, dass er abends mit ihnen am Feuer saß und versuchte, ihren Geschichten von den Ahnen und den Waldgeistern zu folgen. Unter ihnen sprachen und verstanden zwei Männer einige Brocken "krummer Hals", wie sie die portugiesische Sprache nannten. Die Xa’o waren freundlich und lachten gemeinsam mit ihm über seine Versuche, ihre eigene tonale Sprache zu erlernen, die für sie "gerader Hals" war und die mit drei Vokalen und sieben Konsonanten auskam.
Sie ließen ihn mit dem Bogen und dem Blasrohr auf Cupuaçu-Früchte zielen und dann durfte er die Männer zum Fischen und auf die Jagd begleiteten. Der padre versuchte ihnen zu erklären, dass ihre Art zu leben ihm sehr gefiel. Er sprach nicht darüber, wohin er ging, wenn er sie wieder flussabwärts für Tage, Wochen oder Monate verließ und sie fragten nicht danach.
An einem regnerischen Tag im Sommer kam Jerome nicht alleine. In seiner Begleitung befanden sich ein Mann und eine Frau. Sie brachten ihre kleine Tochter mit. Das Mädchen mochte vier Jahre alt sein. Sie kamen mit einem langen canoa den Fluss herauf, das zudem mit Gepäckstücken und einigen merkwürdig aussehenden Gerätschaften beladen war. Die Fremden erklärten mit Unterstützung des Padre, dass sie gerne einige Zeit bei den Xa’o leben würden. Doktor Jacques Montand war Dozent für Linguistik und Ethnologie an der Universität von Belém und er wollte in einem gemeinsamen Projekt mit der FUNAI untersuchen, welche sozialen Strukturen die Xa’o sich ohne engeren Kontakt zur Außenwelt erhalten hatten und wie ihr Verhältnis zu anderen indigenen Völkern war. Man hatte keine klare Vorstellung, wie viele Stämme oder Gruppierungen noch ohne den segensreichen oder zerstörenden zivilisatorischen Einfluss in den Wäldern Amazoniens lebten.
Vitória Montand arbeitete an der Universität als wissenschaftliche Assistentin im Fachbereich Zoologie und sie interessierte sich sehr für die Biodiversität des noch weitestgehend unberührten Waldes. Sie hatte den Franzosen auf einer früheren Reise in die Regenwälder Paraguays kennen und lieben gelernt. Es war klar, dass die Xa’o weder wussten, was eine Universität war noch jemals von der FUNAI gehört hatten. Padre Jerome versuchte, den Sinn einer Indianerbehörde in ihre Sprache zu übersetzen, aber das war schier unmöglich. Den Xa’o fehlte jegliche Vorstellung von Organisationsformen, die komplexer waren als ihre Clanstruktur.
Páohi war so etwas wie der Stammesälteste oder Häuptling. Er lachte viel und war wie alle Xa’o ohne Arglist. Er bedeutete den Fremden, dass sie natürlich ihr Tapýi aufstellen durften, deren graue Leinenwände sich gegenüber dem Tiefgrün des Waldes deutlich hervorhoben. Die Xa’o halfen den Fremden beim Ausladen der höchst ungewöhnlichen Gerätschaften und nach einiger Zeit hörten die Kinder auf, sich über ihre helle Haut und ihre Kleidung lustig zu machen. Das kleine Mädchen hieß Anaïs, aber die Xa’o nannten sie Yara. Sie sagten, mit ihrem langen Haar und ihren Augen in der Farbe des Honigs sehe sie aus wie ein Mãe-d’água, eine Sirene, die in den Flüssen lebt und mit ihren Liedern die Männer verzaubert.
Padre Jerome saß die ganze Nacht auf dem Boden bis die Glut erloschen war. In seinen Armen wiegte er die kleine Yara. Er hatte ihr behutsam das Blut abgewischt und sie in ein Tuch eingewickelt. Irgendwann hatten sie endlich zusammen weinen können.
Am nächsten Morgen fuhr er in seinem Boot mit ihr fort.
Siebzehn Jahre später. In der Nähe von Santarém, Pará
Dem alten Mann war kalt. Schwester Maria hatte eine Wolldecke mitgebracht und sie über seine dürren Beine gebreitet, aber die Kälte kam von innen. Er spürte, wie seine Lebenskraft mit jedem rasselnden Atemzug aus seinem ausgemergelten Körper sickerte. Er war aber noch nicht bereit, seinem Schöpfer entgegen zu treten. Es gab da etwas, das wie ein Bleigewicht auf seiner Brust lastete. Ächzend versuchte er sich auf seinem einfachen Lager aufzurichten. Wieder schüttelte ihn ein Hustenanfall. Er spuckte roten Schleim in das Taschentuch, das die Schwester ihm vor den Mund hielt. Als der Anfall verebbt war, flößte Maria ihm etwas Wasser ein. Aus seinen tief in den Höhlen liegenden Augen sah er das Mädchen dankbar an. Er umklammerte ihren Arm. Seine Hand wirkte wie die Klaue eines Skeletts. Sie brachte ihr Ohr ganz nah an seinen Mund. Sein Atem roch sauer und faulig.
Mit zittriger Stimme bat er sie: »Bitte. Hol die Abadessa, ich muss beichten, bevor es mit mir zu Ende geht«.
Oberin Anthelma Schellnhuber war bereits in den frühen achtziger Jahren aus Österreich nach Santarém gekommen. Vor nunmehr elf Jahren hatte man sie zur Äbtissin gewählt und seitdem bestellte sie zusammen mit ihren Mitschwestern unermüdlich den Garten des Herrn in diesem wundervollen Land mit seinen einfachen und dankbaren Menschen.
Vor zwei Tagen hatten Indios den gebrechlichen Bruder im Glauben auf dem Rücken eines Esels her gebracht. Er war unschwer als Mitglied des Ordo fratorum minorum zu erkennen. Das Mutterhaus war in einem alten Kloster aus dem 16. Jahrhundert untergebracht, das den gleichen Namen trug wie die Kathedrale Nossa Senhor da Conceição, in der der Bischof residierte.
Die Benediktinerinnen hatten den alten Mann - er mochte die Sechzig überschritten haben, aber aufgrund seines jämmerlichen Zustands wirkte er deutlich älter - ganz am Ende des Zellengangs untergebracht.
Die Äbtissin hatte in der Heimat als einfache Ordensschwester einige Zeit in einem Hospital gearbeitet. In der Neuen Welt hatte sie bereits Fälle von hämorrhagischem Denguefieber gesehen. Die Haut des padre wies die typischen roten Punkte auf und sein Zahnfleisch sah aus wie eine frische Wunde. Anthelma musste sich anstrengen, um das Flüstern des alten Mannes zu verstehen. Sein Bericht wurde immer wieder von Hustenanfällen unterbrochen. Nach einiger Zeit erhob sie sich, um ihm frisches Wasser zu holen. Als sie zurückkam, blickten die Augen des Bruders starr zu Decke. Sie drückte ihm sanft die Lider zu und betete ein Ave Maria für seine arme Seele.
Am nächsten Tag machte sie sich auf den Weg in die Stadt. Was der Bruder ihr berichtet hatte, musste sie der weltlichen Gerichtsbarkeit anvertrauen. Gott würde die Missetäter strafen, aber es konnte nicht schaden, die Behörden ebenfalls darüber zu informieren.
Auf der Delegacia de Polícia tippte ein tüchtiger Beamter in makelloser Uniform ihre Aussage mittels einer uralten Schreibmaschine in das dafür vorgesehenen Formular. Das Schriftstück gelangte zunächst auf den Schreibtisch des Diensthabenden Kommissars, der es pflichtgemäß durchlas und abzeichnete. Danach wanderte es in einem Ordner in den Aktenschrank, der in den sechziger Jahren eine Amtsstube in der Hauptstadt verziert haben mochte.