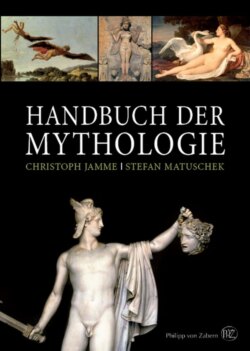Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 29
Dionysos
ОглавлениеDionysos (lat. Bacchus; Liber), der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit, aber auch des Tanzes und des Theaters, wird im Mythos als das jüngste Kind von ▸ Zeus bezeichnet (vgl. Homer, Ilias XIV, 325), das dieser mit Semele, einer Tochter des Thebanerkönigs Kadmos, zeugte. Er gehört jedoch zu den ältesten bezeugten griechischen Göttern, die Ursprünge seines Kultes reichen bis in das zweite Jahrtausend v. Chr. zurück. Seine Bedeutung für die griechische Religion und Kultur ist immens: Zu Dionysos’ Ehren wurden allein in Athen jährlich fünf Feste gefeiert, sein Kult ist bis in die entlegensten Orte der hellenistischen Welt verbreitet, und die außergewöhnliche Art seines Wirkens wird in zahlreichen mythischen Versionen und ikonographischen Darstellungen sowie in dem längsten erhaltenen Epos aus der Antike, in Nonnos’ Dionysiaka (5. Jh. n. Chr., 48 Bücher), beschrieben.
Ungewöhnlich sind bereits die Umstände von Dionysos’ Geburt: Als Hera erfährt, dass Semele von Zeus schwanger ist, rät sie ihrer sterblichen Nebenbuhlerin, diesen zu bitten, ihn in seiner wirklichen Gestalt zu sehen. Zeus erscheint ihr daraufhin als Blitz, durch den Semele getötet wird, aber er rettet das Kind und trägt es in seinem Schenkel aus. Durch die doppelte Geburt geht Dionysos symbolisch von den sterblichen Menschen zu den Unsterblichen über. Die Vasendarstellung dieser Szene identifiziert den Gott (und die übrigen Figuren) dabei nicht nur durch Beischriften, sondern fügt auch seine wichtigsten Attribute, die Efeuranken und den Thyrsosstab (mit Pinienzapfen), hinzu. Das dritte für Dionysos charakteristische Attribut, den Wein bzw. das Trinkgefäß, sieht man zwar nicht, es ist aber für den Betrachter insofern präsent, als das Gefäß, auf dem sich die Darstellung befindet, ein Volutenkrater, also ein Gefäß zum Mischen von Wein, ist.
Dionysos soll in Nysa unter der Obhut von Nymphen erzogen worden sein und später die kretische Königstochter Ariadne geheiratet haben. Diese war mit ▸ Theseus nach der Tötung des Minotauros von Kreta nach Naxos geflohen, wo sie jedoch am Strand zurückgelassen und von Dionysos gefunden wurde. Die Ehe mit Ariadne lässt sich symbolisch mit einem der wichtigsten Kultaspekte des Dionysos, dem ekstatischen Tanz, in Verbindung bringen, da mit Ariadne, die auf Kreta einen eigenen Tanzplatz (chorós) gehabt haben soll, eine tanzende Frau zur festen Begleiterin des Dionysos wird. Der Tanz ist ein erster Schritt auf dem Weg zur göttlichen Raserei, die alle befällt, die mit Dionysos Umgang haben und die er in Ekstase zu irrationalen Handlungen verführt: So besteht sein weibliches Gefolge aus rasenden Frauen, sogenannten Mänaden (zu gr. mainesthai, ‚rasen‘), die nachts durch die Wälder streifen und mit bloßen Händen Tiere erjagen und zerfleischen. Doch auch vor Menschen machen die Mänaden nicht halt: Mütter erkennen ihre eigenen Kinder nicht mehr und zerreißen sie, wie es Euripides in den Bacchen am Beispiel der Agaue schildert, die ihren Sohn, den thebanische König Pentheus, auf diese Weise tötet. An dieser Episode wird die gefährliche, rächende Seite des Gottes deutlich, der alle grausam bestraft, die ihm Gefolgschaft verweigern.
Im Vergleich mit den ekstatisch rasenden Frauen verkörpern die Satyrn als männliche Gefolgschaft des Dionysos, die häufig sexuell enthemmt und mit erigierten Geschlechtsteilen dargestellt wird, den für seinen Kult ebenfalls charakteristischen Wirkungsbereich der Erotik, den sich der Gott mit ▸ Aphrodite und Eros teilt. Die wichtigste Erscheinungsform für die Präsenz und Wirkung des Dionysos ist der Wein, der den Weg in die Raserei ebnet und hilft, den Zustand der Verzückung zu verlängern. Durch das Wachsen von Weinranken gibt sich der Gott auch bei seiner im Mythos häufig dargestellten Entführung durch tyrrhenische Piraten zu erkennen (vgl. den Homerischen Hymnos Nr. 7), und in Form des Weines tritt Dionysos als „Lust(bringer) für die Sterblichen“ auf, der irdische Leiden zumindest temporär mildern kann.
Vor diesem Hintergrund betrachtet, ist Dionysos ein höchst ambivalenter Gott, da sein Wirken die Menschen zwar einerseits für kurze Momente aus dem zivilisierten Alltagleben herausreißt und ihnen in Ekstase Anteil an göttlicher Verzückung gewährt, andererseits aber ist die dionysische Raserei von Unberechenbarkeit und Irrationalität gekennzeichnet, die menschliche Verhaltensnormen außer Kraft setzt und zu unmenschlichen Handlungen führen kann. Die Einführung der zahlreichen Feste für Dionysos in Athen lässt sich daher auch als Versuch interpretieren, den ekstatischen Gott zu kanalisieren, indem man ihn ganz bestimmte Tage in festlich geordneten Bahnen wirken lässt. Letztere zeigen sich mit Blick auf die beiden athenischen Hauptfeste, die Lenäen und die Großen Dionysien, durch den geregelten Ablauf von dramatischen Agonen, die zu seinen Ehren aufgeführt wurden. Bei den Großen Dionysien (im März/April) traten jeweils drei Tragiker mit einer Trilogie von Tragödien, gefolgt von einem Satyrspiel, sowie fünf Komödiendichter mit jeweils einem Stück gegeneinander an. Als Theatergott war Dionysos (repräsentiert über eine Kultstatue und vertreten durch seinen höchsten Priester) an den Aufführungen dabei und fungierte symbolisch als Schiedsrichter. In dieser Funktion inszeniert ihn auch die im Jahr 405 v. Chr. aufgeführte Komödie Die Frösche des Aristophanes, in der Dionysos einen Unterweltsagon zwischen den um die Vorrangstellung in der Unterwelt streitenden Tragikern Euripides und Aischylos entscheiden soll, dabei aber selbst zur komischen Figur wird.
Geburt des Dionysos Volutenkrater aus Tarent, Ende 5./Anfang 4. Jh. v. Chr.
Die ständigen Wandlungen des Gottes im Mythos waren Thema einer eigenen, ihm gewidmeten lyrischen Form, des Dithyrambos, der als Chorlied zu seinen Ehren gesunden wurde und bei den Großen Dionysien eine eigene Wettkampfkategorie bildete, an der sich die athenischen Stadtbezirke, Phylen, mit eigenen Chören beteiligten. Die Einbeziehung nahezu der ganzen Stadt Athen in seinen Kult wird auch daraus ersichtlich, dass die Dramenagone im größten Theater Athens abgehalten wurden, wo nach Platon (Symposion 175e) 30.000 Zuschauer Platz gehabt haben sollen, was dem Großteil der damaligen Bevölkerung Athens entsprochen hätte.
Wichtig für die Verbreitung des Dionysoskultes waren die nicht-städtisch organisierten Bacchischen Mysterien, deren Spuren sich in weiten Teilen der griechisch-römischen Welt bis in die Kaiserzeit finden. Neben ▸ Demeter, mit der zusammen er bei den Eleusinischen Mysterien verehrt wurde, war Dionysos der wichtigste Mysteriengott, der in der Hoffnung auf ein gutes Schicksal im Jenseits angerufen wurde, wobei vor allem der Mythos von seiner doppelten Geburt eine wichtige Rolle im Ritus gespielt zu haben scheint.
Passend zu seinem ambivalenten Erscheinungsbild ist die nachantike Rezeption des Dionysos zweigeteilt: Auf der einen Seite steht der vor allem in der christlichen Rezeption des Mittelalters zu beobachtende Versuch, Dionysos als Verkörperung einer dekadenten, paganen Antike zu stilisieren. Dionysos bzw. seine lateinischen Pendants Bacchus und Liber werden als Allegorien der sexuellen Enthemmtheit und Trunksucht eingesetzt (vgl. Augustinus, De civitate dei 6.9), und die seit dem 4. Jh. v. Chr. für Dionysos charakteristische und vielleicht an ▸ Apollon angelehnte Darstellung als schöner junger Mann wurde bereits in der Spätantike von christlichen Autoren wie Fulgentius negativ als Bild einer den Menschen nie zur Reife kommen lassenden Trunksucht gedeutet. Auf der anderen Seite hatte Nonnos den Gott in seinem Epos zu einem weltumspannenden gerechten Herrscher stilisiert, der als Kultur- und Religionsbringer durchaus Angebote an eine Verschmelzung mit christlichen Herrschaftsattributen bereithielt. In der Renaissance zeigt sich durch den verstärkten Rückgriff auf griechische Texte ein differenziertes Bild, das Dionysos trotz bestehender christlicher Abwertung in Anlehnung an seine Funktion als Theatergott und mit Blick auf die Gabe des Weines als Inspirationsgottheit sieht, der den Dichtern eben die Ekstase ermöglicht, aus der heraus Dichtung entstehen kann (vgl. die Tradition der Bacchushymnen und François Rabelais’ Prologus an die Zecher in Gargantua, 1534/35); auch in der Ikonographie kann Dionysos Raum zurückgewinnen: Das in der Spätantike verpönte Bild des trunkenen Jugendlichen wird von Michelangelo (Der trunkene Bacchus, 1496) für den Kardinal Raffaele Riario in ein antikisierendes Idealbild überführt. Auch in der bildenden Kunst ist Dionysos ein beliebtes Thema der Zeit, ganze Freskenzyklen inszenieren die wichtigsten Stationen seines Mythos (vgl. die Fresken von P. Veronese in der Stanza di Bacco der Villa Barbaro, 1560–61); zahlreiche Einzelgemälde u.a. von Tizian (Das Bacchanal der Andrier, 1523–26), Rubens, Caravaggio (Der kranke Bacchusknabe, 1593/94) und Velázquez (Los borrachos, 1628/29) fokussieren in dieser Zeit seine Eigenschaft als Weingott, womit eine immer stärkere ikonographische Verengung der im antiken Mythos deutlich breiter angelegten Figur einhergeht. Diese Tendenz bleibt für die bildende Kunst bis in die Moderne charakteristisch. Als weiteres Thema wird besonders in der Musik seine Begegnung mit Ariadne rezipiert (vgl. die Opern von Monteverdi Lamento d’Arianna, 1623, Mollier, Le Mariage de Bacchus et d’Ariane, 1672, und Conradi, Ariadne, 1691). Zu größerer kulturgeschichtlicher Bedeutung gelangt Dionysos im 19. Jh., wo die Gestalt von Friedrich Nietzsche in seiner kontrovers diskutierten Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872) in eine Dichotomie zu Apollon gesetzt wird. Er begreift Dionysos und Apollon als zwei Repräsentanten unterschiedlich produktiver und dabei widerstreitender Kräfte: Apollon steht für das ästhetisch Schöne, Träumerische mit der epischen Dichtung als bester Ausdrucksform und Dionysos für das Ekstatische, Verzückte mit der Musik als bester Ausdrucksform, die nach Nietzsche besonders in der Tragödie zur Geltung kommt. Entsprechend könne die ideale Tragödie nach antikem Vorbild auch nur durch die Musik wiederbelebt werden, und für Nietzsche ist diese Musik, die dazu ihren Anstoß gibt, die Musik seines Zeitgenossen und zeitweiligen Freundes Richard Wagner, die er beim Verfassen seines Werkes im Blick hatte. Die Zusammenführung von Nietzsches Theorie und Wagners Praxis scheiterte jedoch unter anderem daran, dass Wagner seinen Helden eine stark christliche Akzentuierung gab, die Nietzsche missfiel und die dem antiken Dionysos nicht entsprach. Im 20. Jh. ist Dionysos literarisch präsent in ganz unterschiedlichen Gattungen – angefangen vom „fremden Mann“ in Thomas Manns Novelle Tod in Venedig (1912) über Rudolf Borchardts Gedicht Bacchische Epiphanie (1912/1924) bis zum Kriminalroman Der Narr von Stefan Papp (2012) –, und er ist auf den Opernbühnen des 20. Jh. (C. Debussy, Dionysos, 1904; J. Massenet, Bacchus, 1909; R. Strauss, Ariadne auf Naxos, 1912; H. W. Henze, Die Bassariden, 1966) zu Hause – zum Teil in äußerst innovativen und experimentellen Inszenierungen (vgl. das New Yorker Performance-Theater Dionysus in 69, das mit dem gleichnamigen Titel 1970 von Brian De Palma verfilmt wurde), so wie es die Fassade der Semperoper in Dresden mit ihrer Darstellung des von einer Pantherquadriga gezogenen triumphierenden (Theater-)Gottes auch erwarten lässt.
LITERATUR
F. W. Hamdorf: Dionysos – Bacchus. Kult und Wandlungen des Weingottes. München 1986
M. Détienne: Dionysos. Göttliche Wildheit. Frankfurt a. M., New York 1992
K. Kerényi: Dionysos. Urbild des unzerstörbaren Lebens. München, Wien 21998
R. Schlesier, A. Schwarzmaier (Hg.): Dionysos. Verwandlung und Ekstase. Regensburg 2008
J. Schmidt, U. Schmidt-Berger (Hg.): Mythos Dionysos. Stuttgart 2008
Manuel Baumbach