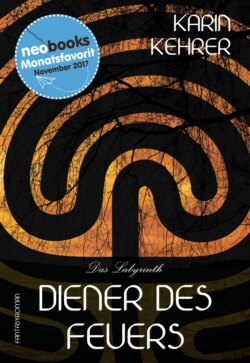Читать книгу Diener des Feuers - Karin Kehrer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 9
ОглавлениеWie immer verspürte Catherine keinen großen Hunger, stocherte lustlos in ihrem Salat herum, während Linda ihre mit Hackfleisch und Zwiebeln gefüllten Pasties mit sichtlichem Genuss verspeiste.
Nach dem vergeblichen Versuch Lindas, sie mit gemeinsamen Erlebnissen aus der Vergangenheit aufzuheitern, kehrte Catherine in ihr Hotelzimmer zurück. Sie hatte sich in den Four Winds eingemietet, einer Frühstückspension gleich in der Nähe des King Arthur’s Castle Hotels. Die Pension lag etwas abseits des Ortes, blieb also vom Trubel der Touristen weitgehend verschont.
Catherine trat an das Fenster, öffnete es weit und atmete die feuchte Luft ein, die vom Meer herüber wehte.
Das große Hotel mit seinen vielen Lichtern war zu sehen und für einen Moment wünschte sie, mit Linda gegangen zu sein, so wie früher. Sie hätte mit ihrer Freundin in der Hotelbar einen Gin Tonic getrunken und sich über alte Zeiten unterhalten, als die Welt noch in Ordnung war und sie beide unbeschwert und frei.
Linda hätte mit ihr gelacht, nicht ohne ihre Blicke durch den Raum schweifen zu lassen, immer auf dem Sprung, falls ein attraktiver Mann auftauchen sollte.
Wie weit war das alles jetzt weg! Unwahrscheinlich, dass sie jemals an solch harmlosen Vergnügungen Freude gefunden haben konnte!
Ihr Blick fiel auf die Schachtel mit Pralinen, die Linda gekauft hatte. Es war ihre Lieblingssorte gewesen – früher. Sie hatte sie auf das Bett gelegt, abgelenkt durch den Wortschwall ihrer Freundin. Nun schien die Schachtel sie anzustarren. Vorwurfsvoll und verwundert, dass sie so unbeachtet dalag.
Catherine hatte immer gerne Schokolade gegessen, aber seit dieser unendliche Kummer ihre Kehle zuschnürte, verspürte sie auch darauf keine Lust mehr. Unschlüssig nahm Catherine die Schachtel hoch, drehte sie in den Händen. Mit einer heftigen Bewegung riss sie das Cellophan ab und hob den Deckel. Der Geruch der Schokoladestückchen stieg ihr in die Nase. Er verursachte Übelkeit und ließ den alt vertrauten Kloß im Hals entstehen.
Sie erinnerte sich.
Ihr fünfundzwanzigster Geburtstag, vor ziemlich genau zwei Jahren.
Paul hatte sie in dieses sündteure, französische Restaurant eingeladen. Sie hatte ihr neues Kleid angezogen, das hellblaue mit dem tiefen Rückenausschnitt und dem weiten Rock. Er hatte ihren nackten Rücken gestreichelt, bevor sie das Haus verließen und ihr zugeflüstert, dass sie wie eine Fee aussehe. Sie hatte gelacht und ihn geküsst.
Während des ganzen Essens herrschte eine prickelnde Spannung zwischen ihnen, die sich zu Hause, in ihrem Schlafzimmer, entladen würde. Was sie gegessen hatten, war ihr entfallen, es war auch egal.
Wieder erschien ein Bild vor ihren Augen: Paul, nackt auf dem Bett. Er hatte ihr belgische Pralinen geschenkt, eine riesige Schachtel. Sie hatte sie auf seinem Körper verteilt, eine nach der anderen sorgfältig platziert.
Die Stückchen nahm sie mit ihren Lippen auf, genoss den Duft seiner Haut und den Geruch der Schokolade. Sein erregtes Stöhnen. Aber er ließ ihr nicht viel Zeit, die Leckereien zu genießen. Er warf sie auf das Bett, liebte sie leidenschaftlich. Sie musste lachen, als sie die zerquetschten Pralinen auf dem Bettlaken fand, nachher, als ihre Lust gestillt war.
Catherine starrte auf die offene Schachtel. Sie glitt ihr aus den Händen. Mit einem erstickten Schrei sprang sie auf, rannte ins Badezimmer und übergab sich.
Dann hob sie den Kopf und starrte auf ihr Spiegelbild. Ein geisterbleiches, mageres Gesicht – wirres, rotblondes Haar, auf der schweißbedeckten Haut klebend. Quer über der Stirn, knapp am Haaransatz, die lange, gestichelte Narbe, die Erinnerung an das Ende ihrer Unbeschwertheit. Die Augen, dunkle Löcher, voll Schmerz. Grässlicher, säuerlicher Geschmack auf der Zunge, in der Nase, überall.
Catherine drehte den Wasserhahn auf und hielt ihr Gesicht unter das eiskalte Wasser, minutenlang, bis ihre Haut betäubt war von der Kälte. Sie trocknete sich ab und ging zurück in das Zimmer. Die Schachtel mit den Pralinen verschloss sie mit abgewandtem Gesicht und steckte sie in den Schrank. Als sie sich auszog, fiel ihr Blick auf das Pflaster auf der Schulter. Vorsichtig zupfte sie daran, besah sich die noch immer gerötete Tätowierung und trug ein wenig Creme auf.
Catherine schlüpfte in das Nachthemd, legte sich ins Bett und löschte das Licht. Die Arme hinter dem Kopf verschränkt, starrte sie in die Dunkelheit. Und die Vergangenheit war wieder da, unbarmherzig und klar.
*****
Sie waren nach Hause gefahren, Paul, Catherine und Sarah, ihre kleine Tochter. Das Mädchen schlief im Kindersitz, seine Puppe fest in den Armen.
Es war schon dunkel, ein verregneter Tag Ende Oktober. Sie hatten das Wochenende bei Pauls Eltern in Dymchurch verbracht. Derrick und Suzanne Morgan lebten seit der Pensionierung von Pauls Vater in dem kleinen Ort südlich von Dover, in einem Haus direkt am Meer. Das Wetter war schön gewesen, sie hatten trotz des kräftigen Windes einen Strandspaziergang gemacht. Erst am Sonntag zu Mittag hatte es zu regnen begonnen. Sie hatten eigentlich vorgehabt, früher aufzubrechen, aber Pauls Vater wollte seinem Sohn noch unbedingt seine neueste Errungenschaft – einen Schrank im Regency-Stil – zeigen. Die beiden Männer vertieften sich in ein Fachgespräch und wie immer vergaßen sie darüber alles andere. Beide liebten Antiquitäten. Und beide hatten die finanziellen Möglichkeiten, sich dieses Hobby leisten zu können.
Catherine hatte mit Sarah gespielt. Die Kleine wurde im Dezember vier und sie wünschten sich noch ein Kind. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es allerdings nicht geklappt.
Es dauerte über zwei Stunden, bis die Männer wieder erschienen. Deshalb dämmerte es schon, als sie die Fahrt nach London antraten. Pauls Mutter verabschiedete sie besorgt. Das Wetter war wirklich nicht sehr gut, die Straßen rutschig vom nassen Laub. Bei diesen Witterungsverhältnissen würden sie für die knapp siebzig Meilen bestimmt zwei Stunden brauchen. Aber Paul war ein guter Fahrer, es gab keinen Grund, sich zu sorgen.
Sie unterhielten sich leise, um Sarah nicht zu stören, die bereits nach einer Viertelstunde eingeschlafen war.
Ein seltsames Gefühl der Abgeschlossenheit hatte Catherine ergriffen, wie immer, wenn sie zusammen im Auto unterwegs waren. Eine eigene kleine Welt, in der nur sie und ihre Familie zählten. Catherine stellte sich vor, wie es sein könnte, wenn sie jetzt einfach immer weiterfahren würden, egal wohin. Sie waren zusammen, das allein zählte.
Die besorgte Stimme ihrer Schwiegermutter klang noch in ihrem Gedächtnis. Früher hatte sie gelacht über die Ängste ihrer Mutter, über ihre Ermahnungen. Nun, da sie selbst Mutter war, verstand sie es. War auch besorgt, wenn Paul einmal später nach Hause kam oder wenn er nicht gleich anrief. Entwickelte sie sich vielleicht zu einer Glucke? War das ein Zeichen dafür, dass sie alt wurde? Nein, es bedeutete wohl eher, dass es Zeit war für eine neue Aufgabe. Ein weiteres Kind oder ein neuer Job.
Sie sprachen gerade davon, ob sie Sarah für das nächste Halbjahr im Kindergarten anmelden sollten, als plötzlich ein schwarzer Schatten vor der Windschutzscheibe auftauchte. Im gleichen Moment erschütterte ein dumpfer Aufprall den Wagen. Paul schrie auf und verriss das Lenkrad. Etwas Großes, Schweres kam durch die Windschutzscheibe, auf Pauls Seite.
Catherine wurde nach vorne geworfen, hilflos wie eine Puppe. Schmerz flammte über ihre Stirn und etwas Warmes, Klebriges rann in ihre Augen.
Sie drehten sich im Kreis, schlitterten und rutschten unaufhaltsam irgendwohin in die Dunkelheit. Catherine wurde nicht ohnmächtig, das wusste sie später ganz genau. Sie erlebte alles bewusst mit. Wie sie sich drehten, das Gefühl der Hilflosigkeit, nichts tun zu können, die Panik. Der Ruck, das Aufklatschen des Wagens auf dem Wasser. Dann war da plötzlich Kälte, legte sich nass und klamm um ihre Beine.
Sie wischte das Blut von der Stirn, versuchte, durch die roten Schlieren die Dunkelheit mit ihren Augen zu durchdringen und spürte, wie das Wasser in den Wagen lief. Zerrte am Sicherheitsgurt, wie durch ein Wunder ließ er sich öffnen.
Catherine tastete nach dem Türöffner, riss panisch daran. Dabei schrie sie immer wieder Pauls Namen. Doch er antwortete nicht. Auch vom Rücksitz war kein Laut zu hören. Schließlich gelang es ihr, das Fenster herunterzudrehen. Das Wasser hatte mittlerweile ihre Brust erreicht. Sie bewegte sich wie in Zeitlupe, stieß sich mit letzter Kraft vom Sitz ab und schob sich aus dem Fenster. Blind tastete sie sich nach oben und trat instinktiv mit den Füßen.
Helle Scheinwerfer blendeten sie. Sie schrie, mit sich überschlagender Stimme, immer wieder: „Mein Mann, meine Tochter – im Auto!“ Sie musste geschwommen sein, um aus dem kleinen Teich zu kommen, in den das Auto gestürzt war. Aber die Erinnerung daran war fort.
Kräftige Hände zogen sie aus dem Wasser und wickelten sie in Decken. Der schrille Ton von Krankenwagensirenen erfüllte ihre Ohren. Dann war da nur noch Dunkelheit.
Catherine erwachte im Krankenhaus. Als sie nach Paul und Sarah fragte, teilte ihr eine Ärztin mit, dass ihr Mann und ihre Tochter gestorben waren. Es war schnell gegangen, das Reh, das durch die Windschutzscheibe gestürzt war, hatte Pauls Brustkorb eingedrückt. Er war schon tot gewesen, als sie in den Teich fielen. Und Sarah, die tief geschlafen hatte, war wohl ertrunken, bevor sie überhaupt registrieren konnte, was geschehen war.
Es machte Catherines Kummer nicht kleiner. Sie hatte wie durch ein Wunder keine schwereren Verletzungen erlitten, nur eine Schramme auf der Stirn blieb, wo die Geweihspitze des Rehs sie gestreift hatte. Und das Schuldgefühl. Sie hatte ihre Familie im Stich gelassen, hatte nur daran gedacht, ihr Leben zu retten. Mit diesem Bewusstsein konnte sie nicht weiterleben. Niemand verstand das. Man gab ihr Beruhigungsmittel, verschrieb ihr eine Therapie. Doch es schien nicht viel zu helfen. Sie brachte die Bilder des Unfalls nicht aus ihren Gedanken. Darüber zu sprechen war unmöglich. Es war, als schnüre eine unsichtbare Hand ihre Kehle zu, sobald sie den Versuch machte, ihre Gefühle in Worte zu kleiden.
Später spuckte sie die Schlaftabletten, welche die Ärztin ihr gab, heimlich aus und sammelte sie. Niemand schöpfte Verdacht, sie machte einen sehr gefassten Eindruck in diesen Tagen. Sie schluckte alle Tabletten auf einmal. Wenn sich nicht die Krankenschwester, die das Fieber messen sollte, verspätet hätte, wäre ihr Leidensweg zu Ende gewesen. Doch ihr Magen wurde ausgepumpt und sie wurde zurückgeholt in dieses elende, sinnlose Leben.
Catherine begann eine weitere Therapie, die wenigstens im Ansatz zusammen mit der Einnahme der Psychopharmaka Erfolg zeigte. Schließlich wurde sie mit genauen Anweisungen, wie sie die Medikamente zu dosieren hatte, nach Hause geschickt. Ihre Eltern waren bei ihr in dieser Zeit, sie hätte die Heimkehr sonst nicht verkraftet. Das Haus, das sie mit Paul eingerichtet hatte, wurde verkauft. Sie konnte nicht mehr darin leben – alles erinnerte an ihn und ihre glückliche Vergangenheit.
Doch die Fürsorge ihrer Angehörigen wurde lästig. Die mitleidigen Blicke, diese ständigen Fragen, wie es ihr gehe. Die vielen Versuche, sie abzulenken und aufzuheitern.
Und dann war sie einfach losgefahren, immer nach Westen. Bis Land’s End, zu den Klippen. Hatte auf das Meer gestarrt, auf den Nebel und die Umrisse der Scilly Islands und hatte plötzlich nicht mehr den Mut besessen, es zu Ende zu bringen.
Catherine horchte auf die Schläge der Kirchturmuhr. Mitternacht! Und noch immer kein Gedanke an Schlaf.
Seufzend tastete sie nach dem Lichtschalter. Sie musste wieder eine Schlaftablette nehmen, um wenigstens ein paar Stunden Ruhe zu haben. Nur eine. Nicht mehr.