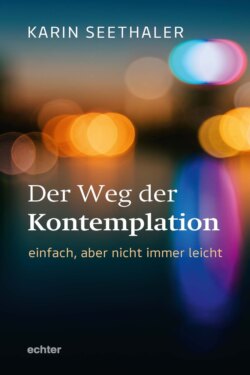Читать книгу Der Weg der Kontemplation: einfach, aber nicht immer leicht - Karin Seethaler - Страница 9
I.Die Wahrnehmung und die Gegenwart
ОглавлениеDie große Lehrmeisterin der Kontemplation ist die Natur. 11
Die Natur lädt in ihrer Vielfalt und in ihrer Schönheit dazu ein, sie wahrzunehmen. Jedes Blatt, jeder Vogel und jede Blume weisen durch ihr Sein auf Gottes Gegenwart hin. Die ganze Natur ist ein Lobpreis an den Schöpfer. Sie birgt eine große in sich ruhende Kraft, deren göttlicher Ursprung nach Entfaltung strebt. Dieser göttliche Ursprung und die Sehnsucht nach Entfaltung sind auch dem Menschen zu eigen. So kann die Natur im Menschen zum Klingen bringen und wieder zugänglich machen, was in ihm selbst innewohnt. Dies geschieht jedoch nicht automatisch, da sich die Natur dem Menschen nicht als Lehrmeisterin der Kontemplation aufdrängt. Die Natur beschwert sich nicht, wenn man einen Spaziergang macht, ohne auf sie zu achten, weil man in seinen Gedanken versunken bleibt. Wer sich jedoch die Zeit nimmt, sie bewusst wahrzunehmen, den belehrt, belebt und beschenkt sie. Dieser Geschenkcharakter ist der Natur zu eigen, so wie das Leben selbst ein Geschenk ist. Zur Lehrmeisterin der Kontemplation kann die Natur dann werden, wenn man ihre Geschenke bewusst wahrnimmt. Dies geschieht über unsere fünf Sinne: hören, sehen, riechen, mit der Haut fühlen und mit der Zunge schmecken, was ist.
Für den Weg der Kontemplation ist wesentlich, anschließend einen weiteren Schritt zu beherzigen. Ich nehme die Natur mit meinen Sinnen nicht nur wahr, sondern vollziehe mit meiner Aufmerksamkeit eine Wende nach innen. Ich achte darauf, wie das, was ich wahrnehme, auf mich wirkt. „Spüre in dich hinein und lass diese Pflanze oder diesen Stein auf dich wirken. Nimm wahr, was von jener Blume zu dir fließt.“12 Durch die nach innen gelenkte Aufmerksamkeit komme ich in Verbindung mit meiner eigenen Natur. Ich sehe zum Beispiel ein kleines Gänseblümchen, das still am Wegrand wächst, und lasse es auf mich wirken. Ich achte dann darauf, was sich in mir bewegt. Es kann sein, dass diese kleine Blume eine Hoffnung in mir weckt, dass Gott auch mein Leben zum Erblühen bringt, und zwar genau dort, wo ich jetzt bin, und unabhängig davon, ob andere mich sehen oder gar bewundern oder nicht. Diese kleine Blume kann mich daran erinnern, dass es genügt, einfach da zu sein. So wie das Gänseblümchen keine Rose sein muss, muss auch ich nicht jemand anders sein. Diese kleine Blume kann mich ohne Worte tiefe Wahrheiten erkennen lassen. Sie können in mir zum Klingen kommen, wenn ich die Natur wahrnehme und auf mich wirken lasse.
Es wäre jedoch ein Irrtum anzunehmen, dass es bei der bewussten Wahrnehmung der Natur darum geht, ein Gefühl in sich zu erspüren, um es benennen zu können, oder darum, Bilder zu suchen, mit denen ich mich selbst erkläre. Mit diesem Verständnis käme ich subtil unter Druck. Es genügt, achtsam dafür zu sein, ob das Wahrgenommene eine Resonanz in mir auslöst und wenn ja, welche. Das Entscheidende sind nämlich nicht die Gefühle, sondern meine Fähigkeit, aufzunehmen, was ist. Auch wenn mich nichts spürbar berührt oder ich nicht in Worte fassen kann, was gerade in mir geschieht, bleibe ich, so wie es mir möglich ist, weiterhin achtsam im Hier und Jetzt.
Es kann sein, dass ich nach draußen gehe und es mir aufgrund einer inneren Unruhe unmöglich erscheint, stehenzubleiben, um die Natur auf mich wirken zu lassen. Wenn dem so ist, dann werde ich schneller gehen, weil dies meinem augenblicklichen Befinden entspricht. Irgendwann halte ich jedoch inne und nehme ausdrücklich meine Unruhe wahr. In diesem Moment bin ich bereits wieder in der Wahrnehmung. Ich kann mich mit allem, was ist, auch mit allem, was in mir ist, bewusst auf die Wahrnehmung einlassen. Der kontemplative Weg wäre alltagsuntauglich, wenn eine innere Ruhe seine Voraussetzung wäre. Wenn ich unruhig bin, so nehme ich dies wahr, doch dann achte ich darauf, was außer meiner Unruhe auch noch da ist. Ich vollziehe damit die Wende nach außen und verändere somit meine Blickrichtung: Ich lenke meine Aufmerksamkeit von meiner Unruhe hin zur Natur, einer Realität, die auch noch da ist.
Die Wende nach außen, zu dem, was auch noch da ist, gilt es auch zu vollziehen, wenn ich bemerke, dass ich abgelenkt bin, weil mich meine Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft führen. Immer wenn mir dies bewusst ist, habe ich die Möglichkeit, meine Aufmerksamkeit wieder zur Natur zu lenken. Ich öffne mich ihr wieder, um mich von ihrer Schönheit, Vielfalt und Weisheit beschenken zu lassen.
Diese Geschenke der Natur empfing eine Frau in einer schwierigen Lebensetappe. Sie war nach einigen Jahrzehnten im Ausland nach Europa zurückgekehrt und hatte große Schwierigkeiten, sich wieder einzuleben. Sie fühlte sich fremd und heimatlos. Auf dem Spaziergang machte sich in ihr das Gefühl der Heimatlosigkeit bemerkbar. Sie spürte es als eine unruhige Traurigkeit und innere Leere. Sie blieb mit ihrer Aufmerksamkeit jedoch weder bei ihren Gefühlen noch bei ihren Gedanken hängen, sondern lenkte sie immer wieder bewusst auf die Natur. Für diese Wende verhalf ihr die kleine Frage: Was ist da noch? Was ist außer meinen Gedanken auch noch da? Sie entdeckte einen orange blühenden Strauch, den sie noch nie gesehen hatte. Es war kein einheimisches Gewächs und sie dachte sich, dass er eigentlich nicht hierhergehörte. Dieser Strauch hatte jedoch trotzdem seinen Platz gefunden und blühte jetzt wunderschön, auch wenn er fremd bleiben würde. Sie blieb lange vor dem Strauch stehen und spürte, wie sie immer ruhiger wurde. Sie konnte einwilligen, dass vielleicht auch sie hier immer fremd bleiben würde. Die Natur hatte ihr jedoch gezeigt, dass auch sie an diesem Platz, wo sie jetzt lebte, ihr Leben zum Blühen bringen konnte.
Gott ist da, aber wir nehmen ihn nicht wahr! 13
Die Aussage, dass Gott da ist, gründet in der Selbstoffenbarung Gottes „Ich bin der ‚Ich-bin-da‘“ (Ex 3,14). Gott sagt nicht: Ich bin der, der da sein wird, wenn du es geschafft hast, so und so zu sein. Er sagt auch nicht: Ich bin der, der da war damals, als bei dir noch alles in Ordnung war. Gott hat sich klar als ein Gott der Gegenwart zu erkennen gegeben und ist konsequenterweise in der Gegenwart wahrnehmbar. Da unsere Wahrnehmungsfähigkeit jedoch begrenzt ist, nehmen wir stets nur einen Teil der Wirklichkeit wahr.
Die Folgen dieser eingeschränkten Wahrnehmung veranschaulicht eine Parabel von fünf Blinden, die die Aufgabe bekommen haben, einen Elefanten zu beschreiben. Der erste Blinde fasst das Bein des Elefanten an und ist sich sicher: Ein Elefant sieht aus wie eine Säule. Der zweite Blinde, der den Schwanz des Elefanten untersucht, sagt: Ein Elefant sieht aus wie ein Seil. Der dritte Blinde widerspricht sofort: Ein Elefant sieht aus wie eine Schlange. Er hatte den Rüssel des Elefanten angefasst. Der vierte Blinde schüttelt den Kopf und sagt: Ein Elefant ist mit einer Wand vergleichbar. Dieser Mann hatte den Rumpf des Tieres berührt. Der fünfte Blinde, der mit seinen Händen am Stoßzahn des Elefanten entlangstreift, sagt: Ein Elefant ist wie ein Speer. Jeder hatte die Wirklichkeit von seiner Perspektive aus wahrgenommen und jeweils diesen Teil des Elefanten beschrieben. Keiner hatte jedoch die gesamte Wirklichkeit erfasst. So können auch wir die Allgegenwart Gottes in ihrer ganzen Dimension nicht erfassen, sondern nehmen aus unserer Perspektive immer wieder nur Spuren seiner Gegenwart wahr.
Unser Wahrnehmungsbereich wird auch immer dann eingeschränkt, wenn wir uns auf eine Aufgabe fokussieren und versuchen, etwas Bestimmtes zu erreichen. Es kann geschehen, dass wir anderes in einem so großen Maße ausblenden, dass wir selbst eine als Gorilla verkleidete Person nicht wahrnehmen, die auf dem Bildschirm erscheint, sich in voller Größe in die Mitte stellt, mit den Fäusten auf die Brust trommelt und dann gemächlich weiterzieht. Das Experiment der beiden amerikanischen Psychologen Christopher Chabris und Daniel Simons hat jedoch genau dies bewiesen. 50 % der Testpersonen konzentrierten sich derart auf eine ihnen gestellte Aufgabe, dass sie den Gorilla tatsächlich nicht wahrgenommen haben, obwohl sie ununterbrochen konzentriert auf den Bildschirm geschaut hatten. Das Experiment mit dem Video können sie selbst mit Freunden durchführen.14 Wer jedoch im Vorfeld von dem Gorilla gehört hat oder das Video anschaut, ohne dabei eine Aufgabe zu erfüllen, kann nicht glauben, dass irgendjemand den Gorilla nicht sofort sieht.
Da wir in der Meditation keine Aufgabe zu erledigen haben und es auch nicht darum geht, etwas Bestimmtes wahrzunehmen, kann sich unser Wahrnehmungsbereich weiten.
Dies geschieht auch dann, wenn wir bereit sind, unsere Wahrnehmung läutern zu lassen. Läuterung bedeutet, etwas von Schlacken oder Verunreinigungen zu befreien. Unsere Wahrnehmung ist zwar nicht verunreinigt, jedoch aufgrund vielfältiger freudvoller und schmerzhafter Erfahrungen eingefärbt. Diese Einfärbungen nehmen die Farbe an von unseren Überzeugungen, Einstellungen, Erwartungen, Ansichten, von unserer körperlichen, emotionalen und geistigen Verfassung, unseren bisherigen Erfahrungen und von den uns vertrauten gesellschaftlichen Normen. Unser Blick wird durch diese Einfärbungen getrübt. Wir sehen die Wirklichkeit nicht in ihrer „heiligen Unabhängigkeit“ (Dag Hammarskjöld). Diese Einfärbungen bewirken eine selektive Blindheit, bei der wir zwar sehen, jedoch nicht sehen, was wir alles nicht sehen.
Gottes Anwesenheit können wir nicht sehen. Da er jedoch in uns gegenwärtig ist, spricht Paulus von uns als Tempel Gottes (1 Kor 3,16). Dieser Tempel beheimatet unsere menschliche Realität mit all ihren Einfärbungen und Gottes Gegenwart. Beides gehört unauflöslich zu uns. Um in der Meditation Spuren seiner Gegenwart wahrnehmen zu können, darf die Bereitschaft nicht fehlen, sich selbst wahrnehmen zu wollen.
Die selektive Blindheit bleibt bestehen, wenn der Mensch Realitäten nicht wahrnehmen will beziehungsweise nicht wahrhaben will. Dies habe ich in meiner Arbeit als Sozialpädagogin erfahren. Hier war es einmal meine Aufgabe, Langzeitarbeitslosen zu helfen, sich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies war kein leichtes Unterfangen, da manche von ihnen Alkoholiker waren, jedoch meist nicht bereit, diese Tatsache in den Blick zu nehmen. Sie wurde verharmlost und zumeist sofort verleugnet, sogar dann, wenn es ihnen durch einen Alkoholtest vor Augen geführt werden konnte, dass sie zu viel getrunken hatten. Wenn sich das Röhrchen grün verfärbte, was eindeutig ihren Alkoholkonsum aufdeckte, war das Röhrchen in ihren Augen dann aber nicht grün, sondern gelb. Ein gelbes Röhrchen belegte einen nüchternen Zustand. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal den Alkoholtest durchführte und sich das Röhrchen grün verfärbte. Der Mann behauptete jedoch so vehement, dass das Röhrchen eindeutig gelb sei, dass er mich tatsächlich verunsicherte und ich eine Kollegin fragte, welche Farbe sie sehe. In dieser Situation wurde mir deutlich vor Augen geführt, wie das Blickfeld eingeschränkt bleibt und damit auch jegliche Entwicklung verhindert wird, wenn man unangenehme Tatsachen nicht sehen will.
Dies trifft ebenso für unseren Weg zu Gott zu. Wer nicht bereit ist, sich selbst wahrzunehmen, wie er ist, wird nur schwer die Spuren Gottes in sich und in seinem Leben wahrnehmen können. Evagrius Ponticus, ein Vertreter des frühen Mönchtums, hat bereits im 4. Jahrhundert folgende Empfehlung gegeben: „Willst du Gott erkennen, so lerne zunächst dich selbst kennen.“ Dieses Kennenlernen geschieht, indem wir in der Meditation unsere Aufmerksamkeit nach innen lenken und so in spürbaren Kontakt mit uns selbst kommen. Die Achtsamkeit auf das innere Erleben schärft und weitet die Selbstwahrnehmung. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes „selbst bewusster“. Denn „Wahrnehmen bedeutet bewusst werden“15. Es ist ein intensiver Prozess der Selbstbegegnung, der sich durch die Bereitschaft auszeichnet, sich selbst wahrnehmen zu wollen. Die Hoffnung, dass es weit mehr zu entdecken gilt, als wir im Augenblick wahrnehmen können, und die Sehnsucht nach einem vertieften Leben schenken uns die Kraft zum Weitergehen, ungeachtet der Einfärbungen, die unsere Sicht immer wieder einengen und verdunkeln. Von diesen allzu menschlichen Erfahrungen ließ sich Paulus nicht durcheinanderbringen. Er ermutigt dazu, unbeirrt den Weg zu Gott weiterzugehen, wenn er sagt: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin“ (1 Kor 13,12).
Um uns auf die Gnade der Kontemplation vorzubereiten, müssen wir lernen, wahrzunehmen. 16
Da Gott gegenwärtig ist, wir ihn aber nicht wahrnehmen, ist es eine logische Konsequenz, das Wahrnehmen zu lernen. Franz Jalics bezeichnet das kontemplative Gebet sogar als eine Schule der Wahrnehmung. Alles, was wir üblicherweise mit Schule verbinden, ist hier jedoch nicht von Belang. In dieser Schule wird man nämlich nicht beurteilt, man benützt keine Bücher, man muss keine Prüfungen bestehen, man hat keine Ferien, und man macht auch nicht irgendwann einen Abschluss. Dies ist für uns ungewohnt, da zum Beispiel Bücher für uns selbstverständlich zu einer Schule dazugehören. In der Schule der Wahrnehmung geht es aber um die unmittelbare Begegnung: mit uns selbst und mit der Gegenwart Gottes. Martin Buber sagt: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Die Beziehung zum Du ist unmittelbar … Alles Mittel ist Hindernis. Nur wo alles Mittel zerfallen ist, geschieht die Begegnung.“17
Ein Beispiel von Franz Jalics soll dies veranschaulichen: Ein Mann liest gerade einen Brief von seinem Freund, als es klingelt und sein Freund vor der Tür steht. In diesem Moment verliert der Brief an Bedeutung. Er wird den Brief jetzt nicht mehr lesen, sondern ihn beiseitelegen und sich darüber freuen, seinem Freund unmittelbar zu begegnen. Das Gespräch ist nun das Mittel, das sie näher zueinanderführt. Es kann der Zeitpunkt kommen, in dem der Blickkontakt als Mittel der Kommunikation ausreicht. „Irgendwann wird sogar der Blick zu viel sein. Das stille Beisammensein genügt. Die Herzen weiten sich, und wir befinden uns noch näher beieinander als mit den vorher genannten Mitteln.“18
In der Meditation verzichte ich auf alle Mittel. „Ich bringe nichts mit als mich selbst“ (Silja Walter). Die Begegnung mit mir selbst und mit der Gegenwart geschieht in der unmittelbaren Wahrnehmung. Es kann Neuland sein, in der unmittelbaren Wahrnehmung zu bleiben, ohne das Wahrgenommene gedanklich sofort erfassen, beurteilen, analysieren und einordnen zu wollen. Dies war in der Meditation bei einem Mann der Fall, als er begann, seinen Körper bewusst wahrzunehmen. Er bemerkte, dass er dann anfing, jedes Körperteil, das er gerade wahrnahm, sofort zu benennen. Er kommentierte beständig seine eigenen Wahrnehmungen oder begann darüber nachzudenken, wie er das, was er gerade wahrnahm, anderen beschreiben würde. Er war es nicht gewohnt, „nur“ wahrzunehmen, was im Augenblick war.
Da gedankliche Überlegungen uns von der unmittelbaren Erfahrung im Hier und Jetzt wieder wegführen, übt man in der Schule der Wahrnehmung beständig ein, die Aufmerksamkeit immer wieder neu von den Gedanken auf die konkrete Wahrnehmung zurückzuführen. Es geht also nicht darum zu lernen, irgendwann etwas Besonderes wahrzunehmen, sondern darum, sich immer wieder neu auf das Hier und Jetzt einzulassen. Denn „in der Wahrnehmung bleiben, heißt auch in der Gegenwart bleiben“19. Es ist jedoch nicht selbstverständlich, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit tatsächlich in der Gegenwart bleiben. In der Schnelllebigkeit unserer Zeit ist unsere Aufmerksamkeit häufig auch schnell, das heißt, sie ist sprunghaft. Sie verliert sich im Vielerlei und findet keine Verankerung mehr im Hier und Jetzt. Wir nehmen dann die Welt einschließlich uns selbst entsprechend oberflächlich wahr. In der Schule der Wahrnehmung üben wir ein, nicht nur mit einem Teil unserer Aufmerksamkeit anwesend zu sein und mit einem anderen Teil „woanders“, sondern mit einer ungeteilten Aufmerksamkeit in der Wahrnehmung zu bleiben. Das Verweilen in der Gegenwart führt zur inneren Sammlung und den Menschen zum Einklang mit sich selbst und zu seiner Tiefe. Um gegenwärtig zu bleiben, binden wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder neu über eine konkrete Wahrnehmung an die Gegenwart. Gott, der sich als ein Gott der Gegenwart offenbart hat (Ex 3,14), ist in der Gegenwart erfahrbar. Da es nicht eine Gegenwart mit Gott und eine Gegenwart ohne Gott gibt, ist jede Hinwendung zur Gegenwart eine Hinwendung zur Gegenwart Gottes, auch wenn wir dies nicht erfassen können.
Vielleicht ist es tröstlich, dass wir in der Schule der Wahrnehmung alle Anfänger bleiben. Wir fangen immer wieder neu an, uns auf die unmittelbare Begegnung mit uns selbst und der Gegenwart einzulassen. Das Wahrnehmen dessen, was ist, auch wenn es uns unbedeutend erscheint, ist eine Erfahrung der Gegenwart. Wenn Karl Rahner sagt, dass der Fromme von morgen ein Mystiker sein wird, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein, spricht er von der persönlichen, unmittelbaren Erfahrung. Die Schule der Wahrnehmung führt zu dieser Erfahrung. Sie führt zu der Erfahrung der Gegenwart. Dort lässt sich Gott finden.
Bleiben Sie hellwach dabei. Bleiben Sie mit lebendigem Interesse bei der Wahrnehmung: Was ereignet sich da? Bleiben Sie ununterbrochen dabei. 20
Dies sind die Eigenschaften der Meditation: hellwach, mit lebendigem Interesse, ununterbrochen bei dem zu sein, was gerade geschieht. Diese Eigenschaften fallen frisch Verliebten nicht schwer. Sie sind mit großem Interesse und hellwach dem anderen zugewandt und suchen seine Nähe, wann immer es möglich ist. Anfänger der Meditation und frisch Verliebte sind offen für das, was sich gerade ereignet. Doch dieser Zauber des Anfangs geht im Laufe der Zeit verloren und damit auch das lebendige Interesse, das alle Sinne für das Hier und Jetzt öffnet. Der Alltag mit seiner anscheinenden Wiederholung des immer Gleichen beginnt grau und eintönig zu werden. Diese allzu menschliche Entwicklung beschreibt Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“: „Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen.“21 Schleicht sich in die Meditation eine Routine ein, droht dieses Erschlaffen. Man erwartet nichts Neues mehr. Man kommt zügig und automatisch zum Namen Jesu, den man monoton zu wiederholen beginnt. Obwohl dies gut „funktioniert“, fühlt sich die Meditation nicht gut an, sondern wird als langweilig, mühsam und beziehungslos erlebt. Etwas Wesentliches ist nämlich unmerklich verlorengegangen. Davon berichtet eine chassidische Erzählung.
Rabbi Jizchak Meïr erging sich einmal an einem Spätsommerabend mit seinem Enkel im Hof des Lehrhauses. Es war Neumond, der erste Tag des Monats Elul. Der Zaddik fragte, ob man heute den Schofar geblasen habe, wie es geboten ist einen Monat, ehe das Jahr sich erneut. Danach begann er zu reden: „Wenn einer Führer wird, müssen alle nötigen Dinge da sein, ein Lehrhaus und Zimmer und Tische und Stühle, und einer wird Verwalter, und einer wird Diener und so fort. Und dann kommt der böse Widersacher und reißt das innerste Pünktlein heraus, aber alles andre bleibt wie zuvor, und das Rad dreht sich weiter, nur das innerste Pünktlein fehlt.“ Der Rabbi hob die Stimme: „Aber Gott helfe uns: Man darf’s nicht geschehen lassen!“22
Ohne das innerste Pünktlein zu meditieren – man darf’s nicht geschehen lassen! Dieses innerste Pünktlein ist im hellwachen, interessierten Dasein zu finden. In der Meditation spürt man es als eine innere Verbundenheit zu Gott, die als Sehnsucht wahrnehmbar ist, auch dann, wenn man nicht mehr meditiert. Es belebt in gleicher Weise die zwischenmenschlichen Beziehungen durch die Aufmerksamkeit, die man empfängt und einander schenkt. Das unsichtbare Band, das es zwischen den Menschen knüpft, spürt man als Dankbarkeit, stille Freude oder als Sehnsucht, auch wenn man nicht mehr im unmittelbaren Kontakt ist. Gehen hingegen die Aufmerksamkeit und das Interesse füreinander verloren, verflüchtigt sich das innerste Pünktlein unmerklich. Man macht zwar weiter wie gewohnt und verrichtet die äußeren Dinge wie sonst auch, und doch ist nichts mehr, wie es war. Das lebendige Interesse hat sich verflüchtigt und die innere Verbundenheit fehlt. Das innerste Pünktlein erscheint klein, doch die Leere, die es hinterlässt, ist groß.
Für Teresa von Avila war es wichtig, ihren Mitschwestern zu vermitteln, dass es nicht genügt, „beim Beten gewohnheitsmäßig Worte auszusprechen.“ „Ich will, dass wir uns mit dem bloßen Aussprechen von Worten nicht zufriedengeben.“ Es war ihr ein großes Anliegen zu vermitteln, dass man Gott mit Gebeten keinen Dienst erweist, die man gewohnheitsmäßig verrichtet, ohne innerlich beteiligt zu sein. Im übertragenen Sinne läuft man Gefahr, das innerste Pünktlein zu verlieren, das heißt das wache Interesse für Gottes Gegenwart; und damit verliert man schleichend auch die Verbundenheit zu Gott und die Sehnsucht nach ihm. Diese Gefahr besteht auch dann, wenn man das Gebet nur als Pflicht oder als Aufgabe ansieht, die man zu erfüllen hat. Ich erinnere mich an einen Mann, der davon sprach, dass ihm in der Meditation langweilig sei. „Langeweile in der Meditation ist ein klares Zeichen, dass man nicht in der Wahrnehmung ist. Mit der Wahrnehmung wird die Gegenwart interessant.“23 Im Gespräch mit ihm wurde deutlich, dass er das Spüren seiner Hände wie eine Aufgabe betrachtet hatte. Als er seine Hände spürte, war für ihn diese Aufgabe erledigt. Er meditierte zwar weiter, jedoch ohne darauf zu achten, was geschieht, wenn er seine Hände weiterhin bewusst wahrnimmt und hellwach und mit Interesse dabeibleibt.
Das innerste Pünktlein, das die Meditation wieder belebt, ist stets in der Gegenwart zu finden, im immerwährenden Zauber des Anfangs. Aus diesem Grund ist es wesentlich, jede Meditation bewusst wieder neu zu beginnen. Was erfahre ich, wenn ich mich jetzt mit der Aufmerksamkeit, die mir möglich ist, hellwach und mit lebendigem Interesse Gottes Gegenwart zuwende? In jeder Meditation lasse ich mich neu auf die Beziehung zu mir selbst ein und öffne mich immer wieder neu für die Beziehung zu Gott. In diesem Beziehungsgeschehen pulsiert mein Leben. Es ist niemals statisch, sondern macht jede Meditation zu einer einzigartigen, sich nicht wiederholenden neuen Erfahrung.
Du kannst immer mit Entschlossenheit versuchen, in die Wahrnehmung zu kommen, ob es gelingt oder nicht. Die Ergebnisse sind nicht wichtig. Wir müssen nichts erreichen. Der ernsthafte und ständige Versuch genügt. 24
Hindernisse, Probleme und Schwierigkeiten bleiben niemandem erspart. Sie sind ungefragt eine selbstverständliche Zugabe auf unserem Weg zu Gott, die man natürlich auch in der Meditation zu spüren bekommt. Man will zum Beispiel in die Wahrnehmung kommen, doch beständig taucht etwas auf, was einen sogleich wieder von der Wahrnehmung wegführt. Trotz Bemühung bleibt man an der Oberfläche. Hier ist Entschlossenheit vonnöten, um in der Meditation nicht aufzugeben und trotzdem dranzubleiben. Teresa von Avila spricht sogar von einer entschlossenen Entschlossenheit. Sie macht mit der Verdoppelung des Begriffs deutlich, wie unentbehrlich diese Haltung auf unserem Weg zu Gott ist. Sie schreibt, „dass viel, ja alles an einer großen und ganz entschlossenen Entschlossenheit gelegen ist, um nicht aufzuhören, bis man zur Quelle vorstößt, komme, was da kommen mag, passiere, was passieren mag, sei die Mühe so groß, wie sie sein mag, lästere, wer da lästern mag, mag ich dort ankommen, mag ich unterwegs sterben oder nicht beherzt genug sein für die Mühen, die es auf dem Weg gibt, ja mag die Welt untergehen …“25
Ihre Zeilen lassen erahnen, welche Kraft in einer entschlossenen Haltung liegt und welche Klarheit und Zielstrebigkeit sie zutage fördert. Diese Entschlossenheit findet man ebenso bei ihrer Mitschwester Therese von Lisieux, wenn sie sagt: „Ich finde es nicht der Mühe wert, die Dinge halb zu tun.“ „Nur halb“ zu meditieren würde bedeuten, dass man sich zwar zum Meditieren hinsetzt, dann jedoch die Zeit so dahinplätschern lässt und mit seiner Aufmerksamkeit mal hier und mal dort ist. Oftmals fängt man in einer unentschlossenen Haltung erst gar nicht zu meditieren an. Entschlossenheit hingegen führt zu klaren Entscheidungen und bündelt die Aufmerksamkeit. Dies meint aber nicht, angestrengt zu versuchen, in der Meditation irgendetwas zu erreichen. Dies unterstreicht Franz Jalics, wenn er sagt: „Entschlossenheit ist die geistige Haltung, sich auf etwas einzulassen, sich einer Sache zu schenken und sich ganz hinzugeben. Ob das von Erfolg gekrönt wird oder nicht, hat weniger Bedeutung.“26 Teresa von Avila wusste, dass sie auch mit der größten Entschlossenheit nichts herbeizwingen konnte und es auch gar nicht musste. Ihre Mitschwestern lehrte sie, dass es einzig und allein wichtig sei, „uns dem Schöpfer ganz hinzugeben und unseren Willen dem seinen zu ergeben“27. Es genüge, „Schritt für Schritt [zu] tun, was wir können“28. Jeder anscheinend noch so kleine Schritt führt uns näher zu uns selbst und näher zu Gott.
Wie wichtig die entschlossene Entschlossenheit ist, erfuhr eine Frau bei einer schwierigen inneren Wegetappe. Sie verhalf ihr dazu, Schritt für Schritt, vielleicht kann man sogar sagen Atemzug für Atemzug, weiterzugehen und nicht aufzugeben. Die Schwierigkeit in der Meditation bestand darin, dass sie ihre Hände kaum wahrnahm, obgleich sie sich bemühte. Der Name Jesus Christus löste in ihr einen inneren Widerstand aus. Sie erkannte aber, dass es eine Versuchung war, deshalb mit der Meditation aufzuhören. Entschlossen lenkte sie ihre Aufmerksamkeit in Richtung ihrer kalten Hände. Sie fühlte eine Ohnmacht und hatte den Eindruck, dass sich der Widerstand wie eine harte Kruste auf ihre kalten Hände legte. Aus dem Nichts heraus, so beschrieb sie ihr Erleben, platzte die Kruste auf einmal auf und eine längst vergessene Verletzung aus der Kindheit stand ihr plötzlich vor Augen. Sie sah den Küchentisch, auf den sie als kleines Mädchen an jeder Ecke einen Blumenstrauß gestellt hatte und einen besonders schönen in die Mitte. Sie hatte die Blumen mit viel Liebe auf einer Wiese für ihre Mutter gepflückt. Voller Vorfreude wartete sie auf die Mutter. Als diese endlich von der Arbeit kam, fing sie jedoch gleich zu schimpfen an, weil sie keinen Platz fand, um ihre Einkaufstaschen abzustellen. Die Frau konnte sich nicht mehr erinnern, ob sie damals geweint hatte, weil ihre Mutter ihre Liebe nicht wahrnahm und sie beschimpfte, statt ihre Liebe zu erwidern. Jetzt ließ sie ihre Tränen zu und hielt sie nicht zurück. Rückblickend erkannte sie, wie wichtig es war, dass sie trotz ihres Widerstands entschlossen immer und immer wieder zur Wahrnehmung zurückgekehrt war. Indem sie dabeiblieb und nicht flüchtete, konnte eine lang verdrängte Verletzung ans Licht kommen und Heilung finden.
Zwischen Wahrnehmung und Vorstellung gibt es einen großen Unterschied. Die Vorstellung ist unser eigenes Produkt, wenigstens kann sie ohne Beziehung zur Realität existieren. Sie ist im Kopf und gewissermaßen unabhängig von der Realität. 29
Vorstellungen trennen mich von der Realität und wirken wie eine Trennwand. Sie schieben sich zwischen mich und Gott, zwischen mich und den Mitmenschen und zwischen mich und meinen göttlichen Wesenskern. Was hinter der Trennwand liegt, bleibt im Verborgenen und beeinflusst dennoch meine Handlungen, Gedanken und Gefühle.
Bei einer belanglosen Situation wurde mir bewusst, wie sehr Vorstellungen unseren Blick einengen können und uns daran hindern, zu sehen, was ist. Die Teilnehmenden eines Meditationskurses wurden gebeten, vor ihrer Abreise ihr Zimmer zu putzen und den Teppich zu saugen. Eine Frau kam und sagte, dass sie dies gerne machen würde, doch in ihrem Zimmer sei keine Steckdose. Sie habe überall gesucht, sogar hinter dem schweren Kleiderschrank, den sie verrückt hatte. Doch nirgends sei eine Steckdose zu finden gewesen. Die Frau hatte recht. Überall, wo sie gesucht hatte, war tatsächlich keine Steckdose. Sie wohnte in einem modernen Apartment. Dort waren alle Steckdosen im unteren Bereich der Wand angebracht. Doch der Meditationskurs fand in einem alten Kloster statt. Hier befand sich die Steckdose auf Augenhöhe neben dem Türpfosten. Obwohl sie jeden Tag mehrmals an ihr vorbeiging, hatte sie die Steckdose nicht gesehen. Sie hatte sie dort auch nicht gesucht, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass man an dieser Stelle eine Steckdose anbringen kann.
Manche Vorstellungen, die man als Kind entwickelt hat, können bis ins Erwachsenenalter Realitäten hartnäckig verdecken. Eine Frau erzählte mir, dass sie schon als Kind gelernt hatte, alleine zurechtzukommen, wenn es ihr nicht gut ging. Ihr Vater, der sehr liebevoll zu ihr war, musste immer wieder auswärts arbeiten und war deshalb zeitweise zuhause abwesend. Sie entwickelte die Vorstellung, dass ihr Vater immer dann von zuhause wegging, wenn sie Kummer hatte. Diese Vorstellung übertrug sie unbewusst auf ihre Beziehung zu Gott. In den schwierigen Momenten ihres Lebens war Gott für sie ebenso abwesend wie ihr Vater. Sobald sie in der Meditation einen Schmerz spürte oder sich Ängste zeigten, spannte sie ihren Körper an und presste ihre Hände zusammen. Ihre Betroffenheit war groß, als ihr bewusst wurde, dass Gott für sie in diesen schwierigen Momenten so weit weg war, dass es ihr nicht einmal einfiel, ihn um Beistand zu bitten. Ihre Gedanken und Gefühle waren von der Vorstellung bestimmt: „Wenn es mir nicht gut geht, dann ist niemand da, und ich muss alleine schauen, wie ich zurechtkomme.“
Vorstellungen in Bezug auf die Meditation beeinflussen ebenso unser Befinden. Sie können uns unter Druck setzen, frustrieren und deprimieren. Häufig verstecken sich diese Vorstellungen hinter Wenn-dann-Sätzen. „Wenn ich mich nur richtig anstrenge, dann wird die Meditation gut.“ „Wenn ich anders wäre, würde Gott mich lieben.“ „Wenn ich lange genug meditiert habe, dann werden die Gedanken weniger werden.“ „Wenn ich unruhig bin, dann macht es keinen Sinn, dass ich meditiere.“
Vorstellungen wirken auf uns jedoch nicht nur negativ und blockierend. Sie können auch eine lebensbejahende Kraft in uns wecken. Ein herausragendes Beispiel ist das Lebenszeugnis von Viktor Frankl, der vier Konzentrationslager überlebt hat. Er stellte sich vor, wie er nach der Befreiung Vorlesungen über die Auswirkungen des Lagers auf die Psyche halten würde. Diese Vorstellung richtete ihn in all dem unsäglichen Elend auf das Leben aus. Sie war für ihn die entscheidende Kraft, unter widrigsten Umständen weiterzuleben.
Teresa von Avila empfiehlt, sich Christus vorzustellen, um sich in seine Gegenwart zu versetzen. Für sie können alle Schwierigkeiten im Gebet auf die eine Ursache zurückverfolgt werden, dass man so betet, als wäre Gott abwesend. Die Vorstellung, dass Gott liebevoll auf mich schaut, bringt eine Seelenkraft zur Entfaltung, die meine Präsenz weckt und mich von Anfang an auf Gott ausrichtet. Ich darf dann jedoch nicht in die Fantasie gehen, um mir etwas Schönes auszumalen, sondern ich öffne mich entschlossen dem Hier und Jetzt. „Die Meditation ist bodenständig und realitätsbezogen.“30 Ich bleibe also nicht bei einer schönen Vorstellung haften, sondern verbinde mich mit der Realität, indem ich meine Aufmerksamkeit auf die schlichte Wahrnehmung meiner Hände richte und Atemzug für Atemzug den Namen Jesu leise in mir erklingen lasse.
Versuche, wach bei der Wahrnehmung von etwas, wie zum Beispiel der Wärme, zu verweilen, auch wenn nichts Neues kommt. 31
Als mir vor vielen Jahren die Funktionen eines Computers erklärt wurden, musste die Einweisung unterbrochen werden, während ein Programm auf den Computer heruntergeladen wurde. Während dieser Zeit waren die Funktionen des Computers blockiert. Am Bildschirm erschien eine kleine Sanduhr. Ich stellte den Computerexperten die naive Frage, ob wir jetzt so lange warten müssten, bis der Sand durchgelaufen sei. Er lächelte und meinte, dass man an der Sanduhr nichts dergleichen ablesen könne. Sie diene nur zur Beruhigung. Wer warten müsse, würde schnell ungeduldig werden. Es täte dann gut, auf etwas schauen zu können, was sich bewegt. Man bekäme dann den Eindruck, dass die Situation unter Kontrolle sei und etwas voranginge. Im Grunde könne man aber nichts beschleunigen. Man müsse einfach warten. Heute ist die Sanduhr abgelöst durch eine Murmel, die sich beständig dreht und die gleiche beruhigende Wirkung ausüben soll. Einfach „nur“ zu warten, während anscheinend nichts passiert, und noch dazu nicht zu wissen, wie lange man warten muss, löst in der Regel großes Unbehagen, Ungeduld und nicht selten Ärger aus.
In diesen Zustand kann man auch in der Meditation geraten. Ich denke an eine Frau, die mir sagte, dass sie in der Meditation zwar spürte, dass ihre Hände warm geworden waren, dass aber während der ganzen Meditation sonst nichts weiter passierte. Im Laufe der Zeit sei sie dann immer ungeduldiger geworden. Schließlich habe sie nur noch auf den Gong gewartet. Sie erlebte die Wahrnehmung ihrer gleichbleibend warmen Hände als Stillstand, da nichts Neues hinzukam. Es ist zunächst ungewohnt, dass auf dem kontemplativen Weg nichts Neues hinzukommen muss. Hier dürfen wir bei etwas bleiben, auch wenn dieses Etwas schlicht, klein und unspektakulär ist, wie zum Beispiel das Empfinden der Wärme unserer Hände. Franz Jalics gibt klar zu verstehen: „Das Empfinden der Handflächen führt uns direkt in die Gegenwart und damit in die Richtung der Gegenwart Gottes.“32 Im Verweilen-Dürfen, im Nicht-weiter-sein-Müssen nähern wir uns unserem Sein. Unmerklich verändert dies unsere innere Haltung. Wir verzichten auf das eigene Tun und verlassen den eingetretenen Pfad, etwas aus eigenen Kräften erreichen und verändern zu müssen. Stattdessen lassen wir uns von dem, was bereits da ist, berühren.
Die Frau versuchte nun ein Interesse dafür zu entwickeln, was geschieht, wenn sie nur die Wärme ihrer Hände wahrnimmt und nur bei dieser Empfindung verweilt. Sie registrierte nun nicht nur kurz die Wärme ihrer Hände in der Erwartung, was dann als Nächstes passieren würde. Sie ließ jetzt die Empfindung ihrer Hände auf sich wirken. Wenn Gedanken kamen, kehrte sie wieder zu dieser Empfindung zurück. Sie empfand die Wärme als wohltuend und den Hinweis, dass sie dabei nichts erreichen müsse, als entlastend. In diesem schlichten Dabei-Sein und Dabei-Bleiben erlebte sie etwas, was sie sehr berührte: ein Empfinden von Innigkeit. Der Gong kam dann für sie völlig überraschend. Sie konnte kaum glauben, dass bereits eine halbe Stunde vergangen war. Das Verweilen bei der direkten Erfahrung des Augenblicks geht einher mit einer anders empfundenen Zeiterfahrung. Das achtsame Bei-sich-Sein und Bei-sich-bleiben-Dürfen führt uns tiefer in die Verbindung zu uns selbst. Die Wahrnehmung kann sich vertiefen, da wir es uns gestatten, mit unserer Aufmerksamkeit bei etwas Schlichtem und Einfachem zu bleiben. Dies stärkt unsere Fähigkeit zum Verweilen. „Das kontemplative Verweilen gibt Zeit. Es weitet das Sein, das mehr ist als Tätig-Sein. Das Leben gewinnt an Zeit und Raum, an Dauer und Weite, wenn es das kontemplative Vermögen wiedergewinnt.“33