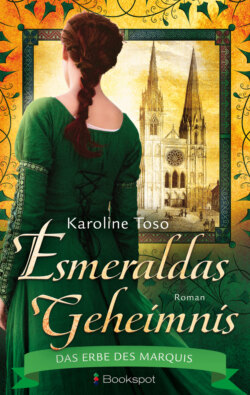Читать книгу Esmeraldas Geheimnis - Karoline Toso - Страница 7
Kapitel 2
ОглавлениеM
adame Paloma! Wie gut, Euch endlich wieder einmal zu treffen! Monsieur Trouillefou bittet Euch um eine Unterredung. Sagt mir, wann Ihr wieder zu uns ins Quartier kommen könnt, er will dann für Euch da sein. Und grüßt Quasimodo bitte von mir. Geht es ihm gut?«, redete Enzo Lesable Sophie am Markt an. Auch sie freute sich, ihn zu sehen.
»Gerne komme ich heute Abend, um Monsieur Trouillfou zu treffen. Meinem Sohn geht es so weit gut, danke, allerdings belastet es uns beide, dass ihn niemand mehr am Turm besuchen darf. Auch ich kann mich nicht mehr frei bewegen, seit Pater Gregoire Stadtvogt geworden ist. Ein Küchenbruder stellt uns täglich einen Korb mit Speisen vor die Tür zum Turm, damit ich sie nicht vom Markt holen und damit durch die Kathedrale gehen muss. Obwohl ich die Mutter des Glöckners bin, sollte man nicht sehen, dass ich mit ihm im Turm wohne. Stell dir vor, sobald ein neuer Glöckner eingelernt ist, müssen wir sogar den Turm verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Simon woanders als da oben glücklich wird, ohne seine Glocken und die Tauben.«
Enzo nickte traurig.
»Ja. Es gibt keine Freiheiten mehr, nicht einmal Darbietungen der Gaukler dürfen auf den großen Plätzen stattfinden und Zigeuner werden schon von Bütteln abgeführt, wenn sie nur die Fiedel auspacken. Wie sollen sie ihr Geld verdienen, um zu überleben? Dabei sehnen sich die Leute doch nach Musik und Ablenkung.«
»So viel hat sich verändert. Ich freue mich, heute Abend auch dich wiederzusehen, Enzo, und in Ruhe zu reden.«
Sie blickten einander vertraut an. Keiner der beiden hatte den ›Hof der Wunder‹ genannt, auch wenn sie gerade etwas abseits des Markttrubels waren.
»Dann werdet Ihr also wieder bei uns leben, gemeinsam mit Quasimodo?«
Enzo freute sich sichtlich.
»Das ist es ja. Vorherige Woche bat ich Trouillefou darum, mit Simon wieder in unser Quartier zu ziehen, doch er zauderte, wollte sich mit Hyniadi Spicali beraten. Hoffentlich erteilt er uns keine Absage, denn ich wüsste nicht, wo ich mit meinem Sohn leben soll, du kennst ihn ja, menschenscheu wie er ist.«
»Das wäre schlimm! Aber, Madame, falls Ihr nicht in Euren ehemaligen Räumlichkeiten leben könnt, möchte ich mit Euch kommen, wohin auch immer. Ihr habt mich von der Straße aufgelesen und mir nicht nur eine Familie, sondern ein würdiges Dasein geschenkt. Ich denke täglich dankbar daran, wie schön mein Leben geworden ist, seit mich Dom Frollo damals zu Quasimodo in den Turm geschickt hat.«
»Ach ja, Dom Frollo.«
Sie senkte den Blick. Seit ihre Esmeralda aus Paris flüchten musste, bemühte sich Sophie, den Priester und damaligen Archidiakon möglichst aus ihren Gedanken zu verbannen. Neben all den Sorgen verkraftete sie die Verwirrung rund um diesen düsteren Benediktiner nicht. Er hatte ihren Sohn gerettet und ihn liebevoll erzogen. Auch bei Esmeraldas Flucht hatte er geholfen. Und bevor er als Einsiedler in die Bretagne gegangen war, hatte er ihr und ihrem Sohn das Leben mit einer großen Geldspende gesichert. Dennoch, da war noch jener Vorfall auf dem Turm. Jedes Mal, wenn Sophie daran dachte, durchrieselte sie eine Kälte, als müsste sie innerlich erfrieren. Noch schlimmer war es aber, nicht zu wissen, wie es Esmeralda nun nach der Schändung und der Flucht ergangen war. Mutter Pauline, die Äbtissin der Klarissen, hatte nur mitteilen lassen, dass sie gesund in Chartres angekommen sei und als Agnès de Blancheforet den Duc de Valois geehelicht hatte. Mehr wusste sie nicht. Das brachte Sophie zum Denken. Wie konnte der Wildfang Esmeralda, die begehrteste Tänzerin unter allen Zigeunern, als Duchesse in einem Schloss leben? Hatten ihre Unterrichtsstunden in Etikette, Sprachen und im Schreiben, die sie dem Töchterchen als Kind erteilt hatte, ausgereicht, um sie diese Lebensrolle spielen zu lehren? Konnte Esmeralda ihren Freiheitsdrang und ihre wahre Identität erfolgreich überspielen? Und was, wenn nicht? Mutter zu sein hieß, sich zu sorgen, so würde es für Sophie wohl immer bleiben.
»Was wohl aus der schönen Esmeralda geworden ist? Ich denke so oft an sie. Glaubt Ihr, sie konnte der Inquisition erfolgreich entfliehen? Bitte sagt mir, dass sie in Sicherheit ist!«
»Lieber Enzo, für sie, aber auch für mich ist es gefährlich, auch nur ihren Namen zu nennen. Aber ich verstehe deine Sorge nur zu gut. Versprich mir, sie nie wieder zu erwähnen, Spitzel gibt es leider überall. Aber ja, sie lebt in Sicherheit weit weg von hier«, flüsterte Sophie. Enzo atmete erleichtert auf.
»Wisst Ihr, woran ich manchmal gedacht habe? Dom Frollo war der erste Mensch, der, seit ich denken kann, großzügig zu mir war. Ich würde ihn so gerne wiedersehen, mit ihm sprechen, ihm stolz zeigen, was durch seine Hilfe aus mir geworden ist, und dass ich durch Euch, Madame Paloma, sogar ein wenig lesen und schreiben kann. Wenn er schon nicht nach Paris kommen kann, möchte ich ihn in seiner Einsiedelei besuchen. Bald haben wir Sommer. Falls Ihr mit Quasimodo nicht bei uns im Quartier leben könnt, reisen wir zu Fuß in die Bretagne. Vielleicht schließen sich Eure ehemaligen Truppenmitglieder an, dann können wir mit Darbietungen unterwegs unser Brot verdienen.«
Sophie war verwundert. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass Enzo ahnte, warum Trouillefou sie sprechen wollte. Es ging darum, geheim zu halten, wo sich der ›Hof der Wunder‹ befand, was sich mit einem Bewohner wie dem Glöckner, ihrem Sohn Simon, schwierig gestalten würde. Selbst wenn er das Quartier kaum verlassen würde, wollte er sich bestimmt auf den Dächern der Wohnhäuser aufhalten, um weiterhin Kontakt zu seinen Tauben zu pflegen. Somit wäre er für die Stadtwache wie ein Signal, das sie endlich zum lang gesuchten Zufluchtsort aller Rotwelschen führen würde.
»Du hast ja Einfälle, lieber Enzo! Heute, nach dem Gespräch mit Trouillefou, werde ich zu euch ins Quartier kommen, da können wir über alles in Ruhe reden. Ehrlich gestanden freue ich mich sehr, alle wiederzusehen. Was kannst du mir über Pierre Gringoire erzählen und über Djali?«
Enzo lachte.
»Unser Pierre philosophiert nur noch mit den Tieren, vor allem mit Djali. Sie sind die Einzigen, die sein unausgesetztes Gequassel ertragen können, doch sie lieben ihn. Hühner und Ziegen gedeihen unter seiner Obhut prächtig. Wir leben in wahrem Reichtum, haben Eier, Ziegenmilch und ab und zu gebratenes Huhn, im Winter mitunter sogar Ziegenfleisch, weil es sich in solch einer Kälte länger lagern lässt.«
»Das ist schön! Ich freue mich auf euch. Bestell für heute Abend einen großen Krug Wein in der Schenke bei euch, damit wir unser Wiedersehen feiern können.« Sie gab ihm fünf Sol.
»Wunderbar! Isabelle wird weißes Brot backen. Das wird ein richtiges Fest!«
Als Sophie die Stufen zum Turm hochstieg, dachte sie über Enzos Vorschlag einer Wanderung nach. Dom Frollo zu besuchen widerstrebte ihr zwar, aber sie könnten nach Chartres gehen oder zumindest für ein paar Tage dort verweilen. Natürlich würde sie nichts unternehmen, was für Esmeralda eine Enttarnung bedeuten könnte, aber in ihrer Nähe zu sein und auf Märkten vielleicht etwas über die Duchesse zu erfahren wäre wunderbar. In Paris breiteten sich zunehmend bedrückende Angst und Misstrauen aus. Jeder wirkte verdächtig, jeder konnte ein Spitzel der schwarz-weißen Vertreter der Inquisition sein, Dominikaner, die ihren Glauben als Hetzjagd gegen jegliches Vergnügen verstanden. Statt des regen Treibens auf den Plätzen, statt Zigeunermusik und Tanz, gab es vorwiegend stille Prozessionen dieser Gestalten, die ihre Augen und Ohren überall zu haben schienen. Schon ein zu lautes Lachen konnte verhängnisvoll werden. Der Gedanke, mit Simon im ›Hof der Wunder‹ zu leben, schien plötzlich kein erstrebenswerter mehr zu sein, doch von Ort zu Ort zu wandern wie damals, als sie selbst als Flüchtende bei Zigeunern aufgenommen worden war, weckte Freude und auch etwas Hoffnung in ihr.
Oben schrieb sie ihrem Simon die Neuigkeiten auf, auch dass er an diesem Abend und vielleicht auch am folgenden Morgen allein am Turm bleiben müsste. Spät nachts vom ›Hof der Wunder‹ durch die Stadt zur Kathedrale zu gehen, erachtete sie als gefährlich. Seit Simon wusste, dass sie den Turm in absehbarer Zeit verlassen mussten, huschte kein Lächeln mehr über sein Gesicht, er hatte keinen Appetit und sprach kaum noch, obwohl sie das wegen seiner Schwerhörigkeit regelmäßig mit ihm trainiert hatte. Die Tauben drängten sich besonders an ihn, setzten sich auf seine Arme und Schulten, sogar auf seinen Kopf. Das machten sie immer, wenn er traurig oder verärgert war. Wie sie seine Gemütsverfassung errieten, blieb sein Geheimnis.
›Werden mich die Tauben finden, wenn ich nicht mehr am Turm bin?‹, schrieb er.
Sophie zuckte mit den Schultern. Sie wollte ihm nicht auch noch mitteilen, dass Vögel ortsorientiert lebten und sich daher nicht an Menschen banden. Andererseits kamen sie auf seine gurgelnden Lockrufe. Vielleicht blieben ihm einige auf der Wanderschaft treu, denn das könnte seinen Abschiedsschmerz zumindest etwas mildern.
Als Sophie an diesem Abend durch düstere Gassen und über verborgene Durchgänge die ersten Gebäude des ›Hofs der Wunder‹ erreichte, durchschauerte es sie. Dies war ihre Zuflucht gewesen und blieb dennoch ein geheimer Ort des Verbrechens. Von Ferne hörte sie kreischendes Lachen und dumpfes Grölen, so nahe war sie dem Zentrum des Reichs der Verlorenen und Vogelfreien. Bald roch sie schon Gebratenes, an manchem Eck wartete Erbrochenes darauf, vom nächsten Regenguss weggespült zu werden. Ratten tummelten sich darum. Bevor sie den Kaiser der Rotwelschen, Clopin Trouillefou, aufsuchte, wollte Sophie in ihre ehemaligen Räumlichkeiten, um die Truppenmitglieder von damals zu begrüßen.
Wie erwartet, erklärte ihr Trouillefou später beim Gespräch unter vier Augen so umständlich und höflich, wie es ihm nur möglich war, dass ein Mensch wie Quasimodo den ›Hof der Wunder‹ früher oder später enthüllen würde. Deswegen könne Sophie nicht mit ihm in ihr ursprüngliches Quartier ziehen. Wie gut, dass Enzo den Vorschlag einer Wanderung gemacht hatte, denn diese Absage hätte Sophie sonst zu hart getroffen. Etwas nervös fragte sie anschließend ihre ehemalige Zigeunertruppe, ob sie sich vorstellen konnten, wieder mit ihr durch die Lande zu ziehen.
»Fort aus Paris? Hier haben wir unsere Lebensgrundlage, verkaufen Produkte auf dem Markt, haben unser Kleinvieh, das versorgt werden muss, und können in der kalten Jahreszeit Lesen und Schreiben unterrichten, wie du es uns vor Jahren beigebracht hast. Du weißt ja, dass dies unsere einträglichste Tätigkeit ist. Es nehmen ja nur Reiche solche Dienste in Anspruch«, erklärte Etienne, der inzwischen Isabelle geehelicht hatte. Das Wiedersehen mit Sophie bedeutete allen sehr viel. Niemand wollte sich vorstellen, sie nicht mehr in Paris zu wissen, selbst wenn sie seit Esmeraldas Verschwinden fast nur bei ihrem Sohn im Turm der Notre-Dame gelebt hatte.
»Als Truppe wie damals sehen wir uns nicht mehr, Sophie. Tagelange Wanderungen von Ort zu Ort sind für Miguel und mich nicht möglich, und schon gar nicht, unter freiem Himmel zu übernachten wie früher. Im Herzen sind wir jung geblieben, aber der Körper spielt da nicht mehr mit«, wandte auch Rosa bedauernd ein. Sophie schaute Enzo unsicher an. Sollte sie ihm die sichere Lebensgrundlage hier in Paris entziehen? Wovon wollten sie unterwegs leben? Zwar besaß sie noch einige écus d’or von Dom Frollo, aber auch bei sparsamem Gebrauch würde das nicht ewig reichen, vor allem im Winter müssten sie ein Quartier bezahlen.
»Mir bleibt leider nichts anderes übrig, als Paris zu verlassen. Simon kann nicht unter so vielen Menschen leben. Aber, Enzo, ich möchte dir nicht zumuten, das alles hier aufzugeben. Doch ich will auch nicht verhehlen, dass ich es nicht wage, als Frau allein zu reisen, selbst wenn Simon stark ist und mich beschützen könnte, aber er ist auch menschenscheu. Vielleicht könntest du mich bis in die Nähe von Chartres begleiten, wo ich in der Lage wäre, eine kleine Bleibe zu mieten oder zu kaufen, vielleicht mit einem Garten für Gemüse und Kleinvieh. Das könnte den Lebensunterhalt für Simon und mich sichern.
»Ich reise auf alle Fälle mit Euch, wohin auch immer, Madame Paloma! Und wenn Ihr Euch nahe Chartres ansiedeln wolltet, wäre ich bereit, allein bis in die Bretagne weiterzuwandern, um Dom Frollo wiederzusehen.«
Enzo, im Grunde eher zurückhaltend, ereiferte sich richtiggehend. Für ihn war es vielleicht ein Abenteuer, auf alle Fälle aber freute er sich, Sophie helfen zu können. Sie legte die Hand auf seine Schulter und schaute ihn dankbar an. Wie erwartet, wurde es zu spät, um nachts noch zur Notre-Dame zurückzukehren. Sophie fühlte sich um Jahre zurückversetzt, als sie sich auf ihr ehemaliges Lager begab, das sie in dieser Nacht mit Isabelle teilte. Die Holzliege roch gleich wie damals, in der Matratze knisterte frisches Stroh. Hier hatte sie nach Jahren der Wanderschaft mit Esmeralda Frieden gefunden. Von der Schenke kam gedämpftes Lärmen. Auch das fühlte sich heimatlich an. Isabels ruhiger Atem ließ sie endlich auch selbst zur Ruhe kommen und Schlaf finden. Beim Abschied am folgenden Morgen vereinbarte sie, Enzo zu benachrichtigen, sobald sie aufbrechen mussten.
Ein junger Ordensbruder, Thaddäus, teilte sich bereits seit einigen Wochen den Glockendienst mit Simon. Sophie half bei den Erläuterungen und schärfte ihm ein, unbedingt die Wachsstöpsel zu verwenden, damit er nicht, wie ihr Sohn, das Gehör verliere. Der Orden konnte also jederzeit anordnen, den Turm zu räumen, Simons einziges Zuhause, seinen Zufluchtsort. Nachdenklich eilte Sophie über den Place de Grève, der in all den Jahren nichts von seiner Düsterkeit verloren hatte. Ihn zu überqueren hieß, das Grauen angesichts des Galgens und Prangers zu verdrängen. Jeder Pflasterstein sprach von Angst und Blut der hier Verurteilten. Wie eine Sinnestäuschung vernahm Sophie plötzlich ein leises Lallen. Doch niemand war zu sehen. Das dünne Stimmchen kam Sophie bekannt vor. Lauschend blieb sie stehen. Da war es wieder: »Ist die Sängerin und ist es nicht. Ist die Mutter und ist es nicht. Ist die Klausnerin und ist es nicht …«
Sophie schauderte es. Hörte sie am hellen Morgen Gespensterstimmen? Dieses wimmernde Lallen klang nicht menschlich. Es kam aus der schattigen offenen Klause am Rolandsturm. Sie ging hin und entdeckte eine skelettartige Gestalt, die in einem Haufen aus Laub und Sand lag, welche ins Eck dieser Vertiefung geweht worden waren. Wäre da nicht die fahle Haut, hätte man das Bündel Mensch gar nicht erkannt, so sehr ähnelte es den abgestorbenen Blättern. Da fiel es Sophie wie Schuppen von den Augen.
»Schwester Gudule?«
»Hihi«, lachte es dünn zurück.
Wie konnte diese Frau überhaupt überlebt haben? Unglaublich, dass ausgerechnet sie die leibliche Mutter ihrer geliebten Esmeralda war. Sophie wünschte sich, diese Begegnung nicht gehabt zu haben. Sie konnte das Geschöpf in der offenen Klause nicht ignorieren, aber sich darum kümmern konnte sie noch weniger, es plagten sie genug eigene Sorgen. Einige Augenblicke lang stand sie am Rand der Mulde und kämpfte mit sich. Zu Simon auf den Turm zu eilen war alles, was sie wollte, aber die Sterbende einfach liegen zu lassen, brachte sie nicht übers Herz.
»Schwester Gudule, kommt mit mir, Ihr braucht etwas Stärkendes, eine warme Suppe vielleicht und einen Umhang, Ihr habt ja kaum etwas, womit Ihr Eure Blöße bedecken könnt.«
Als sie sich hinabbeugte, um der Frau aufzuhelfen, fand sie, dass eine ordentliche Waschung wohl auch vonnöten sei.
»Paquette hat einen Schatz, einen wertvollen Schatz«, brabbelte die Schmächtige und öffnete die linke Hand, in der zwei schmuddelige Knäuel lagen. Sophie schauderte es. Trotz der grauen Färbung und zerfransten Struktur erkannte sie sofort die beiden ehemals rosafarbenen Säuglingsschuhe wieder, Esmeraldas Talisman und Erkennungszeichen für die Mutter.
»Schwester Gudule! Kommt in die Sonne, ich will Euch helfen«, bat Sophie. Diese Frau hatte nur die kleinen Seidenschuhe, sie selbst aber hatte die Liebe und Lebendigkeit der Tochter erleben dürfen. Auf Sophie gestützt erreichten sie den Galgen, auf den die Morgensonne schien. Zum Glück war er leer und um diese Zeit keine Menschenseele außer ihnen beiden auf dem Place de Grève. Sie lehnte die Klapprige an den breiten Pfosten, diese schloss die Augen und drückte die linke Faust ans Herz. Anscheinend hielt sie die beiden Seidenschuhe immer in der Faust.
»Hier kam das Mönchlein zur Klausnerin. Hier hat es sich in die schöne Agnès verwandelt. Hier hat die Trauernde ihre Tochter wiedergefunden«, murmelte sie. Sophie wusste nur zu gut, was sie meinte, denn Esmeralda war damals mit Frollos Hilfe im Mönchsgewand aus der Kathedrale geflohen, hatte sich dann bei den Klarissen versteckt, bis sie mithilfe der Äbtissin unter falschem Namen nach Chartres gebracht worden war. Eigenartig an dieser ohnehin verworrenen Tatsache war, dass Esmeralda nun denselben Vornamen trug, den sie einst von ihrer Mutter bekommen hatte, Agnès. Und auch diese war nicht immer Schwester Gudule gewesen, sondern eine begnadete Sängerin und Tänzerin in Riems, Paquette Chantfleurie genannt. Warum hatte das Schicksal sie ausgerechnet jetzt zusammengeführt, da sie an der Schwelle eines neuen Lebensabschnittes war und alle Kraft für Simon brauchte, der es nur schwer verkraften würde, den Turm der Notre-Dame zu verlassen?
»Ich will Euch helfen, Schwester Gudule, aber versprecht mir, nicht mehr von Eurer Tochter zu sprechen, mit niemandem, sonst schadet Ihr Eurem Kind. Versteht Ihr das?«
Die Angesprochene starrte Sophie aus leeren Augen an.
»Ist die Sängerin und ist es nicht. Ist die Klausnerin und ist es nicht. Ist die Mutter und ist es nicht und ist es nicht und ist es nicht«, brabbelte sie.
»Schweigt! Ich bitte Euch!«
»Ist die Sprecherin, doch keiner hört zu und keiner kann verstehen, keiner.«
»Das hoffe ich! Bleibt hier in der Sonne, ich hole Hilfe. Wenn Ihr weggeht, werde ich Euch nicht suchen, ich habe wahrlich anderes zu tun. Bleibt also hier, Schwester Gudule.«
Diese lächelte nur vor sich hin und reckte ihr graues Gesicht in die Sonne. Sophie eilte zurück zum ›Hof der Wunder‹. Sie wusste, dass Trouillefou niemals erlauben würde, die ehemalige Klausnerin aufzunehmen, denn Verschwiegenheit war von ihr nicht zu erwarten, doch Sophie besaß ja noch etwas von Frollos Geld. Einen Teil davon könnte sie für die leibliche Mutter ihrer Esmeralda verwenden und damit ihr Gewissen beruhigen. Zwar trug sie keine Schuld daran, Esmeraldas Mutter geworden zu sein, doch sie hatte alle Freuden mit dem Kind erlebt, während Gudule am Schmerz des Verlustes zerbrochen war. Das allein verpflichtete sie, der Bedauernswerten zu helfen. Im Quartier traf Sophie nur Rosa an, alle anderen waren längst zu ihren Tätigkeiten unterwegs. In kurzen Worten war die Notlage geschildert.
»Im Augenblick habe ich nur zehn écus bei mir. Das muss reichen, um für Schwester Gudule eine ordentliche Behandlung im Badehaus zu sichern, etwas Kleidung und eine vorübergehende Bleibe in einer Schenke. Schau bitte täglich nach ihr, ich werde das auch tun. Heute Abend komme ich wieder und bringe dir mehr Geld für sie.«
»Schade, dass wir sie nicht hier aufnehmen können, das würde die Sache erheblich vereinfachen«, meinte Rosa.
»Heimlich auf keinen Fall! Trouillefou hängt sie an den Galgen, so viel ist sicher.«
»Ich weiß. Leider!«
Gemeinsam eilten sie zum Place de Grève, wo die dünne Frau in ihren Lumpen saß und sich sonnte.
»Kommt, Schwester Gudule, ich kümmere mich um Euch«, sagte Rosa mit sanfter Stimme.
»Paquette hat einen Schatz, zwei Teile und einen Schatz. Es ist der wertvollste Schatz«, brabbelte diese und öffnete ein wenig die linke Faust, um Rosa die schmuddeligen Säuglingsschuhe zu zeigen.
Simon war es gar nicht mehr gewohnt, allein im Turm zu sein. Er umarmte seine Mutter, als sie endlich wiederkam. Sie hatte vom Markt etwas Brot und Obst mitgebracht. Nach dem verspäteten Frühstück schrieb sie ihm die wichtigsten Neuigkeiten auf. Enzo bald wiederzusehen freute ihn sehr, aber die Notre-Dame verlassen zu müssen schien ihm unvorstellbar. Seit seinem zehnten Lebensjahr lebte er in dem Turm. Mit nicht einmal fünf Jahren hatte ihn Dom Frollo von der Findlingskrippe aufgelesen und sich um ihn gekümmert. Seitdem war die Kathedrale Teil seines Lebens und die Glocken seine ganze Freude, auch wenn sie ihm das Gehör genommen hatten. Wie konnte ein Leben außerhalb dieser Mauern aussehen? Seine Tauben könnten ihm davon erzählen, aber er war nicht so frei wie sie.
»Bleiben!«, formulierte er. Sophie brach das Herz. Sogar sprachlich bat er zu bleiben, wo er sonst nicht gern Worte aussprach. Dass sie am Abend wieder weggehen würde, verstand er auch nicht. So knapp wie möglich notierte sie die Begegnung mit Schwester Gudule, erwähnte aber nicht, dass diese Esmeraldas Mutter war. Simon war auch so schon von all den Veränderungen verwirrt genug. Hoffentlich ging es Schwester Gudule etwas besser. Wieder zum ›Hof der Wunder‹ zu gehen fiel ihr schwer, doch Rosa brach gleich mit ihr auf, um in der Schenke nahe des Place de Grève die Klausnerin aufzusuchen. Unterwegs berichtete sie: »Gudule ist so unterernährt, dass sie kaum Nahrung verträgt. Nach einem langen Bad und nachdem man ihr die Haare kurz geschnitten hat, flößte ich ihr warme Brühe ein, nur das kann sie zurzeit vertragen. Trotz der Sommerhitze in der Stadt war sie über die beiden Kleider und die Schuhe dankbar, die ich ihr gekauft habe. Sie trägt die Kleider übereinander und sieht dennoch aus wie ein Gerippe. Es wird Wochen dauern, bis sie wieder genesen ist, doch mach dir keine Sorgen, Sophie. Solltet ihr drei bald aufbrechen müssen, werde ich mich weiter um sie kümmern.«
Dankbar legte Sophie die Hand auf Rosas Schulter.
Gudule bewohnte eine Kammer im hinteren Bereich der billigen Schenke.
»Ich habe der Wirtin ausdrücklich gesagt, dass dem Gast kein Wein geboten werden darf. Da ich aber täglich vorbeischaue und ihr die Suppe bringe, wird das schon gut gehen. Man war hochzufrieden, als ich für zwei Wochen im Voraus zahlte. Unsere Klausnerin ist hier so etwas wie ein Ehrengast.«
Rosa war stolz auf ihr Verhandlungsgeschick und auch über die pflegende Aufgabe. Sie klopften zaghaft.
»Niemand klopft bei der Klausnerin. Man geht vorbei, schaut kaum herein. Und keiner entdeckt ihren Schatz, den frisch gewaschenen schönen Satz«, hörten sie die brabbelnde dünne Stimme und traten ein.
Wie eine Figur aus Stein saß Gudule auf der Liege. Es war düster in der Kammer, so wirkte ihr fast kahler Schädel mit den tief liegenden umränderten Augen und dem lippenlosen Mund wie ein Totenkopf.
»Schaut nur! Schaut!«, hauchte die Frau und hielt in jeder Hand ein fast rosafarbenes Knäuel.
»Die Tochter lebt!«, flüsterte sie weiter und machte mit den kleinen Seidenschuhen Schrittbewegungen in der Luft.
»Schwester Gudule! Ich hatte Euch gebeten, nicht mehr von Eurer Tochter zu sprechen.«
Esmeralda wurde seit Langem von niemandem mehr erwähnt und so sollte es auch bleiben. Sophie fand Paquettes unbedachtes Plappern bedenklich.
»Es ist nicht die Tochter, von der die Klausnerin spricht. Es ist der Schatz, der ihr geblieben ist. Er ist der lebendige Beweis ihrer Liebe.«
In der Kammer war es stickig und schwül.
»Mich friert’s«, piepste Gudule.
»Morgen bringe ich euch einen warmen Umhang«, versprach Rosa. Ihre Stimme hatte etwas Beruhigendes, Weiches. Sophie schob den Lederlappen von der Luke an der Tür, die auf einen Gang führte, an dessen Ende eine weitere Luke etwas Sonnenlicht hereinließ. Abgesehen davon hatte die Kammer kein Fenster. Ein paar Löffel der warmen Brühe, die Rosa ihr mitgebracht hatte, ließ sich Gudule einflößen, dann sank sie erschöpft auf die Liege und schlief ein. Rosa überprüfte noch, ob der Güllekübel gelehrt werden musste, doch er war sauber und enthielt ein wenig Wasser. Ein Krug mit frischem Wasser stand gefüllt auf dem Tisch, daneben ein Becher. Auf der Liege war eine Decke bereitgestellt, Sophie legte sie über die Schlafende.
Wie konnte sie die letzten Jahre bloß überleben? ging ihr durch den Kopf. Dann verabschiedete sie sich von Rosa, die noch ein wenig bei Gudule blieb. Vor der Notre-Dame kam einer der Budenverkäufer auf sie zu.
»Madame Paloma?«, redete er sie an. Irritiert blieb sie stehen. Warum sprach sie ein Fremder mit Namen an?
»Ich verkaufe hier Waren aus dem Dorf Chemijaune nahe Paris. Mein Nachbar betreut einen Taubenschlag mit Brieftauben. Gestern kam er aufgeregt zu mir, denn Nachrichten aus fernen Städten erreichen uns selten.«
Sophie wusste nicht, was sie von all dem halten sollte. Sie witterte einen Hinterhalt durch Spitzel der Inquisition. Ob man noch immer nach Esmeralda suchte?
»Mein Nachbar ist als Betreuer der Tauben auch ein wenig des Lesens kundig. Hier habe ich also eine Nachricht aus Chartres für eine Madame Paloma, die im Turm der Notre-Dame wohnt.«
Damit überreichte ihr der klobige Mann ein kleines Stück zusammengerolltes Hanfpapier. Sie zitterte leicht. Was konnte das bedeuten? Rasch kramte sie einige Sous hervor, wofür sich der Mann tief verneigte. Erst im Inneren der Kathedrale wagte sie es, das Papier zu entrollen. Es drang gerade noch genug Licht hindurch, um die winzigen Buchstaben zu entziffern:
›Cousin, Mutter und Kind sind wohlauf. Jean de Bouget‹
Sophie hatte kaum Wissen über Brieftauben, eines aber war klar, auch ihre Botschaften mussten verschlüsselt sein, sollte jemand der Inquisition sie in die Hände bekommen. Mit ›Cousin‹ war wohl Frollos junger Bruder Jean gemeint. Auch er hatte vor der Inquisition fliehen müssen. Während weiterer Überlegungen schossen ihr Tränen in die Augen. ›Mutter und Kind‹ konnten demnach Esmeralda mit Kind bedeuten. Führte sie ein glückliches Leben an der Seite ihres Gemahls? Nun drängte es sie regelrecht, aufzubrechen und nach Chartres zu ziehen, sich dort anzusiedeln und in der Nähe ihrer Tochter zu leben. Auf dem Land, abgeschieden von der Vielfalt in Paris, würde sich bestimmt auch Simon wohlfühlen, umgeben vielleicht von Kleinvieh, womöglich mit einem eigenen Taubenschlag.
›Wir brechen so bald wie möglich auf‹, schrieb sie Simon mit Kreide auf die Holztafel, die er immer bei sich trug. Dann zeigte sie ihm feierlich die kleine Nachricht aus Chartres.
›Cousin ist Jean?‹, schrieb Simon auf die Tafel, wo man sofort alles Verräterische abwischen konnte. Sophie nickte. Jetzt konnte auch er lächeln.
»Jean!«, rief er.
Sophie streichelte ihm übers Haar und über die Wangen. Dann legte sie den Zeigefinger an die Lippen und schrieb: ›Sag nie die Namen Jean oder Esmeralda laut und schreibe sie nie auf Papier!‹
Erschrocken schaute er sie an und erinnerte sich an die Turbulenzen, als Jahre zuvor Vertreter der Inquisition, aber auch andere Bürger, die Notre-Dame gestürmt hatten, um überall nach Esmeralda zu suchen. Er selbst hatte die Flüchtende durch einen Geheimgang nach unten geführt. Bald danach war auch sein väterlicher Beschützer, Dom Frollo, weggegangen. Nur Sophie war geblieben. Ernst legte auch er den Finger an die Lippen.
Zwei Wochen danach trat Bruder Thaddäus betreten nach dem Morgenläuten an den Glöckner heran. Nach wie vor nannten ihn alle Quasimodo, bis auf Sophie, die ihm den Namen ihres Vaters gegeben hatte. Thaddäus griff nach dem kleinen Brett und der Kreide, welche auf dem Laufboden mit den Glockenseilen bereit lagen, damit er sich mit dem Schwerhörigen verständigen konnte.
»Der Abt gab mir diese Geldkatze mit dreißig écus darin für deine Dienste und bittet dich, dieses Papier zu unterschreiben und dann spätestens morgen mit deiner Mutter den Turm zu verlassen. Es tut mir sehr leid!«
Er legte die Hand aufs Herz und verneigte sich traurig vor Simon. Dieser las die Notiz auf dem Brett, dann das Pergament, welches auf Latein verfasst war, doch das Wenige verstand er:
»Der Glöckner Quasimodo erhält 30 écus und verlässt
morgen für immer die Kathedrale von Notre-Dame.
Gegeben am 18. Mai im Jahr des Herrn 1487
Pater Bonifatius, Abt des OSB zu Paris«
Fassungslos starrte Simon auf das Schreiben. Ein so großes Blatt mit so wenig Text. Es war das erste Dokument, welches er unterzeichnete. Der junge Ordensbruder Thaddäus überreichte es, nicht einmal einer der Küchenbrüder kam, um sich von ihm zu verabschieden. Womöglich war es ihnen untersagt worden. Vom Laufboden blickte er tief hinab, konnte einige Säulen des westlichen Seitenschiffes erkennen. Meine Notre-Dame, meine Glocken. Ich kann nicht fort!, dachte Simon, den Tränen nahe.
Neben Thaddäus stand eine kleine Kiste, kaum größer als ein Holzscheit. Er öffnete den Deckel und entnahm ein Fass Tinte und eine Feder. Der Deckel diente als Unterlage, welchen der Mönch hielt, während Simon die Feder in die Tinte tauchte und mit »Quasimodo, Simon, der Glöckner von Notre-Dame« unterschrieb. Als er seinen eigenen Namen auf dem Dokument mit den wenigen Worten stehen sah, perlten Tränen über seine Wangen. Thaddäus verschloss das Tintenfass wieder mit dem Holzstöpsel, wischte die Feder mit etwas Spucke und dem Lappen ab, der in der Kiste lag, verschloss die Kiste und nahm dann beide Hände des Glöckners in seine, schloss die Augen und legte seine Stirn darauf. Als er sich wieder aufrichtete, hatte auch er Tränen in den Augen. Auf die Tafel schrieb er:
»Gottes Segen für dich und entbiete bitte deiner Mutter einen Gruß von mir.«
Trotz der Vorfreude auf Chartres fiel es auch Sophie schwer, die Notre-Dame für immer zu verlassen. Vor allem sorgte sie sich um Simon, denn durch Städte und größere Dörfer zu wandern würde ihrem menschenscheuen Sohn sicherlich schwerfallen. All die Gaffer, Kinder, die ihm schreiend und lachend hinterherliefen, verängstigten oder erschreckten ihn bestimmt. Doch nur in Ortschaften oder Städten konnten sie günstige Nahrung kaufen und Quartiere beziehen, also würden sie belebtere Orte nicht gänzlich meiden. Enzo hatte sich bereits seit Tagen reisefertig gemacht. Er kannte die Menschen und das Denken der Geistlichen und wusste, dass der Abt die erste Möglichkeit ergreifen würde, Quasimodo wegzuschicken. Ein Glück nur, dass der Mai fast sommerlich warm war und sie vielleicht so manche Nacht im Freien verbringen konnten. Der Abschied von der ehemaligen Truppe und den anderen im ›Hof der Wunder‹ war herzlich. Man gab den Reisenden Schinken, Brot und einen Weinschlauch mit. Quasimodo wartete einstweilen mit Rosa in Gudules Kammer. Er hätte so viele Leute auf einmal nicht verkraftet. Allein auf der Straße angegafft zu werden ertrug er kaum. Die Klausnerin saß auf ihrer Liege und starrte ihn an. Rosa versuchte ein wenig zu plaudern, gab das Unterfangen aber bald auf. Simon und Gudule wirkten wie ein einziger Bannstrahl, ihre Blicke knisterten fast.
»Das Dämonenkind, welches die süße Agnès gefressen hat«, hauchte die dünne Frau nach unendlich langen Minuten. Er hörte sie nicht, starrte sie nur an. Rosa wusste nicht, dass einst Zigeuner der glücklichen jungen Mutter Paquette Chantefleurie das Töchterchen im Säuglingsalter geraubt hatten und ihr stattdessen den vierjährigen Quasimodo mit seinem Buckel, dem ungewöhnlichen Gesicht und der undeutlichen Sprache hinterließen. Sophie, die vor ihrem gewalttätigen Gatten geflohen war und bei den Zigeunern lebte, hatte man währenddessen betäubt. Sie verlor fast den Verstand, als sie ihren Sohn nirgends finden konnte. Dennoch versorgte sie den geraubten Säugling nach besten Kräften und liebte dieses Kind, die kleine Esmeralda, ebenso wie ihr eignes, doch ihre verzweifelte Suche nach Simon gab sie nicht auf, bis sie ihn fünfzehn Jahre danach in Paris wiedersah. Paquette aber verachtete den Knaben und ging nach Paris, um die Zigeunertruppe mit ihrem Töchterchen zu suchen. Was blieb dem Kleinen anderes übrig, als hinter ihr herzutapsen, hoffend, irgendwann seine Mutter wiederzubekommen, die alle Welt Madame Paloma nannte. Kaum in Paris, verlor Paquette den Knaben in der Notre-Dame, fand aber das Töchterchen nirgends und hoffte auf Gottes Gnade, wenn sie als Einsiedlerin in der Klause beim Rolandsturm am Place de Grève Buße tat. Bald nannte man sie Schwester Gudule. Den Seidenschuh, welchen sie selbst aus lauter Liebe genäht hatte, trug sie stets bei sich. Esmeralda aber trug den zweiten als Talisman, nachdem Sophie ihr die ganze tragische Geschichte vom Kindertausch erzählt hatte.
Nun trafen die beiden wieder aufeinander. Für Paquette war es einerseits ein beklemmendes Wiedersehen, andererseits hatte ihr Geist längst gnädigen Nebel über ihre Gedanken gesenkt. Ab und zu ein heller Moment, den sie aber nicht als solchen erkannte. Sonst aber nahm sie alles wie verschwommen wahr, konnte dadurch die ganze Tragik ihres Daseins leichter ertragen. Auch Quasimodo hatte keine klare Erinnerung mehr an die Frau, die ihn nie mochte und nur geweint hatte, als sie mit ihm nach Paris gewandert war. Er hatte sich ja nicht einmal mehr an Sophie erinnert, nur an Dom Frollo. Dieser war seine ganze Welt gewesen, gemeinsam mit der Kathedrale, den Glocken, den Tauben und später auch mit Jean, den er wie einen kleinen Bruder liebte.
Als Sophie mit Enzo den engen Raum betrat, wusste sie den Blick der beiden sofort zu deuten. In all der Aufregung hatte sie diesen Teil des Schicksals ganz vergessen, dass Paquette nämlich Simon nie so lieben konnte, wie sie ihre verlorene Tochter geliebt hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde bereute sie es, für diese Frau so viel Aufhebens gemacht zu haben. Doch nun wollte sie sich damit nicht aufhalten. Liebevoll verabschiedete sie sich von Rosa, die den écu d’or nicht annehmen wollte, mit dessen Hilfe sie sich weiter um die Klausnerin kümmern sollte.
»So viel wird das doch niemals kosten«, wehrte sie ab. Da erhob sich die dünne Frau, der es inzwischen besser ging, nahm die goldene Münze und den Umhang, den ihr Rosa geschenkt hatte und sagte: »Paquette begleitet die Reisenden.«
Dann stakste sie grußlos aus der Schenke und wartete in der Morgensonne auf die anderen, denen es zunächst die Sprache verschlagen hatte.
»Das kann sie doch nicht machen, dieses dumme Huhn!«, entfuhr es Rosa endlich.
Sophie nickte fassungslos. Quasimodo ging auch nach draußen, in der Kammer war es ihm zu eng und zu stickig. Er stellte sich neben Paquette und begrüßte Enzo, den er lange nicht mehr gesehen hatte. Die Wiedersehensfreude der beiden schob das Problem wegen der sturen Klausnerin zunächst beiseite. Vor der Schenke versammelten sich Leute, um den Buckligen und die Dünne zu bestaunen. Seit dem Verbot jeglicher Darbietungen durch die Inquisition genügte schon ein sonst kaum beachteter Anlass, um Schaulust zu wecken. Als einer der Umstehenden Quasimodo am Buckel berührte, um zu sehen, ob dieser weich oder hart sei, fasste er Paquette am Arm und eilte mit ihr in eine Seitengasse. Erst als niemand mehr in der Nähe war, blieb er stehen und atmete auf. Die Klausnerin war so überrascht, dass sie nicht einmal schreien konnte, bemerkte dann aber, dass der feste Griff um ihr Handgelenk zu ihrem Schutz geschah. Sie rieb sich das Handgelenk und musterte den riesigen Mann mit dem sanften Auge und der Warze über dem anderen. Da kamen schon Enzo und Sophie herbeigelaufen. Sophie schnappte sich das Holz, welches um Simons Hals hing und schrieb mit Kreide:
›Diese Frau kann nicht mitkommen!‹
Er schrieb darunter:
›Doch, sie will ja.‹
»Schwester Gudule, die Reise wird sehr anstrengend und wir können unterwegs keine dünne Suppe für Euch kochen. Ihr habt nicht genug Kraft für so eine weite Wanderung!«, erklärte Sophie genervt.
»Was Paquette will, kann sie auch«, stellte sich die Klausnerin stur und marschierte los. Simon folgte ihr.
»Halt! Es geht in die andere Richtung!«, rief Enzo.
»Wenn die Frau schwach ist, trage ich sie«, sagte Quasimodo, als Sophie ihm nachlief und zur Raison bringen wollte. Auf seine Worte hin blieb sie abrupt stehen.
»Für diese Frau sprichst du sogar?«, rief sie ihm ins Ohr.
Ihr Tonfall klang mehr gereizt als überrascht. Er nickte nur. Schweigend nahmen sie Seitengassen, mieden größere Plätze und Menschen, so gut es ging. Enzo kannte jeden Winkel dieser Stadt und ging mit Quasimodo voran. Die Häuser, schmutzige Rinnsale, Kinder, die Fangen spielten und geschickt Reitern auswichen, Bettler und Aschesammler, alle hatten ihre Beschäftigung. Es verwirrte Quasimodo, so viele Leute um sich zu erleben. Kinder hüpften um ihn herum, warfen zuweilen sogar kleine Steine auf ihn. Alle starrten ihn an. Als er noch am Turm gelebt hatte, waren Leute kleine wuselige Figuren gewesen, weit weg von ihm. Nun bedrängten ihn ihre Blicke, die Nähe und Gerüche. Die Welt war kein Abenteuer, sie umwickelte ihn wie eine Spinne mit ihrem klebrigen Netz.
Hinter ihm ging Sophie und achtete darauf, dass Paquette Schritt halten konnte und sich nicht zu sehr der Sonne aussetzte, weil sie das ermüdete. Seine Mutter war für Quasimodo das neue Zuhause. Am Stadtrand pflückte Enzo wilde Ranken, flocht daraus mit wenigen Handgriffen einen kranzartigen Hut und setzte ihn Paquette aufs Haupt. Sie nickte zufrieden.
Die Nächte waren so mild, dass sie im Freien übernachten konnten. Sophie erinnerte sich an ihre Zeit bei den Zigeunern und empfand Wehmut, vor allem, weil es die Zeit mit Esmeralda gewesen war. Wie es ihr wohl ergeht? Hat sie einem Knaben oder einem Mädchen das Leben geschenkt? Sophies Sehnsucht nach ihr brannte so sehr wie damals der Drang, der die verzweifelte Suche nach Simon befeuert hatte. Dieser strahlte eine wohltuende Ruhe aus, selbst wenn Kinder in Dörfern schreiend um ihn herumtanzten, schaute er sie mittlerweile bloß gutherzig an. Einmal musste er niesen, als Kinder es wieder einmal allzu bunt trieben. Sie erschraken so sehr, dass sie quietschend davonstoben. Simon lachte laut über sie. Daraufhin kamen sie wieder zurück und lächelten, waren plötzlich sanft wie Lämmer und hörten auf, sich über ihn lustig zu machen. Seitdem gönnte er es sich manchmal, aufgescheuchte Kinder mit einem lauten »Buh!« zu erschrecken, wenn sie allzu wild um ihn herumtanzten oder ihn sogar mit kleinen Steinen bewarfen. Und stets ereignete sich dadurch das gleiche kleine Wunder. Der Bann war gebrochen, sobald sie ihn lächeln sahen, allerdings erst, nachdem sie ihren Spaß gehabt hatten.
Wenn er sonst jemanden anlächelte, erschraken die Leute. Er selbst schien sich nichts mehr daraus zu machen. Menschen waren für ihn wie die Tauben, die kackten ja auch herum, ohne es böse zu meinen. Sophie allerdings litt täglich unter diesen Erfahrungen. Sie atmete auf, wenn sie Wälder und Wiesen durchquerten, wo ihnen kaum jemand begegnete. Paquette war auf der Reise ruhiger geworden. Sie brabbelte kaum noch vor sich hin, steckte ihren Schatz in die Kleidertasche und beobachtete still, was um sie herum vorging. Mittlerweile vertrug sie auch festere Nahrung und mochte vor allem mehlige Rüben, wenn Enzo sie abends am Lagerfeuer kochte. Wenn sie bei unterkellerten Gehöften vorbeikamen, kauften sie manchmal ein wenig von dem Wintervorrat, denn sie mieden Schenken und belebte Dörfer. Enzo und Simon trugen die größten Reisesäcke, weil es darin ein wenig Kochgeschirr, Decken für die Nacht und ein gut eingewickeltes Küchenmesser gab.
Jeder Tag der Reise gestaltete sich für Simon wie ein nie gekanntes Abenteuer. Meist hängte er sich die weichen Lederschuhe zusammengebunden um die Schultern und ging barfuß. Das Gras, das Moos, Wurzeln, Morgentau, lehmig-feuchten Boden unter seinen Füßen zu spüren war eine neue sinnliche Wonne für ihn. Gleichzeitig musste er aber nichts von den Freuden aufgeben, die der Turm ihm geboten hatte: den freien Himmel über sich, Wind, Morgensonne und die Dämmerung am Abend. Auf den Heiden und Waldwegen gab es vielerlei Vögel zu bestaunen, nicht nur Tauben. Wenn die Gruppe rastete, legte er sich mit ausgestreckten Armen auf die Wiese, spürte und roch das erfrischende Gras unter sich und kicherte über Ameisen und Käfer, welche in Heerscharen auf ihm herumkrabbelten. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er sie stundenlang am Boden kauernd beobachtet. Während Enzo sehr geschickt Fische aus den Bächen fing, watete Simon in einiger Entfernung in den kühlen Wellen. Seine Welt war nicht nur weiter geworden, sondern vor allem auch bereichert von vielfältigen Vergnügungen.
Als Enzo am Nachmittag des ersten Tages im Bach gestanden war und geschickt nach Fischen geschnappt hatte, wagte sich auch Simon hinein, rutschte aber auf den bemoosten Steinen aus und fiel ins ziemlich kalte Wasser. Nach einem Japser des Schreckens brach er in schallendes Gelächter aus, plantschte und hopste herum und war kaum mehr aus dem Bach zu bekommen. Enzo nahm das zum Anlass, ebenfalls ein Bad zu nehmen. Während anschließend das Gewand in der Sonne trocknete und sie sich in Decken hüllten, nutzte auch Sophie den sanft plätschernden Bach für ein Bad. Nur Paquette saß lediglich am Ufer und benetzte ihre Füße.
»Da!«, rief Simon und zeigte auf eine Libelle, die über dem Wasser tanzte. Gern wäre er ihr nachgeeilt, aber seine Decke sollte nicht auch noch nass werden.
»Ich finde Libellen auch sehr schön. Du wirst noch so viel kennenlernen, Quasimodo!«, rief ihm Enzo ins Ohr. »Ich freue mich, dass du vom Turm heruntergekommen bist, hierher auf die Wiese, hinein in den Bach, in die Wälder, unter Menschen.«
Simon schaute Enzo lange an. Er raffte die Decke um sich und kramte das Schreibbrett hervor. In einer Holzschatulle lagen einige Stücke Kreide.
›Ich freue mich auch‹, schrieb er, ›und ich bin jetzt nur noch Simon. Quasimodo ist am Turm geblieben.‹
Enzo brauchte lang, bis er die Worte entziffert hatte.
»Mein Freund Simon«, rief er endlich. Beide lächelten.
Am Morgen des zweiten Reisetages blieb Simon plötzlich auf einem weiten Brachland stehen, das sie gerade überquerten und schaute zum Himmel empor. Es war noch kühl und nebelig, die ersten Sonnenstrahlen brachten die taubenetzten Halme zum Glitzern. Über ihnen kreisten Tauben, welche sie nicht weiter beachteten, denn es gab derer ja überall. An diesem Tag aber umkreisten sie die Wandergruppe, senkten sich wie Kundschafter herab und segelten dann wieder in die Höhe. Simon ließ seinen Lockruf weithin hörbar erschallen, eine Mischung aus Gurren und Summen. Da kamen sie nacheinander herab, setzten sich auf seine Schultern, ins Gras, auf seinen Kopf. Es waren seine Tauben von der Notre-Dame. Freudentränen verschleierten ihm den Blick, er streichelte die gefiederten Freunde, sprach mit undeutlichen Lauten zu ihnen und suchte fieberhaft nach Krümeln. Miteinander fanden sie einige Brotreste in den Reisebündeln, um dem geflügelten Besuch ein Festmahl zu bereiten.
»Sind wohl Besondere? Also nicht als Braten geeignet?«, fragte Enzo.
»Untersteh dich! Das sind Simons Freundinnen!«, antwortete Sophie entrüstet.
Es war, als hätten die Tauben ihren Freund grüßen wollen, jedenfalls erhoben sie sich bald wieder. Simon winkte ihnen glücklich nach.
»Paquette ist dankbar.«
Ihre kaum vernehmbare, gehauchte Stimme wirkte wie aus einer anderen Welt. Simon hatte die Worte nicht gehört, wandte sich aber zu ihr um, die ihn sanft berührt hatte als sie sprach.
»Paquette ist dankbar für den Glöckner.«
Sophie beobachtete die beiden. Zwischen ihnen herrschte ein besonderer Zauber.
»Es ist gut, dass du mitgekommen bist, Paquette«, sagte Sophie, dann setzten sie ihren Weg fort. Schon am folgenden Tag wollten sie das Gebiet von Chartres erreichen.
Im Palais du Louvre besprach sich unterdessen Anne de Beaujeu mit Bischof Guillaume Briçonnet über bedenkliche Vormachtsansprüche des Duc Louis d’Orléans. Schon ihr Vater, König Ludwig XI., hatte versucht, diesen Strang der Linie Valois zu schwächen und somit die eigene königliche Linie auszuweiten. Da von Duc Raphael aus Chartres keine Ambitionen zu Herrschaftsansprüchen erkennbar wurden, konnte Louis d’Orléans nicht mit dessen Unterstützung rechnen und verlor den Anspruch auf Vormundschaft des damals erst 13-jährigen Königs Karl VIII. Aber auch jetzt noch, vier Jahre danach, musste man auf der Hut sein, obwohl die Generalständeversammlung die Regentschaft für den minderjährigen Sohn Ludwig XI. an Karls Schwester Anne und den königlichen Berater Briçonnet übertragen hatte. Leider war Duc Raphael de Valois in Chartres nicht an einem engeren Zusammenschluss mit Paris interessiert, somit behielt Louis d’Orléans auch ohne dessen Unterstützung ein erhebliches Machtpotential. Der König selbst war froh über den Einsatz seiner um zehn Jahre älteren Schwester, die er erst seit seiner Inthronisation näher kennengelernt hatte. Moderne Kriegsführung und immer besser entwickelte Waffen waren für ihn zwar aufregend, aber die Ränke zwischen Vertretern des Hochadels und deren Verhandlungsmanöver fand er langweilig. Er war der König, die Leute sollten gefälligst tun, was er verlangte, was gab es da also zu verhandeln? Mögen sich doch Anne gemeinsam mit dem überall mitmischenden Briçonnet um derlei Angelegenheiten kümmern.
»Wofür interessiert sich dieser Duc Raphael eigentlich? Wenn er schon nicht Louis d’Orléans unterstützt, könnte er sich doch deutlicher mit dem Herrscherhaus verbünden, damit würden wir Orléans nachhaltig schwächen, schließlich liegt Chartres strategisch günstig, um eine Barriere gegen ihn zu bilden!«, ärgerte sich Anne.
»Soweit ich informiert bin, interessiert sich Duc Raphael für seine junge Gemahlin, seinen engen Berater Baron de Bonarbre und neuerdings für sein überaus lebendiges Töchterchen Claudine. Dass dem Haus noch kein Erbe beschert ist, liegt vielleicht an der etwas zu intensiven Zuwendung des Duc zu seinem Berater«, grinste der Bischof süffisant, der seine Spitzel im ganzen Reich postiert hatte.
»Es gibt immerhin eine Tochter, da wird wohl auch irgendwann ein Erbe zu erwarten sein. Wenn dieser Duc nach Euren Beobachtungen demnach nicht vom Kampfgeist und den Fanfahrenstößen der Macht erfüllt ist, wäre es doch gelacht, ihn nicht auf unsere Seite zu bringen, schließlich ist jeder Valois letztendlich dem Königshaus verpflichtet.«
»Damit habt Ihr recht, Madame, aber bei einem gemächlichen Landesherrn wirkt Einmischung zuweilen eher kontraproduktiv. Um seine Bequemlichkeit zu verteidigen, müsste er sich vielleicht dann doch mit Orléans verbünden. Geschickter wäre es, Duc Raphaels Interesse möglichst unmerklich in Richtung Königstreue zu lenken. Auf meiner Suche nach Unterstützung des jungen Regenten erinnerte ich mich eines Benediktiners, der größtes Vertrauen unseres seligen Königs genoss.«
Anne de Beaujeu lachte gequält auf und schnaubte: »Mein Vater vertraute niemandem! Seine Stärke war es eher, aller Welt zu misstrauen, sogar seiner eigenen Familie. Am liebsten hätte er auch den Dauphin bekämpft, aus Furcht, er könnte ihm die Krone streitig machen.«
»Ich weiß, verehrte Madame de Beaujeu! Umso bedeutungsvoller ist die Tatsache, dass König Ludwig XI. jenen Geistlichen, der überdies auch politischen Einfluss in Paris innehatte, regelmäßig zu Gesprächen in die Bastille holte.«
»Ja, die Bastille! Wie ein kleiner Soldat verschanzte er sich dort und ließ die Königin und uns Kinder im Palais du Louvre überwachen, als seien wir verdächtige Übeltäter.«
Allein die Erwähnung ihres Vaters ließ unkontrollierbare Bitterkeit in Anne de Beaujeu hochsteigen.
»Nur die Ruhe, Madame! Jetzt ist Euer Bruder König, ein verspielter Jüngling, auch mit seinen siebzehn Jahren. Ihr habt die Zügel in der Hand und mit meinen Erfahrungen und vielfältigen Informationen wird bald ganz Frankreich in Eure Richtung streben.«
»Was schlagt Ihr also vor?«
»Wie ich in Erfahrung bringen konnte, lebt jener Geistliche, Dom Frollo de Molendino, seit nunmehr fünf Jahren als Einsiedler in der Bretagne, nahe Concarneau.«
»Ihr scherzt! Ein Mann von solchem Einfluss lebt als Klausner?«
»Nein, ich scherze nicht. Es gibt zuweilen Mönche, die tatsächlich so etwas wie innere Einkehr suchen. Vielleicht ist es bei Dom Frollo de Molendino so, vielleicht aber hat er sich einfach etwas zuschulden kommen lassen und musste Hals über Kopf Paris verlassen. Doch das spielt für uns keine Rolle. Soviel ich weiß, lebt sein verkrüppelter Schützling noch als Glöckner in der Notre-Dame, womöglich kann der uns Auskunft geben.«
»Ich bin beeindruckt, Eure Exzellenz, Ihr verfügt über ein umfassendes Wissen!«
»Alles eine Frage guter Beobachter in allen Schichten und Häusern«, antwortete der Bischof geschmeichelt.
»Abgesehen von der Befragung jenes Glöckners sollten wir Abt Bonifatius von den Benediktinern bitten, Dom Frollo de Molendino unter irgendeinem Vorwand nach Chartres zu beordern, wo er Einfluss auf Duc Raphael nehmen soll«, ergänzte er noch.
Sogleich wurden zwei Geistliche Bischof Briçonnets in die Notre-Dame geschickt, um den Glöckner nach seinem Vormund zu befragen. Da dieser wenige Tage zuvor urkundlich beglaubigt entlassen worden war, wandten sich die beiden an Abt Bonifatius. Dieser verwies auf seinen Mitbruder und Stadtvogt, Pater Gregoire. Er sei für dergleichen verantwortlich. Insgeheim ärgerte sich der Abt aber maßlos über den Fauxpas, Quasimodo entlassen zu haben, denn natürlich war ihm ein gutes Einvernehmen mit dem Königshaus sehr wichtig. Umso bestimmender fiel die Anordnung an Dom Frollo de Molendiono aus, sich umgehend nach Chartres zu begeben, die dortigen Pfarrgeschäfte zu übernehmen und regen Kontakt mit dem Hause de Valois, allen voran mit dem Duc, zu pflegen. Der im augenblicklichen Dienst befindliche Benediktiner, Pater Polycarp, wurde über den Amtswechsel informiert und in die Pfarrei nach Orléans entsandt. Zu beiden wollte Bischof Briçonnet beizeiten Geistliche mit näheren Anweisungen schicken.
»Da!«, hauchte Sophie fast tonlos. Alle blickten in Richtung ihrer ausgestreckten Hand. Aus der Ferne sahen sie das Anwesen der ehemals einflussreichen Grafschaft de Mortain. Es stand auf einer Anhöhe, die weitläufigen Parkanlagen, aber auch Teile der Gebäude waren von alten Bäumen verdeckt. Strahlender Sonnenschein, sanfte Briese. Wie ein Traumbild lag die Landschaft vor Sophie. Einige Felder erstreckten sich zwischen ihnen und dem Anwesen. Jenseits des Hügels lag das Dorf Mortain des Prés. Sophie hatte gedacht, all das längst hinter sich gelassen zu haben, denn nur im Jetzt konnte sie ihre laufenden Pflichten bewältigen. Hätte sie den unnennbaren Schmerz ihres Schicksals ständig vor Augen behalten, wäre sie daran zerbrochen. Nun aber überwältigte sie der Anblick ihrer Heimat und die Erinnerungen an eine Kindheit voller Glück. Ihr Vater, Comte Simon de Mortain, war der gütigste und klügste Mensch gewesen, den nicht nur sie geliebt hatte. Mit ihrer Mutter Adèle und der etwas jüngeren Schwester Elisabeth war jeder einzelne Tag reine Freude, jeder Moment eine Bereicherung gewesen. Doch dann, wie ein nächtliches Gewitter, waren Schergen der Inquisition in ihr Heim eingedrungen und hatten ihren Vater mit sich genommen. Nur wenige Tage später war er auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ein ähnliches Schicksal drohte seiner Familie, doch ein guter Freund hatte die drei verzweifelten Frauen in Sicherheit gebracht. Kurz vor dieser Tragödie war Sophie fünfzehn geworden.
Friedlich stand das Anwesen da, die Bäume, die verschiedenen Gebäude, Stallungen, auch die Koppel konnte man erkennen. Alle spürten das Feierliche dieses Augenblicks. Seit der übereilten Flucht vor der Inquisition war sie nie wieder in dieser Gegend gewesen. Sie, die mit Zigeunern durch ganz Frankreich und Spanien gekommen war, hatte die Gegend rund um Chartres nie mehr beschritten. Aus unterschiedlichen Gründen mied ihre Zigeunertruppe dieses Gebiet. Nach langen Momenten der Überwältigung setzte sie sich ins Gras, konnte den Blick nicht von ihrem Elternhaus wenden.
»Wer jetzt wohl darin lebt?«, fragte sie ins Leere hinein. Auch die anderen hatten sich zu ihr gesetzt. Sie hatten gewusst, dass sie an Sophies Heimat vorbeikommen würden, ab und zu hatte sie es angedeutet.
»Es lässt sich bestimmt erfragen, wer jetzt dort wohnt«, zeigte sich Enzo wie immer zuversichtlich. In die Freude, ihre ehemalige Heimat wiederzusehen, mischte sich für Sophie Grauen. Nur wenige Tage nach der Flucht war sie mit einem Trunkenbold vermählt worden, dem Marquis Alfons de Sanslieu. Auch ihre Schwester hatte man mit der Kutsche abgeholt, um sie einem Witwer mit mehreren Kindern zu vermählen. Noch immer wusste Sophie nicht, was aus ihr später geworden war, auch das Schicksal der Mutter blieb im Dunkeln, denn ihr Gemahl hatte keinerlei Kontakte gestattet und sie vom ersten Augenblick ihrer Ehe an gequält. Oft hatte Sophie in ihrer Verzweiflung gedacht, dass der Tod wohl ein besseres Los gewesen wäre als die vermeintliche Sicherheit als Gattin eines so grausamen Mannes. Dann wurde Simon geboren, ein noch schutzbedürftigeres Wesen als sie selbst. Er weckte ihre Liebe und damit auch den Lebenswillen. Ihn zu schützen galt ihr ganzes Streben.
Und mit dieser Erinnerung erschien eine Person vor ihrem geistigen Auge, ein Mann mit ebenso sanftem wie entschlossenem Blick. Sie hörte noch den Klang seiner Stimme, sah seine grünen Augen vor sich. Aufgeregt ging er vor ihrer Liege auf und ab, grübelte, wie er ihr und ihrem Neugeborenen wohl helfen konnte, denn er wusste so gut wie sie: Alfons de Sanslieu würde den missgestalteten Knaben töten, vielleicht sogar auch seine Mutter. Und so kam es, dass ihr verstoßener Schwager, der Raubritter Daniel de Sanslieu, sie zu einer ihm befreundeten Zigeunertruppe brachte, der sie als La Paloma angehörte; vier fröhliche Jahre lang, vier sichere Jahre. Warum nur hatte der Anführer José dann ihren Simon entführt und ihr, die betäubt darniederlag, ein fremdes Kind an die Seite gelegt? So lieb sie das kleine Mädchen auch hatte, so unheilbar blieben auch der Schmerz und die Sorge um ihren Sohn. Als müsste sie fürchten, ihn wieder zu verlieren, griff sie nach Simons Hand, drückte sie und schaute ihn liebevoll an. Für sie war er immer Simon geblieben. Er lächelte.
»Maman!«, sagte er nur. Lange saßen sie schon auf der Wiese. Nicht einmal Paquette wagte es, die feierliche Stimmung zu stören. Eine Wolke schob sich vor die Sonne, Wind kam auf und wirbelte ihnen den Staub des Weges ins Gesicht.
»Setzen wir uns ein weinig weiter vorne zum Waldrand und schauen nach, was wir noch zum Essen in den Reisetüchern finden«, schlug Enzo vor. Sophie nickte. Noch einmal drückte sie Simons Hand. Man ließ sich am Waldrand nieder und überblickte, was es in den Reisetüchern gab. Enzo hatte noch ein Stück Brot und etwas Salz, Paquette begann zarte Löwenzahnblätter auf der Wiese zu sammeln und in Sophies Tuch fand sich ein weiteres Stück Brot und eine dicke Scheibe Käse vom Einkauf auf einem Bauernhof. Im Wald roch es überall nach Bärlauch, der allerdings bereits ziemlich ausgewachsen war, doch sie fanden noch einige genießbare Blätter. Bis sich Sophie von ihren Erinnerungen lösen konnte, war alles für ein erfrischendes Mahl vorbereitet. Sie aßen schweigend und tranken Wasser vom nahen Bach.
»Du bist der Enkel des Comte Simon de Mortain! Er war der beste Mensch, den man sich vorstellen kann!«, rief sie Simon ins Ohr und zeigte auf das Gelände und das prächtige Schloss in der Ferne, umringt von uralten Bäumen.
»Ich bin der Glöckner und dein Sohn«, versuchte er sie aufzumuntern, denn ihre Worte verstand er nicht, spürte aber, dass sie etwas Trauriges bedeuteten.
»Wir könnten im nächsten Dorf fragen, wer jetzt dort wohnt«, schlug Enzo vor. Sophie hatte Bedenken. Sie fühlte sich noch immer auf der Flucht und fürchtete, als ehemalige Gattin des Marquis de Sanslieu enttarnt zu werden, obwohl ihr gleichzeitig klar war, dass nach über neunzehn Jahren niemand mehr nach ihr suchen würde. Enzo konnte ihre Gedanken erraten und grinste.
»Glaubt mir, Madame Paloma, ich als ehemaliges Straßenkind weiß, wie man unbemerkt an Informationen gelangt.«
»Außerdem haben wir unterwegs noch kaum einen Sou ausgegeben. Wir könnten in einer Schenke essen und mit etwas Glück einen Schlafplatz bekommen, dabei erfahren wir bestimmt einiges über diese Grafschaft und ihre jetzigen Herren«, ergänzte Sophie lächelnd.
Mit dem Anblick ihres Elternhauses war der jugendliche Entdeckergeist wiedererwacht. Paquette zog stumm den écu d’or aus ihrer Gewandtasche und reichte ihn Sophie. Das wirkte unerwartet und grotesk, auch waren sie von der Reise bereits etwas erschöpft, jedenfalls brachen alle in schallendes Gelächter aus.
Der Gedanke, eine warme Mahlzeit serviert zu bekommen, war wunderbar. Doch sollte dies für die Gruppe ein erster Besuch in einer Schenke sein. Enzo kannte die rauen Sitten an solchen Stätten nur zu gut, hatte er doch als Straßenkind hinter einer der berüchtigsten Spelunken in Paris meist übernachtet. Die Schenke an der viel genutzten Kreuzung zwischen den Ländereien von Versailles und dem großen Bistum von Chartres wirkte heruntergekommen wie das Dorf selbst, Beauceville. Davor versammelten sich Weiber beim Brunnen. Das einzig Auffällige an diesem Ort mit den breiten Wegen in alle Himmelsrichtungen war ein Patrizierhaus mit riesigem Park und eigenem Brunnen unweit der Schenke.
Erst gegen Abend betrat Enzo erhobenen Hauptes und mit straffen Schultern die Gaststube. Dahinter erschien mit dem Selbstbewusstsein einer Herrscherin Sophie, Simon neben sich. Für ihn trat sie auf, als habe sie nie etwas anderes getan als geherrscht. Paquette trippelte hinterdrein und schaute sich irritiert um, als alles verstummte und auf die neuen Gäste starrte. Die kräftige Wirtin mit der Statur und dem Gehabe eines Mannes nickte zur Begrüßung und erwartete von Enzo die Bestellung. Dieses wortlose Selbstverständnis verstand er als Vertrauensvorschuss. Mit klarer Stimme sagte er: »Wir wollen speisen und zumindest eine Nacht beherbergt werden.«
»Im Schlafraum gibt es Matratzen, frisches Stroh daneben im Schuppen. Zurzeit nutzen das nur drei Knechte von Händlern, die aber morgen früh weiterziehen, also seid Ihr fast ganz unter Euch. Ein halber Sol pro Nacht für jeden von Euch. Zu essen gibt es Eintopf mit Brot, zu trinken Mischwein, auch verdünnt, wenn Ihr es wünscht. Bier habe ich nur rund um Weihnachten herum.«
Enzo blickte kurz zu Sophie, diese nickte.
»Wir nehmen einen Krug Wein und einen mit frischem Wasser gleich mit in den Schlafraum. Bringt uns die Becher und den Eintopf. Zahlen wollen wir dafür sofort.«
Sophie legte zehn Sol auf den Tresen. Auch die kleinste Geste wurde von den Männern in der Gaststube beobachtet. Niemand rührte sich.
»Das reicht für zwei Nächte und vier Mahlzeiten«, stellte die Wirtin fest und blickte dabei Sophie an, welche offenbar das Geld verwaltete.
»Danke«, antwortete Sophie mit souveränem Lächeln, sie war zufrieden. Innerhalb einer Stunde hatte die Neuigkeit im Dorf die Runde gemacht, ein schneidiger Bursche, eine Dame, ein schweigsamer Entstellter und eine Knochenfrau hatten sich in Betunias Schenke einquartiert. Kinder lugten durch die kleinen Fenster und tuschelten aufgeregt, wenn sie einen der Gäste zu Gesicht bekamen. Weiber versammelten sich scharenweise beim Brunnen und ließen den Eingang nicht aus den Augen. Wann immer einer aus der Schenke wankte, wurde er gleich mit Fragen überhäuft.
»Der Bucklige scheint taub zu sein und die schöne Madame kümmert sich ganz besonders um ihn. Der Jüngling ist leutselig, er hat uns erzählt, dass sie aus Paris kämen und sich in Chartres niederlassen wollten. Geld genug scheinen sie zu haben. Also ich würde mir mindestens zwei Knechte nehmen, wenn ich als Weib mit so viel Geld unterwegs bin. Gleich bei der Ankunft hat sie zehn Sol auf den Tresen gelegt, einfach so«, erzählte ein Knecht.
Enzo hatte sich bald schon mit mehreren Leuten aus Beauceville bekannt gemacht, vor allem auch die Wirtin Betunia besser kennengelernt, die längst nicht so rau und unnahbar war, wie sie sich gern gab.
»Das Anwesen dort oben, es ist ein prächtiges Schloss mit Ländereien. Wer residiert dort? Ist es ein milder Herrscher?«, fragte er sie einmal wie nebenbei.
»So war es vor vielen Jahren, mein Vater erzählte uns Kindern davon. Das Anwesen gehörte damals dem Comte de Mortain. Seine Gemahlin und die beiden Töchter waren immer freundlich und verstanden es, den Jahreszins herabzusetzen, wenn Trockenheit oder Hagel die Ernte vernichtet hatten. Soweit ich mich an die Erzählungen meines Vaters erinnere, führte die Geschäfte Madame Adèle de Mortain. Der Comte selbst reiste viel und wusste alles über die ganze Welt.«
Enzo verlangte nach einem weiteren Becher Apfelwein, um das Gespräch nicht abbrechen zu lassen. In der Schenke gab es ein Kommen und Gehen von Bauern, die ihre Ernte gerade gut eingebracht hatten, oder von wandernden Gesellen, fahrenden Händlern oder Tagelöhnern, die ihre wenigen Sous gern mit anderen bei einem kräftigen Eintopf und reichlich Wein in der Schenke ausgaben.
»Hör mal, Hübscher, kennst du eigentlich meine Tochter Fatou schon?«, wechselte Betunia das Thema.
Er schüttelte irritiert den Kopf.
»Sie ist ein liebreizendes Kind. Dass sie nicht spricht, ist für manch wackeren Recken ein reiner Segen. Weiber neigen zu Geschwätzigkeit.«
Mit demselben Tonfall hatte die Wirtin tags zuvor den Hühnereintopf feilgeboten. Enzo wurde es etwas mulmig, tapfer forschte er aber weiter.
»Wohnt das Geschlecht de Mortain denn nicht mehr dort drüben auf den grünen Hügeln?«
»Nein, leider nicht. Der Comte wurde als Ketzer verbrannt, doch ich sage dir …«
Sie neigte sich so nah an ihn heran, dass er ihren Atem riechen konnte.
»Nie und nimmer war dieser Mensch ein Ketzer oder gar ein Hexer! Ah! Da ist ja meine liebreizende Fatou!«
Das Mädchen kam mit zwei Mägden von den Weinstöcken. Den Korb mit geschnittenen Reben und Unkraut stellten sie vor die offene Hintertür der Schenke. Enzo konnte nicht glauben, dass dieses zarte Geschöpf die Tochter der Wirtin sein sollte. Mit verlegen gesenktem Blick kam sie auf den Ruf der Mutter näher.
»Fatou! Schau, hier ist ein Bräutigam für dich. Willst du nicht endlich den Mund aufmachen und ihn begrüßen?«
Enzo schluckte und wandte sich um, wen Betunia wohl gemeint haben konnte. Keiner der zahlreichen, vorwiegend älteren Männer in der Gaststube reagierte oder beachtete Fatou. Das Mädchen war zwar zauberhaft, zart mit schwarzen Augen und seidig dunklem Haar, doch Enzo hatte sie bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht zu Gesicht bekommen. Also konnte die Wirtin doch unmöglich ihn meinen, wenn sie von einem Bräutigam sprach.
»Das ist Enzo, ein Gast aus Paris«, stellte Betunia ihn vor und beobachtete mit unverhohlenem Interesse, wie die beiden aufeinander reagierten. Enzo errötete, das Mädchen eilte wortlos in die Küche.
»Ist noch ein wenig schüchtern«, meinte die Wirtin und sah auf Enzo herab, der kleiner war als sie. Auf seinen irritierten Blick lachte sie schallend mit ihrer tiefen Stimme, dass es durch den ganzen Schankraum hallte.
»Wer … wer wohnt denn jetzt auf dem Anwesen des Comte de Mortain?«, fragte er rasch, bevor der Alten noch ein Scherz bezüglich ihrer Tochter einfiel.
»Darf ich offen zu dir sprechen, Jungchen?«
Enzo nickte. Wieder beugte sie sich zu ihm vor.
»Der Großneffe, oder was für ein Verwandter auch immer, eines gewissen Guillaume Briçonnet, wollte das Anwesen seit jeher haben, einfach so, weil der Comte de Mortain ihm einmal in aller Öffentlichkeit an den Kopf geworfen hatte, er sei ein verzogener Bengel. Nicht Ketzerei brachte den Comte auf den Scheiterhaufen, sondern der kirchliche Einfluss, sobald sich Briçonnet mit den hohen Würdenträgern verbündet hatte. Man munkelt sogar, dieser Großneffe sei der Bastard des damaligen Kardinals von Paris. Ihn hier zu platzieren bot Briçonnet Gelegenheit, allen Zusammenkünften in Chartres beizuwohnen, oder zumindest eine Menge darüber zu erfahren, schließlich liegt die Bildungsstätte keine Tagesreise von hier entfernt. Mittlerweile ist Briçonnet sogar Berater in königlichen Kreisen. Bei seinem Ehrgeiz schafft der es womöglich auch noch zum Kardinal.«
»Ihr habt ein umfangreiches Wissen, verehrte Betunia!«, sagte Enzo ehrlich beeindruckt. Wieder lachte sie laut auf.
»Wir einfachen Leute sind nicht immer so einfältig, wie die Obrigkeit es sich wünscht. Wo Stallknechte, Laufburschen, Hufschmiede und Küchengehilfen verkehren, sprießt das Geschwätz. Wer es versteht, richtig hinzuhören, erfährt am meisten«, bekannte sie stolz und fügte hinzu: »Wissen bedeutet für eine Schenke oft mehr als Wein und Schinken.«
»Heißt der Neffe auch Briçonnet?«, kam Enzo wieder auf seine Frage zurück.
»Nein, er ist ein einfältiger Bursche, der ohne den Rückhalt seiner einflussreichen Verwandtschaft nicht überleben könnte und zu dumm ist, um die Würde seiner Gemahlin zu erkennen. Das arme Mädchen wurde ihm mit zarten 14 Jahren vermählt und darbt seitdem mit traurigen Kindern und dem gewalttätigen Gatten auf dem Schloss. Man sollte die Arme aus seinen Klauen befreien. Da sagt man immer, die Reichen hätten es besser, dabei leben sie oft wie Gefangene in einem Kerker. Am schlimmsten ergeht es meist den Weibern.«
Betunia, ereiferte sich so sehr, dass sie es noch immer nicht schaffte, Enzo den Namen zu nennen. Beide schwiegen. Jemand rief nach mehr Wein. Die Wirtin bediente, klopfte einem Vorwitzigen hart auf die Finger, als er ihr an den Hintern fassen wollte, sammelte Tonkrüge von anderen Gästen ein, zählte hinterlegte Münzen nach und kam wieder an den Tresen. Dort wartete Enzo.
»Was wolltest du von mir wissen? Da war doch noch was …«
»Wie der Herr am Anwesen de Mortain heißt.«
»Ach ja, der! Marquis Jacques de Cercueilclou heißt der Schwachkopf von Adeligem.«
Herzhaft spuckte Betunia auf den Boden. Sie sprach Enzo ganz aus der Seele, doch seine Gewandtheit im Umgang mit Menschen sprudelte nicht so, wie er es gewohnt war. Fatous Erscheinen und Davoneilen hatten ihn irritiert. Um Betunias Meinung aber zu bekräftigen, wollte auch er herzhaft auf den Boden spucken. Doch nur ein dünner Speichelfaden lief ihm übers Kinn. Verlegen wischte er sich mit dem Handrücken darüber.
»Wie recht Ihr habt, Betunia«, sagte er. Als Antwort bekam er wieder ein fröhlich schallendes Lachen.
»Du bist mir ja einer, Jungchen! Und wie gut du zu meiner Fatou passen würdest, ehrlich!«
Gerade wandte er sich ab, um zu den anderen in den Schlafraum zurückzukehren, blieb dann aber wie angewurzelt stehen. Er musste sagen, was ihm gerade durch den Kopf ging.
»Wisst Ihr, Eure Tochter ist schön wie der Abendstern, scheint tüchtig zu arbeiten und wirkt zart auf mich, zerbrechlich. Warum preist Ihr sie wie einen Humpen Wein an?«
Sie blickte mit ungewohnt traurigen Augen in Richtung Tür.
»Ich spüre, dass genau du derjenige sein könntest, der ihre Zunge wieder lockert«, sagte sie.
Mit diesen Worten wirkte die Wirtin gar nicht mehr so klobig.
»Ich muss meine Gefährten noch an ihr Ziel geleiten. Doch auf der Rückreise werde ich gerne wieder bei Euch einkehren«, antwortete er. Die Wirtin nickte. Später erzählte Enzo, was er über Marquis Jacques de Cercueilclou in Erfahrung gebracht hatte. Auf Sophie wirkte die Schilderung wie ein Schlag. Sie litt bei dem Gedanken, dass in ihrem Elternhaus ein so grausamer Herrscher lebte, wie es ihr Gatte Alfons de Sanslieu gewesen war.
Im Schlafraum, der eher einem ausgeräumten Stall glich, gab es in der zweiten Nacht keine weiteren Gäste. Sophie lag müde, aber mit aufgerissenen Augen auf ihrer Matratze. Seit sie ihr Elternhaus wiedergesehen hatte, war alles wieder da; die Panik, als Schergen ihren Vater gewaltsam mit sich schleiften, die Verlorenheit, als sie Hals über Kopf ihr Heim verlassen mussten. Überstürzte Entscheidungen wurden getroffen und mitten in der Schockstarre und Trauer die Vermählung mit Alfons de Sanslieu. Allein bei der Erinnerung seines Namens überfielen sie Angst und Schmerz wie Furien. Das Herz raste und sie glaubte, ersticken zu müssen an all den Bildern, die nun auf sie einströmten. Wie eine Herrin war sie in der Schenke aufgetreten und wie eine Dirne von ihrem Gemahl behandelt worden, gedemütigt, geschlagen und geschändet, wieder und wieder. Längst hatte Sophie diesen Albtraum als überwunden geglaubt, doch er hatte nur geschlummert und war jetzt wieder erwacht. Hinauslaufen, frische Luft schnappen, ein wenig herumgehen, das hätte geholfen. Doch das Dorf war ihr fremd, sie konnte nicht mitten in der Nacht als Dame allein draußen herumirren. Zwar hatte die Wirtin auch den letzten Betrunkenen bereits Stunden zuvor nach Hause geschickt, aber womöglich torkelten beim Brunnen noch welche herum. Vertrauenerweckend war Beauceville nicht.
Simon auf der Matratze neben ihr drehte sich auf die andere Seite. Sein entspannter tiefer Atem beruhigte Sophie etwas. Sie streckte die Hand aus und legte sie auf seinen Oberarm. Erst danach fand sie etwas Schlaf. Träumend hielt sie ihn als Neugeborenen im Arm, blickte in seine vertrauend staunenden Augen, bemerkte zwar die große Warze über dem linken, fand aber alles an ihm wunderbar.
Vor den dünnen Holzwänden des Schlafraumes begann der Tag. Knechte versorgten die Tiere, Mägde hatten Öfen anzuheizen, damit der Morgenbrei gekocht werden konnte. Der quietschende Karren des Mistmannes wurde vorbeigezogen. Noch bevor sich Händler oder andere Reisende auf den Weg machten, wurden die Wege von Pferdeäpfeln und Hinterlassenschaften anderer Tiere bis hin zu den Zweibeinern gesäubert und dieses Gut dann als Dünger verkauft.
Diese Geräusche holten Sophie immer mehr aus dem Schlaf. Und plötzlich sah sie ihn vor sich, Daniel de Sanslieu, Alfons’ verstoßenen jüngeren Bruder, seine wärmenden grünen Augen, die vollen Lippen, seine Überlegungen, wie er ihr helfen könnte. Alles war zurückgekehrt. Ihr Herz raste. Eine unbekannte Freude durchrieselte sie. Konnte es sein, dass sie diesen Mann liebte, den sie nur wenige Augenblicke sehen durfte? Oder fühlte sie nur Dankbarkeit für ihn? Wo in ihrem Herzen hatte er sich in all den Jahren versteckt? Jetzt wusste sie, dass Daniel de Sanslieu in ihr beheimatet war, und zwar schon die ganze Zeit. Noch einmal schloss sie die Augen und hörte seine Stimme, so klar, als hätte sie gerade noch mit ihm gesprochen. Sie schmunzelte über die unerwarteten Gefühle, die sie überfielen. Wo war er jetzt? Ging es ihm gut? Hatte er inzwischen eine glückliche Familie oder lebte er noch im Kampf gegen Unterdrückung und für Gerechtigkeit? Und Alfons, der Bruder, an den sie nur mit Schaudern denken konnte, hatte er sich endlich zu Tode gesoffen, oder quälte dieser Satan noch immer wehrlose Weiber?
Erstaunt stellte Sophie fest, dass die gedankliche Nähe Daniels alle Angst vor ihrem einstigen Gatten vertrieb. Noch nie hatte sie sich danach gesehnt, von einem Mann in die Arme genommen zu werden. Es hatte einfach keine Zeit dafür gegeben, auch keinen Mann, mit dem sie es sich gewünscht hätte. Nun aber ergriff sie eine Leidenschaft, die ihr fast den Atem raubte. Wie brennender Durst rührte sich Verlangen in ihr. Etwas taumelnd erhob sie sich. Im Morgengrauen durfte sie sich als Frau allein hinauswagen, durfte frei durchatmen. Das arbeitende Volk draußen vermittelte Sicherheit. Sie musste hinaus, suchte Bewegung und den weiten Himmel über sich, um nicht in den lodernden Gedanken zu verbrennen. In zartem Licht erstrahlte die Landschaft. Alle Wege lagen im Nebel, hinter den Häusern wallte es weiß über den Feldern. Jeder Schritt erfrischte sie mehr, das zarte rosa Band am Himmel schien ihr zuzulächeln. Furcht löste sich wie Nebel in der Sonne auf, Sehnsucht beflügelte sie.