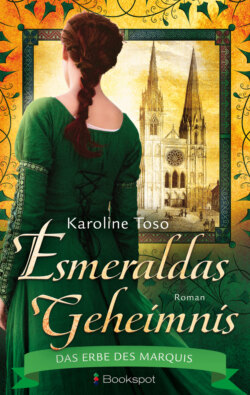Читать книгу Esmeraldas Geheimnis - Karoline Toso - Страница 8
Kapitel 3
ОглавлениеU
ngewohnt aufgewühlt eilte Madame Veronique de Valois in den kleinen Empfangssaal und begutachtete persönlich, was alles vorbereitet worden war. Duc Raphael wunderte sich über die Aufregung seiner Mutter, denn ein paar Honoratioren aus Chartres, ein langjähriger Freund aus Valencia und ein Marquis, welcher seine Burg verkaufen wollte, bedeuteten keinen großen Empfang. Er fragte sich auch, wo Julien de Bonarbre blieb, der sonst gewissenhaft und pünktlich war.
»Ist denn Eure Gemahlin auch bereit für die Gäste? Hat sie den Schmuck Eurer Vermählung angelegt und die Perlen besetzte Ehehaube? Hat die Zofe Anweisung, auf keinen Fall die Prinzessin wie einen Wirbelwind durch die Räume fegen zu lassen? Bei aller Liebe, aber die Familie Jardinverde ist äußerst gebildet und verkehrt gewöhnlich in höchsten Kreisen. Ich möchte, dass sich diese Leute gerne hier ansiedeln. Mit etwas Glück folgen weitere Händler, die aus Chartres einen reichen Umschlagplatz für Waren aus dem Orient machen könnten. Ruben Jardinverde ist eigens für die Begutachtung der Burg und für Verhandlungen angereist und heute unser Ehrengast.«
»Die Universität samt der Druckerei scheinen mir für Chartres wichtiger zu sein als der Handel mit fast unerschwinglichen Stoffen«, erwiderte Raphael.
»Ihr macht Euch keine Gedanken darüber, woher unser Reichtum stammt, der allerdings in den letzten Jahren zunehmend schrumpft. Eure Milde kleinen Bauern und den Zünften gegenüber wird noch unser Ruin sein. Wenn es so weitergeht, müssen wir dringend eine reiche Vermählung Eurer Tochter in die Wege leiten.«
»Madame! Ihr beliebt zu scherzen!«
»Wacht auf, Raphael! Das Leben ist nichts weiter als ein guter Handel. Sorgt für eine gediegene, christliche Ausbildung Claudines. Ich habe die Kleine wahrlich in mein Herz geschlossen, das könnt Ihr mir glauben. Sie zaubert jedem, der ihr begegnet, ein Lächeln ins Gesicht, jedoch ist ihr Benehmen in höchstem Maße unziemlich. Sie sollte bald schon einem Kloster anvertraut werden.«
Der Gedanke, das aufgeweckte Töchterchen strenger Ordensobhut zu überlassen, erschütterte Raphael. So schwer es ihm auch fiel, seiner Mutter zu widersprechen, erwiderte er mit klarer Deutlichkeit: »Meine Tochter wird täglich von einer strengen Nonne unterrichtet. Claudine beherrscht bereits das Lesen und sogar ein wenig das Schreiben. Als ihr Vater habe ich den Wunsch, mich täglich ihrer Gegenwart zu erfreuen, Madame. Jede weitere Überlegung bezüglich ihrer Ausbildung obliegt mir und meiner Gemahlin, denn ich bin es müde, dies ständig mit Euch zu erörtern, bei allem gebührenden Respekt!«
Madame Veronique war wie vor den Kopf gestoßen. Sie musste sich etwas sammeln, doch als hätten die Worte des Vaters das Kind herbeigelockt, hörte man sein helles Rufen auf den weitläufigen Gängen: »Ich muss meinen Gott begrüßen. Schwester Maria Pilar kann mir ihre langweiligen Erklärungen ja auch bei der Linde erzählen!«
»Aber Mademoiselle! Ich bitte Euch! Zieht wenigstens Schuhe an!«
Das war Anouks Stimme. Raphael schmunzelte, doch Madame Veronique schüttelte den Kopf.
»Seht Ihr? Das meine ich.«
»Unsere Claudine betet eben gerne im Freien, in Gottes Schöpfung, dagegen ist doch nichts einzuwenden.«
»Und bei der heiligen Messe kann sie keinen Augenblick ruhig sitzen. Nein, nein, je früher das Kind eine ordentliche christliche Erziehung erhält, desto besser!«
Lächelnd lehnte Julien de Bonarbre am hinteren Tor des Schlosses, durch das man auf die Wiese und zur großen Linde gelangte. Er hatte so eine Ahnung, Claudine an diesem Morgen hier anzutreffen. Schon sauste sie an ihm vorbei. Anouk wunderte sich, den Baron hier zu treffen, und grüßte mit einem tiefen Knicks. Er nickte freundlich. Das Kind wandte sich um. Erst jetzt registrierte auch sie den Baron.
»Komm!«, rief es und winkte ihn heran. Er näherte sich und legte wie Claudine und Anouk seine Hände auf den Stamm der Linde. Als Claudine die Augen schloss, war ihm, als zwitscherten die Vögel noch vielfältiger, als duftete die Linde noch süßer. Tief atmete er ein und seufzend wieder aus.
»Nicht wahr, Baron de Bonarbre? Das ist ein schöner Morgengruß.«
»Ja, mein Kind, wirklich schön. Schade, dass ich nicht länger bleiben kann, aber dir und Anouk wünsche ich noch viel Freude hier.«
»Wir müssen auch hinauf in den Unterricht«, antwortete Anouk.
Glücklich über diese Begegnung ging er in den kleinen Empfangssaal. Eine geraume Weile später betrat auch Madame Agnès den Saal.
»Guten Morgen, Madame!«, sie knickste tief und senkte das Haupt vor ihrer Schwiegermutter.
»Guten Morgen, meine Liebe.«
Kurz zuvor hatte sich die junge Duchesse im Studierraum von Claudine verabschiedet, weil der Empfang wohl den ganzen restlichen Tag in Anspruch nehmen würde. Das Morgenmahl zu dritt im eigenen Gemach einzunehmen hatte allerdings Spaß gemacht. Anouk, Claudine und Agnès hockten rund um ein Tuch am Boden, tranken warme Milch und aßen Brot, während Dienerinnen emsig den Zuber im Nebenraum mit heißem Wasser füllten. Die junge Duchesse mit Tochter und Zofe am Boden sitzen zu sehen erstaunte sie.
»Wir spielen Zigeuner, die essen auch auf dem Boden«, erklärte ihnen die Prinzessin.
»Aber Mademoiselle, woher wollt Ihr denn wissen, wie Zigeuner essen?«, fragte Anouk. Die Mägde im Nebenraum kicherten verhalten.
»Maman hat es mir erzählt«, sagte Claudine ungerührt. Anouk errötete.
»Nur keine Sorge, das Kind sagt die Wahrheit. Ich habe es von den Nonnen im Kloster erfahren«, erklärte die Duchesse.
»Und die wussten darüber Bescheid?«
»Warum nicht, sie waren schließlich nicht immer Nonnen.«
Doch bald wurde es Zeit, Madame Agnès auf den Empfang vorzubereiten. Allein das Bad im Zuber, die Frisur und das prächtige Gewand nahmen fast drei Stunden in Anspruch. Drei Dienerinnen bemühten sich um den feierlichen Auftritt der Duchesse, die sich mit der kostbaren Ehehaube, dem Seidenschleier und den Brokatgewändern unbeweglich und beladen fühlte.
»Ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Herz. Schade, dass wir uns erst am Abend wiedersehen«, sagte sie, als sie während des Unterrichts nach Claudine sah. Die Nonne erstarrte über diese unerwartete Unterbrechung.
»Du schaust schön aus, Maman, aber fremd«, fand Claudine.
»So fühle ich mich auch in dem Gewand«, lachte Agnès fröhlich.
Der kleine Empfangssaal war prächtig geschmückt. Bei geöffneten Fenstern strahlte die Vormittagssonne golden auf die selten ausgelegten Teppiche. Blumen leuchteten bunt in kostbaren Vasen auf dem großen Tisch und den Anrichten. Schwere Sessel standen reihum. Kristallkaraffen und Gläser, dazu kleine Käsestücke, Olivenbrot, Trockenfrüchte und Nüsse auf zart bemalten Tellern luden ein, sich zu bedienen, wobei edel livrierte Diener diskret einschenken würden, wann auch immer jemand nach einem Glas griff. Was diesen Raum besonders auszeichnete, waren kunstvolle Schnitzereien an der Decke, den Holzverkleidungen und den Fensterrahmen. Ahornblatt- und Blumenornamente rankten sich ineinander, an den Fenstern zudem schillernde Perlmutteinlegearbeiten; Schwäne, Schmetterlinge und kleine Singvögel.
Madame Veronique, der Duc und Baron de Bonarbre warteten bereits, als die junge Duchesse etwas verspätet erschien. Diener standen wie Statuen neben den Anrichten. Schon wollte Madame Veronique wegen der Verspätung zu einer Bemerkung ansetzen, doch bald würden die Gäste eintreffen. Es war Madame Agnès zuzutrauen, dieser wichtigen Gesellschaft in letzter Sekunde fernzubleiben, würde sie sich jetzt aufregen. Bereits den Unterricht durch eine Dominikanerin durchzusetzen war ein harter Kampf gewesen. Erstaunlich, wie dominant dieses zierliche Geschöpf sein konnte und wie milde sich der Duc an ihrer Seite gab.
Madame Agnès knickste vor ihrer Schwiegermutter, nickte de Bonarbre und de Bouget grüßend zu und küsste ihren Gemahl vertraut auf die Lippen. Wie so oft verschlug es Madame Veronique dabei kurz den Atem. Sie konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass ihre Schwiegertochter absichtlich dermaßen ungeniert agierte. Anscheinend legte sie es darauf an, alle Welt zu brüskieren.
Plötzlich schwang die Tür auf. Claudine hing am Türgriff, weil sie ihn nur durch einen Sprung erreichte.
»Die Bibel ist für heute fertig. Wollt ihr mit zur Linde kommen?«, rief sie und blickte an der Tür schaukelnd alle Anwesenden an.
»Nachdem die Gäste noch nicht eingetroffen sind …«, freute sich Agnès, nun doch mit ihrer Tochter ein wenig auf die Wiese gehen zu können.
»Als gäbe es im Augenblick keine anderen Pflichten«, ärgerte sich Madame Veronique.
Agnès blickte ihren Gemahl fragend an.
»Kommt bitte bald zurück, Madame, und grüßt mir die Linde«, lächelte Raphael. Claudine war längst vorausgelaufen. Anouk wagte gar nicht erst hereinzublicken, denn es war ihr wieder einmal nicht gelungen, das Kind fernzuhalten. Etwas sehnsüchtig blickte Julien in Richtung Tür.
Mit ausgestreckten Armen drückte sich das Kind an den Baum. Wange und Ohr an die raue Rinde gepresst, schien es mit geschlossenen Augen zu lauschen.
»Komm und höre, was Gott mir zu sagen hat«, flüsterte es, ohne die Augen zu öffnen, als sich Anouk näherte. Sie umarmte die Linde neben ihrem Schützling. So verharrten sie eine Weile.
»Dauert es noch lange?«, wollte Anouk endlich wissen.
»Pst!«
Es blieb der Zofe nichts anderes übrig, als dem prächtigen Konzert der Vögel zu lauschen, den frischen Morgenwind zu spüren, das warme Holz und den betörenden Duft der Linde, die in diesem Jahr besonders früh blühte. Als sich jemand neben ihr ebenfalls an den mächtigen Stamm lehnte, öffnete Anouk die Augen. Es war Madame Agnès in prächtiger Robe und edlem Geschmeide. Lächelnd lauschten die drei, bis Claudine meinte, Gott habe ihr Freude für den ganzen Tag geschenkt. Dann umarmte das Kind seine Mutter.
»Du duftest fast so gut wie die Linde«, meinte es. Agnès lachte laut auf.
»Verbring einen wunderschönen Tag, vielleicht sogar bei den Hühnern«, antwortete sie und küsste ihre Tochter auf die Stirn.
»Was für ein besonderer Tag, heute grüßen wir die Linde bereits zum zweiten Mal. Vor dem Unterricht mit Baron de Bonarbre und jetzt mit Euch«, wunderte sich Anouk.
»Ihr wart mit de Bonarbe so früh da draußen?« Anouk nickte. Nachdenklich ging Agnès wieder hinauf.
Monsieur Ruben Jardinverde war bereits anwesend und erhob sich, als Agnès den Empfangssaal aufs Neue betrat. Er verneigte sich tief.
»¡Bienvenido, Señor Jardinverde! Me alegro poder saludaros aquí!«
»¡El honor es de mi parte, Madame!«
»¡Levantense por favor!«
Lächelnd richtete sich Monsieur Jardinverde auf und blickte die junge Duchesse vertrauensvoll an. Seine Augen wirkten sanft, ein wenig schwermütig, goldbraun und mandelförmig. Er war nur um wenig größer als sie und somit bedeutend kleiner als der Duc, dennoch ging von ihm eine Autorität aus, die bezwang. Doch sie erdrückte nicht. Vielmehr hatte Agnès das Gefühl, als würde sie sich diesem Mann jederzeit anvertrauen können. Irgendwie kam er ihr bekannt vor. Ihr war, als seien sie einander bereits früher einmal begegnet. Sein Gewand war kunstvoll bestickt, edle Stoffe in elegantem, aber dezentem Schnitt. Auch die Farben und der Faltenwurf seines Mantels zeugten von Reichtum und Geschmack, ohne dabei eine Etikette zu verletzen, die nur der Aristokratie vorbehalten war, wie etwa goldene Schnallen, diamantbesetzte Knöpfe oder ein Siegelring. Was er ausstrahlte war Freiheit und Selbstbestimmung. Agnès beneidete ihn fast ein wenig darum.
Bald darauf betrat Marquis Daniel de Sanslieu, begleitet vom Stadtvogt, Baron de Claireleau den Saal. Gemeinsam hatten sie zuvor im Palast de Claireleau über den möglichen Verkauf seiner geerbten Burg diskutiert. Der Pfarrherr, Pater Polycarp von den Benediktinern, wirkte bedrückt, als er gemeinsam mit dem greisen Bischof Milon d’Illiers kurze Zeit später Duc Raphael, dessen Gemahlin und Mutter begrüßte. Zunächst unterhielt man sich ungezwungen. Der Beginn konkreter Verhandlungen sollte später folgen und danach ein feierliches Bankett. Agnès sprach vorwiegend mit Monsieur Jardinverde, den sie von der ersten Sekunde an ins Herz geschlossen hatte. Außerdem freute es sie, nach so langer Zeit wieder Spanisch sprechen zu können. Die Erinnerung an ihre Kindheit in Spanien tat ihr gut. Dort waren sie und ihre Madre mit der Zigeunertruppe durchs Land gezogen, hatte ihr Siegeszug als La Esmeralda begonnen, die die Herzen der Menschen auf allen Marktplätzen im Sturm erobert hatte.
Madame Veronique war froh darüber, ihre Schwiegertochter und Monsieur Jardinverde eine gute Konversation führen zu sehen, denn sie konnte sich nicht ausreichend um ihren langjährigen Freund aus Valencia kümmern, Bischof d’Illier suchte nämlich das Gespräch mit ihr. Als ehemals enger Vertrauter König Ludwigs XI. war er eher gegen die Ansiedlung jüdischer Familien in Chartres. Seit der Inthronisation Karls VIII. geriet er aber politisch von dessen Vormund zunehmend unter Druck und wollte sich die Gunst und Unterstützung der Duchesse sichern.
Alle waren in mehr oder weniger bedeutende Gespräche verwickelt, nur Duc Raphael und Marquis Daniel de Sanslieu starrten Löcher in die Luft. Beide galten als zurückhaltend, wobei der Maquis erst seit wenigen Jahren wieder auf seiner elterlichen Burg residierte und zuvor nicht auffindbar gewesen war. Der wesentlich ältere Bruder, Alfons de Sanslieu, hatte sich nach dem Tod des Vaters mit ihm überworfen und ihn kurzerhand der Burg verwiesen. Die Skandale um Alfons wurden legendär und waren für ganz Chartres eine Schande. Sein Umgang mit den vier Gemahlinnen mochte zwar grausam gewesen sein, war aber Familienangelegenheit, niemand wollte sich da einmischen, auch der Pfarrherr zu Chartres nicht. Dass aber so manch anders denkende Lehensherr früher oder später auf verdächtige Weise ums Leben gekommen war, erzeugte bald eine geschlossene Gegnerschaft, die dem Despoten bei einem seiner vielen Saufgelage zum Verhängnis wurde. Vor mehr als 20 Zeugen hatte Alfons de Sanslieu einen seiner Gäste beim Streit mit dem Messer angegriffen, dieser war zur Seite gewichen, wobei der Maquis mit der Stirn gegen den Rost seines Kamins gestoßen und wenige Stunden darauf an den Folgen der Verletzung verstorben war.
»Seit Jahrhunderten gilt Eure Burg als Wahrzeichen der Stärke und als Sinnbild Eurer langen Ahnenreihe. Warum wollt Ihr sie denn verkaufen?«, fiel Duc Raphael endlich eine dem Anlass relevante Frage ein.
»Ich fühle mich dort nicht wohl«, entgegnete der Marquis knapp.
Wieder vergingen mehrere Minuten gemeinsamen Schweigens. De Sanslieu betrachtete die geschnitzte Decke, der Duc beobachtete seine Gemahlin, wie gewandt sie jederzeit mit jedem ins Gespräch kam. Sie an seiner Seite zu wissen vermittelte ihm ein Gefühl der Geborgenheit, mit ihr zu regieren verlieh ihm Stärke.
»Kennt Ihr Monsieur Jardinverde schon länger?«, wollte der Duc eigentlich nicht wissen, sondern einfach nur irgendwie die Einsilbigkeit überbrücken.
»Ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Es war Madame Veronique, die mich angesprochen hatte, ob ich denn auch an einen jüdischen Händler verkaufen wolle, denn dass ich die Burg loswerden möchte, ist allseits bekannt.«
Duc Raphael räusperte sich. An ihm war diese große Entscheidung vorübergegangen. Wieder einmal bestätigte sich der Vorwurf seiner Mutter, dass ihn nämlich Angelegenheiten seines Wirkungskreises zu wenig interessierten.
»Es macht Euch also nichts aus, an einen Juden zu verkaufen?«, fragte er.
»Warum sollte es?«
»So sehen wir das auch«, fand der Duc, »bleibt zu hoffen, dass uns die hohe Geistlichkeit nicht in die Quere kommt, indem sie der Ansiedlung von Juden ablehnend gegenübersteht.«
»Madame Veronique scheint sich mit seiner Eminenz d’Illiers ganz gut auszutauschen«, schmunzelte de Sanslieu, denn die beiden älteren Herrschaften prosteten einander während ihres Gesprächs eifrig zu. Wieder erlahmte das Gespräch. Duc Raphael erhob sich und deutete eine kleine Verbeugung vor dem Marquis an: »Ich werde mich des Pater Polycarp ein wenig annehmen. Er wirkt recht niedergeschlagen.«
Erleichtert ging er zu dem Pfarrherrn, der am Fenster stand und von Baron de Bonarbre getröstet wurde. Neben seinem Freund Julien fühlte sich der Duc sofort lockerer, außerdem gab es hier nichts weiter zu tun als zuzuhören.
»Seit über zehn Jahren bin ich Pfarrherr zu Chartres und diene dem Herrn und meinen mir anvertrauten Seelen nach bestem Wissen und Gewissen. Und nun soll ich innerhalb des nächsten Mondumlaufs die Pfarre in Orléans übernehmen, um Platz für einen einsiedlerischen Mitbruder aus der Bretagne zu machen. Das verstehe, wer will. Gehorsam schön und gut, aber was soll dieser Klausner in einer so großen Pfarrgemeinde? Und warum entscheidet mein Abt in Paris über Angelegenheiten, die er gar nicht kennt?«, jammerte Pater Polycarp.
»Es fällt mir auch immer schwer, wenn ich vertraute Menschen meines Umfelds verliere und mich an neue gewöhnen muss. Ihr werdet uns fehlen, Pater Polycarp«, gestand Duc Raphael ehrlich.
»Wie ich Euch kenne, mon père, werdet Ihr mit Eurer einfühlsamen Seelsorge in Orléans bestimmt bald gute Kontakte knüpfen und die Gemeinde von Eurem Wohlwollen überzeugen«, sagte Baron de Bonarbre. Die Worte der beiden vermittelten dem Benediktiner etwas Zuversicht. Madame Veronique gab ihrem Sohn unbemerkte Zeichen, dass einer der Gäste ohne Unterhaltung war. Sie deutete mit dem Kopf in Richtung des Marquis de Sanslieu, der entspannt im Sessel lehnte und an die Decke starrte. Als er die kunstvollen Einlegearbeiten an den Fensterrahmen entdeckte, stand er auf, um auch diese zu betrachten. Notgedrungen stellte sich der Duc wieder zu ihm und überlegte erneut, wie er ein Gespräch in Gang bringen könnte. Sie standen abseits der anderen, schauten ihnen bei ihren Gesprächen zu, lächelten, als Madame Agnès mit Monsieur Jardinverde laut auflachte, offenbar hatten diese beiden ausreichend Gesprächsstoff gefunden. Endlich fiel Raphael wieder eine Frage ein,
»Und? Madame de Sanslieu samt Nachkommenschaft sind wohlauf?«
Der Marquis lächelte amüsiert.
»Bemüht Euch nicht, Mon Seigneur. Es macht mir nichts aus, dieser freundlichen Gesellschaft schweigend anzugehören, im Gegenteil. Und auf Eure Frage; ich hatte in meinem Leben immer viel zu erledigen, darum blieb mir die Freude, eine so liebreizende Gefährtin zu finden, wie Ihr sie an Eurer Seite wisst, leider verwehrt, denn mit weniger als wahrer Liebe hätte ich mich nicht zufriedengegeben, dazu ist mir meine Freiheit zu wichtig.«
»So lebt Ihr also abstinent wie ein Mönch?«
Der Duc wunderte sich selbst über die Dreistigkeit seiner Frage, aber der Marquis strahlte Lebenserfahrung und Güte aus, das musste ihn verleitet haben. Dieser lachte herzlich und schüttelte den Kopf.
»Oh! Von ›Mönch‹ keine Spur, wenn ich so frei sein darf, mich offen zu äußern.«
»Ich bitte darum!«
»Ich darf dankbar auf verschiedene schöne Begegnungen zurückblicken, auch auf Freundschaften mit wunderbaren Frauen. Und es kümmerte mich nie, ob diese von adeliger Herkunft stammten oder nicht. Aber eine Eheschließung kam aus verschiedenen Gründen nicht infrage.«
Raphaels Blick war eine einzige Frage. Wieder lächelte sein Gesprächspartner mit der Selbstsicherheit des weltoffenen Mannes.
»Nun ja, wenn die geliebte Freundin bereits in einer erzwungenen Ehe gefangen ist, bleibt einem nur die Freude an möglichst vielen schönen, aber heimlichen Begegnungen.«
Seine Schwägerin mit dem Neugeborenen im Arm fiel ihm ein und es kam ihm der Gedanke, als sei sie die Frau gewesen, an die er sich hätte binden wollen, wenn es denn möglich gewesen wäre. Er lächelte bei dieser Erinnerung, musste aber auch über sich selbst schmunzeln, da er nach all den Jahren noch immer an das Mädchen mit dem Säugling dachte. Sie hatte ihn verzaubert. Raphael indessen verschlug es ob so direkter Ehrlichkeit die Sprache, was Daniel sofort bemerkte.
»Verzeiht, Mon Seigneur, aber man sagt sich, Ihr seid einer der tolerantesten Herrscher des Landes und kein Vertreter enger kirchlicher Moral. Natürlich würde ich bestimmten Herrschaften hier nicht so offen begegnen, wie ich mir Euch gegenüber die Freiheit genommen habe.«
Bei diesen Worten verneigte sich der Marquis leicht und ließ seinen Blick für einen winzigen Augenblick zu Baron de Bonarbre wandern. Raphael fühlte sich vollkommen durchschaut und gleichzeitig zutiefst in seiner Art des Empfindens angenommen. Dieser Marquis de Sanslieu hatte eine ähnlich verständnisvolle, bejahende Art, Menschen zu begegnen, wie seine Gemahlin Agnès.
»Ich danke Euch für Euer Vertrauen, Marquis, und hoffe, wir werden künftig noch oft Gelegenheit finden, uns auszutauschen.«
»Das würde mich freuen, Mon Seigneur! Allerdings weiß ich noch nicht, wo ich mich selbst ansiedeln werde, wenn ich das Anwesen an die Familie Jardinverde verkaufe.«
»Aber die Lehen solltet Ihr doch weiter verwalten, Marquis. Soweit ich unterrichtet bin, gedeihen Eure Gemeinden und Eure Vasallen dienen Euch gern. Die Familie aus Valencia wird keine Lehen bekommen und sich um hörige Bauern und deren Ernteabgaben kaum kümmern wollen, schließlich hat sie mit dem Handel genug zu tun. Es geht ihr nur um die prächtige Burg mit dem Park davor.«
»Eure Worte ermutigen mich, ich danke Euch, Mon Seigneur. Tatsächlich würde ich die Gegend ungern verlassen, obwohl ich so viele Jahre heimatlos war, aber, wie gesagt, frei. Ich strebe nicht danach, einen Palast zu bewohnen, aber einen Landsitz nahe Chartres, das wäre doch fein. Die Lehen kann ich auch von einem kleineren Besitz aus verwalten.«
»Besitz belastet, meint meine Gemahlin oft. Manchmal denke ich, sie könne auch in einem überdachten Karren leben, wenn sie nur täglich genug Sonne und Wind abbekäme.«
»Ihr seid zu beglückwünschen, eine Gefährtin wie Madame Agnès an der Seite zu haben.«
Mit bejahendem Lächeln nickte Raphael seinem Gesprächspartner zu.
Dann war der Zeitpunkt gekommen, anstehende Angelegenheiten geordnet durchzugehen. Man nahm rund um den großen Tisch Platz. Duc Raphael de Valois leitete die Besprechung mit der Aufforderung ein, Allgemeines gleich mitzuteilen, um sich anschließend nur dem Verkauf der Burg de Sanslieu zu widmen. Zunächst meldete Pater Polycarp den baldigen Wechsel in der Pfarrverwaltung zu Chartres. Außer Bischof d’Illiers hörte kaum jemand aufmerksam zu, weil die Kirche ohnehin meist unabhängig agierte. Danach kam wie so oft das leidige Thema der Forstverwaltung zur Sprache. Es ging dabei nicht nur um Jagdrechte, sondern auch darum, ob Förster ihren untergebenen Bauern Fällungen für Bauvorhaben erlauben durften. Das größte Anliegen, nämlich der Verkauf einer Burg an einen nicht adeligen und nicht einmal christlichen Käufer, wurde nur kurz umrissen, um am folgenden Tag konkrete Entscheidungen treffen zu können. Jeder Anwesende möge sich Gedanken darüber machen. So dauerte das Treffen bis zum späten Nachmittag, wo man nach dem festlichen Bankett ein wenig in den Parkanlagen lustwandelte. Weiter entfernt konnte man die Stallungen ausmachen, auch einige kleinere Gesindebauten mit Gärten und Gehegen für Kleintiere. Kinder liefen dort herum. Die Prinzessin war eines von ihnen. Man erkannte sie bloß an der Kleidung und Anouks Begleitung.
»Hoffentlich sieht meine Mutter nicht, dass unsere Tochter schon wieder mit den Kindern des Gesindes spielt«, raunte Raphael seiner Gemahlin zu.
Daniel de Sanslieu schmunzelte, als er das hörte, und beobachtete die Prinzessin, die sich gerade hinter einem Strauch versteckte. Der junge Schreiber Jean de Bouget, welcher die wichtigsten Punkte der Verhandlungen notierte, lächelte ebenfalls beim Anblick der spielenden Kinder. Auch Baron de Bonarbre versuchte unbemerkt zu beobachten, was die Prinzessin machte. Claudine wusste, dass sie nicht zu ihren Eltern laufen durfte, während diese mit den Gästen sprachen, und winkte nur von ferne. Bis auf Bischof d’Illiers und Madame Veronique winkten alle zurück.
»Unser Jüngster, Naftali, ist auch so ein fröhliches, wenn auch zuweilen wildes Kind. Mit seinen sechs Jahren hält er die älteren Geschwister ganz schön auf Trab«, erzählte Monsieur Jardinverde lächelnd.
»Darf ich fragen, wie viele Kinder Euch geschenkt sind?«, wollte Daniel de Sanslieu wissen. Er fühlte sich ungewohnt angezogen von dem Gedanken an Familienglück.
»Wir danken unserem Schöpfer für vier prächtige Kinder«, antwortete Ruben. Wieder erschien das Bild eines kaum sechzehnjährigen Mädchens vor Daniels Augen. Ihre Verzweiflung und gleichzeitig das Vertrauen in ihn, den sie gerade erst kennenglernt hatte, rührten ihn noch immer. Und dann diese unerschütterliche Liebe zu ihrem Neugeborenen, der missgestaltet war. Wie konnte ihn die Erinnerung daran nach wie vor mit Wärme erfüllen? Was wohl aus Mutter und Kind geworden war?
Als der Einsiedler Claude Frollo das Schreiben seines Abts aus Paris überreicht bekam, dachte er an eine Strafmaßnahme. Wenn man wollte, konnte man jedem irgendein Vergehen unterstellen, das hatte er bei unzähligen Hexenprozessen in seiner früheren Position als Archidiakon erfahren. In seinem Fall aber waren Unterstellungen nicht einmal nötig, denn seine Vergehen waren vielfältig, angefangen von verbotenen Schriften und alchimistischen Versuchen bis hin zur Schändung der schönen Esmeralda, die er sich selbst nie würde verzeihen können. Dann gab es da auch noch Gedichte mit ketzerischem Inhalt, deren Kopien er anonym an Universitäten und Bibliotheken gesendet hatte. Ob dieser selbstzerstörerische Drang von den Schuldgefühlen kam, die er als Archidiakon auf sich geladen hatte? Hier in der Einsiedelei fand er Frieden, dass er aber für seine Vergehen nie zur Rechenschaft gezogen worden war, nagte an ihm. In seinem Fatalismus hatte er stets darauf gewartet, fand es nun aber doch bedauernswert, gefasst zu werden. Die Bretagne mit den ehrlichen wortkargen Fischern hatte er lieb gewonnen. Hier ließ er sich vom ständigen Lied der Wellen einlullen, sprach selbst wenig und wurde gerade deswegen von den Bretonen gut geduldet.
»Bruder im Herrn,
seit nunmehr fünf Jahren leistet Ihr als Einsiedler in der Bretagne einen bescheidenen Dienst. Eure reiche Erfahrung als Archidiakon in Josas zu Paris und Eure überragende Bildung, die Ihr dem Kloster des heiligen Benedikt verdankt, verlangen es, Euch an anderer Stelle einzusetzen, um für das Reich Gottes hier auf Erden wirksam zu sein. Ihr werdet Euch unverzüglich auf den Weg zum Anwesen des Marquis Jacques de Cercueilclou nahe Chartres begeben. Der Marquis ist ein naher Verwandter des Bischofs Guillaume Briçonnet, Vormund unseres Königs Karl VIII. Der Bischof persönlich wird Euch dort Anweisungen für Eure Aufgaben als künftiger Pfarrherr zu Chartres geben.
Gott zum Gruße,
Abt Bonifatius OSB
Gegeben im Jahr des Herrn, Mai 1487«
Mehr als überrascht starrte er auf das Schreiben. Dass es nicht um seine unvernünftig in Umlauf gebrachten Gedichte ging, beruhigte ihn, aber die Einsiedelei wollte er nicht verlassen. In seiner Erinnerung hatte das Laute einer großen Stadt etwas Zerstörerisches; lauernde Missgunst an allen Ecken, mögliche Demütigung bei allen Begegnungen. Chartres! Was für ein Getümmel an Vielfältigkeit! Als Universitätsstadt bestimmt genauso laut und voller Tücken wie Paris. Warum sollte ausgerechnet er diese Pfarrei übernehmen? Hatte nicht sein Mitbruder Polycarp dort seit über zehn Jahren gewirkt? Und dann Bischof d’Illiers, dieser alte Kriecher vor König Ludwig XI. Wie erleichtert war er gewesen, als er all die Ränke und den ständigen gefährlichen Eiertanz zwischen Krone und Kirche hinter sich gelassen und die Einsiedelei aufgesucht hatte. Wer herrschte eigentlich in Chartres? Ein Duc aus königlichem Hause, ein Valois. Er wollte mit all diesen Machtmanövern und heiklen Konversationen nichts mehr zu tun haben. Wie viel mehr wog für ihn das wortkarge Mahl in der Hütte eines Fischers, als eine festliche Tafel am Hofe eines Ducs oder Marquis! Der Weisung des Abts konnte er sich zwar nicht entziehen, aber er überlegte, die Berufung als Benediktiner aufzugeben und danach als Weltgeistlicher wieder in die Bretagne zu ziehen. Ein tägliches Mahl und ein Dach über dem Kopf, was brauchte er mehr? Mit müdem Lächeln erinnerte er sich seiner elterlichen Ländereien in Montereau und seines Anwesens in Le Mains. Dorthin könnte er sich jederzeit zurückziehen und den kirchlichen Dienst gänzlich aufgeben. Doch Claude Frollo fühlte sich zu schwach, auch nur irgendeinen Besitz zu verwalten. Er wollte in seiner Einsiedelei bleiben, in dieser Holzhütte am Meer. Nach nichts anderem verlangte es ihn. Und dennoch, schweren Herzens verabschiedete er sich von den Leuten seines Fischerdorfes und machte sich zu Fuß auf den Weg Richtung Chartres, denn was immer er plante, sein Abt müsste es absegnen, sonst würde er Verfolgung riskieren, die dem ersehnten Frieden noch empfindlicher schaden würde als eine Versetzung nach Chartres.
»Nennt mir das Geheimnis des dreieinigen Gottes und sprecht anschließend das Credo mit mir. Ich habe mir für Euch die Mühe gemacht, es auf dieses Blatt Papier zu schreiben, damit Ihr es zunächst lesen, in den nächsten Tagen aber auswendig lernen könnt, Mademoiselle Claudine de Valois.«
Schwester Maria Pilar nutzte die mehrtägige Abwesenheit der Duchesse, welche wegen der Verhandlungen unabkömmlich war, um endlich dem Mädchen echten christlichen Unterricht erteilen zu können. Zwar saß die Zofe wie eine Aufsichtsperson auf einem Sessel an der Wand des geräumigen Studierraumes, aber sie hatte keinerlei Befugnis, in den Unterricht einzugreifen.
»Der dreieinige Gott ist wunderschön und sehr stark. Er spricht zu jeder Tageszeit mit mir. Am Morgen singt er, zu Mittag spendet er Schatten und am Abend seufzt er und wünscht, ich möge gut schlafen. Dann ist es kühl bei ihm und wenn ich später unter Mamans Decke kriechen kann, dann ist es kuschelig und schön.«
Das Kind strahlte die verdutzte Nonne mit vertrauensvollen Augen an. Man hätte meinen können, es mache sich über die Dominikanerin und ihre Aufforderungen lustig, aber ein Mädchen von knapp fünf Jahren konnte nicht so strategisch vorgehen, das wusste auch die gewohnt strenge Ordensfrau.
»Wovon sprecht Ihr, Mademoiselle?«, fragte sie ungeduldig.
»Von meinem Gott, den ich sehr lieb habe und er mich auch. Er hat eine mächtige wunderschöne Krone auf und er hat einen starken Leib, aber das Beste an meinem Gott ist das Verborgene, seine Wurzeln, die ihn unschlagbar machen und ihn mit uns hier auf der Erde verbinden, obwohl seine Vogelnester hoch oben, fast im Himmel, versteckt sind.«
Anouk bemühte sich, möglichst nicht hörbar zu lachen.
»Wovon sprecht Ihr?«
Mittlerweile verlor die Nonne fast jegliche Contenance und hätte dem Kind gern ins Gesicht geschlagen.
»Ich spreche von meinem Gott.«
»Mir war, als wolltet Ihr einen Baum beschreiben. Das wäre Ketzerei gewesen, Mademoiselle, und ich hätte es beim Bischof gemeldet, damit Ihr es wisst!«
»Meine Linde ist ein Baum und trotzdem wohnt Gott in ihr. Du behauptest ja auch immer, dass Gott in dem kleinen staubigen Kästchen in der Kirche wohnt und in einem dünnen Brot, das alle in den Mund geschoben bekommen. Davon habe ich noch nie etwas gespürt, aber bei meiner Linde spüre ich, dass Gott da ist.«
Schwester Maria Pilar, die vor Claudine stand und auf sie hinabblickte, tastete aufseufzend nach einem Stuhl. Nachdem sie sich gesetzt hatte, bekreuzigte sie sich.
»Ich werde es melden. Ich werde meiner Mutter Äbtissin melden, welch ein Ungeist in diesem Hause wohnt, und dass sogar schon ein kleines Kind blasphemische Worte ungeniert ausspricht. Ich werde es melden, denn das ist Sünde!«, stammelte sie vor sich hin.
Claudine beobachtete sie interessiert, Anouk fühlte sich auf ihrem Sessel an der Wand unbehaglich. Was die Nonne vor sich hin murmelte, klang bedrohlich.
»Komm mit, Schwester Maria Pilar. Du sollst den Gott, der bei uns hinterm Schloss ist, kennenlernen. Das tut dir bestimmt gut. Und dann kannst du melden, dass Gott hier bei uns wohnt.«
Sie nahm die Nonne an der Hand, die sich fassungslos von dem Kind auf die Wiese hinter dem Schloss führen ließ. Anouk folgte den beiden. Mit jedem Schritt wurde ihr banger zumute. Sie hatte schon davon gehört, dass die Kirche mitunter sogar Kinder wegen Ketzerei einsperrte. Ob das auch für ein adeliges Kind galt? Knapp vor der Linde blieb Claudine stehen, breitete die Arme aus und blickte zur Baumkrone empor. Danach legte sie sich auf die saftig grüne Wiese.
»Schwester Maria Pilar! Riechst du den wunderbaren Duft? Du darfst den Gott umarmen, dann freust du dich und kannst wieder lachen.«
Die Nonne starrte auf den Baum. Sie konnte keinen Finger rühren, kein Wort mehr sprechen, denn nun war sie davon überzeugt, dass der Teufel aus dem Kind spräche und sich über die Kirche und auch über sie persönlich lustig mache. Wortlos wandte sie sich um und verließ die Wiese. Da sie sich aber nicht ohne Erlaubnis der Äbtissin von der Stätte ihres Wirkens entfernen durfte, eilte sie in die Schlosskapelle und betete ohne Unterlass den Rosenkranz, den der Ordensgründer Dominikus von der Jungfrau Maria persönlich ins Herz gelegt bekommen hatte. Sobald die Schwester gegangen war, eilte Anouk zu Claudine.
»Kind, was fällt Euch ein? Ihr wisst doch, dass Schwester Maria Pilar solche Reden nicht verträgt. Hoffentlich schimpft Madame Veronique nachher nicht wieder mit Eurer Mutter, weil Ihr so ungezogen wart!«
»Ich bin nicht ungezogen, sondern ehrlich. Alle sagen immer, ich darf niemals lügen. Und wenn ich ehrlich bin, will die Schwester es nicht hören. Da kann man ja nur die grand-mère ärgern! Es geht gar nicht anders!«
Es war der zweite Verhandlungstag rund um das Anwesen de Sanslieu. Diesmal ging es um das Ausmaß der Parkanlagen, um das Gesinde und seine Entlohnung. Das Hauptanliegen dieses Tages aber war grundsätzlich, ob man eine Burg aus altem Adelsgeschlecht an eine jüdische Familie verkaufen könne. Schon beim Erwerb einfacher Gebäude an Juden durfte das Herzogtum mit jährlichen Abgaben für das Recht der Ansiedlung rechnen. Eine Burg aber war zu bedeutend, um es bei schlichten Abgaben bewenden zu lassen. Allerdings war sie der einzige Bau gewünschter Größe, der in Chartres zum Verkauf stand. Es verhandelten der Duc, die Mesdames Veronique und Agnès, Marquis de Sanslieu, Stadtvogt de Claireleau und Monsieur Ruben Jardinverde. Als Berater stand dem Duc der Baron de Bonarbre zur Seite, Schreiber war Jean de Bouget. Daniel de Sanslieu interessierte sich nicht wirklich für den Preis, er fand die jährliche Summe, welche der jüdischen Familie auferlegt wurde, nur um durch ihren Handel dem Herzogtum mehr Reichtum zu bescheren, ungerecht. Um seinen Unmut etwas zu kaschieren, schaute er aus dem geöffneten Fenster und beobachtete ein erstaunliches Vorkommnis. Die kleine Prinzessin führte eine ältliche Nonne zur Linde hinter dem Schloss. In einiger Entfernung folgte die junge Zofe. Dann breitete das Kind wie zum Gebet die Arme aus, blickte in die Baumkrone und ließ sich nach einiger Zeit ins Gras fallen. Die stocksteife Nonne daneben eilte schließlich davon. Was für ein erstaunliches Kind, dachte er und schmunzelte.
»Marquis, eine Königstruhe écus d’or für Euer Anwesen und jährlich 3000 écus d’or für das Herzogtum, was sagt ihr zu diesem Vorschlag?«, holte Duc Raphael ihn aus seinen Gedanken.
Die Königstruhe wog gefüllt zehn Quintal. Eine unvorstellbare hohe Summe, denn der Marquis sollte ja dennoch alle Lehen behalten.
»Dies ist wirklich ein großzügiges Angebot. Doch verzeiht mir, denn ich muss es ablehnen. Schließlich bin ich ein Ehrenmann«, sagte er mit ernster Miene und blickte alle Anwesenden der Reihe nach an. Der Marquis hatte von befreundeten Zigeunern erfahren, dass Juden in Spanien verfolgt würden.
Monsieur Jardinverde erblasste. Sofort wollte er den Preis erhöhen, doch Daniel de Sanslieu brachte ihn mit erhobener Hand zum Schweigen. Er fühlte sich in diesem Augenblick in seine wilde Zeit als Raubritter zurückversetzt und lächelte grimmig. Die ganze Schuld seines Bruders lastete auf seinem Namen, es musste einen Weg geben, diesen zumindest ein wenig wieder zu bereinigen.
»Was lehrt uns der Schöpfer im Alten Testament? Unter vielen ähnlichen Stellen will ich das Buch Amos zitieren, Kapitel 5, Vers 24, ›Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach‹. Was ist das für eine Gerechtigkeit, die einer ehrbaren Familie jährlich mehr abverlangt, als ein Duc an die königliche Garde in Form von barer Münze und ritterlicher Dienste bezahlt? Wenn sich in Chartres erfahrene Händler ansiedeln, bedeutet dieser Umstand Reichtum für das ganze Herzogtum und das weiß der Bischof, das weiß die Kirche und das weiß unser sehr verehrter Duc de Valois.«
Er verneigte sich tief vor Raphael und den Mesdames Veronique und Agnès.
»Als Erbe des Anwesens de Sanslieu bestehe ich auf den Preis von einer halben Königstruhe, da mir ja sämtliche Lehen bleiben, was urkundlich bestätigt wird. Und die jährliche Apanage soll sich, mit Verlaub, auf 2000 écus d’or belaufen. Außerdem soll der Familie Jardinverde das Recht eingeräumt werden, so viele Freunde und Verwandte auf dem Anwesen zu beherbergen, wie sie möchte, sogar Christen, wenn es denn sein muss.«
Daniel schmunzelte. Dieser Bibelvers und höchstens drei weitere waren alles, was er aus dem Buch der Bücher zitieren konnte, aber es verfehlte nie seine Wirkung. Die Leute zu frappieren machte ihm Spaß, aber den Machthabern ein Schnippchen zu schlagen gleich noch viel mehr. Von draußen hörte man Vogelgezwitscher und etwas entfernt die Rufe der Knechte. Drinnen herrschte Stille; ein Riss in der Zeit. Es war Daniel de Sanslieu bewusst, dass er bezüglich der Apanage keinerlei Rechte hatte. Aber seiner Großzügigkeit würde das Haus de Valois bestimmt nicht nachstehen wollen. Madame Veronique, die eng mit der jüdischen Familie befreundet war, jedoch möglichst rigide verhandelt hatte, um den Bischof milde zu stimmen, presste die Hand vor den Mund. Duc Raphael fand den Vorschlag auch gerechter als die bisherigen Ergebnisse, wusste aber nicht gleich, wie er sich äußern sollte, denn der Seitenhieb gegen das Angebot des Herzogtums war deutlich. Ruben Jardinverde glaubte zu träumen. Er saß da wie ein Bild von Stein. Man hörte nur das Kratzen der Feder auf Papier. Jean de Bouget würde das Vertragsdokument später auf Pergament übertragen. Die kostbare Robe der Madame Veronique rauschte, als sie sich erhob und auf den Marquis zuschritt. Mit dem Daumen beschrieb sie ein Kreuz auf seiner Stirn, ebenso über seinem Mund und auf seiner Brust und sprach mit zittriger Stimme: »Es segne Euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.«
Sie, die für gewöhnlich so viel Dominanz ausstrahlte, reichte ihm nur knapp bis zur Brust.
»Kredenzt den besten Wein, dieses Übereinkommen sollten wir gebührend feiern. Und Ihr, Jean, bereitet sofort die Pergamente vor, ich möchte sie heute Abend noch unterzeichnet wissen«, ordnete der Duc erleichtert an. Jean verneigte sich und verschwand in seine Schreibstube. Diener brachten Wein, kleine Brote, Käse, Schinken und Nüsse.
Daniel setzte sich zu Monsieur Jardinverde, der sich noch immer nicht von diesem glücklichen Schock erholt hatte. Er klopfte ihm kurz auf die Schulter.
»Herzlich willkommen in Chartres.«
Da liefen Tränen über die Wangen des Spaniers.
Wenn Claudine nicht zu ihrer Linde lief und nicht zu den Hühnern, dann eilte sie sämtliche Treppen hinauf, um von den Zinnen weit über die Stadt und das angrenzende Land schauen zu können.
»Ich will ein Vogel sein und fliegen können!«, rief sie ein ums andere Mal, rannte zwischen den Zinnen herum, neigte sich weit hinaus und jauchzte. Trotz aller Freiheiten, die Agnès ihr gewährte, litt sie dabei besonders und verbot ihrem Töchterchen, sich ohne Aufsicht dort oben aufzuhalten. Zwar liebte sie diesen Platz selbst, erinnerte sich an die Zeit auf den Türmen der Notre-Dame zu Paris mit Quasimodo, mit ihrer Madre und mit … Doch an Dom Frollo wollte sie nicht denken und nicht an ihre Verurteilung als Hexe. Dass allein die Erinnerung daran, was auf dem Turm geschehen war, sie nach wie vor lähmte, ihr jegliche Freude zu rauben drohte, wollte Agnès nicht wahrhaben. Sie wollte diesem Dämonpriester nicht erlauben, ihr noch immer Ekel und Schrecken einzujagen. So viel Schönes gab es in ihrem Leben, da wäre es doch gelacht, das wenige Böse nicht endlich vergessen zu können. Wieder einmal quengelte Claudine so lange, bis Agnès ihr erlaubte, mit Anouk hinaufzugehen. Gern wäre sie mitgekommen, doch sie sollte Raphael und Madame Veronique gemeinsam mit Monsieur Jardinverde zur Residenz des Bischofs begleiten. Auch der Vogt de Claireleau war geladen. Es galt, die Unterschriften der beiden einzuholen, was sich angesichts der veränderten Vertragsbedingungen vonseiten des Bischofs schwierig gestalten würde.
»Schau, Anouk! Da unten vor dem Tor steht ein Gespenst. Ui! Ich habe noch nie ein Gespenst gesehen!«, rief Claudine. Sie klatschte vor Begeisterung in die Hände. »Gehen wir hinunter und laden es ein! Maman hat bestimmt auch noch nie ein Gespenst gesehen.«
»Wir dürfen keine fremden Leute einladen, Mademoiselle. Aber Ihr habt recht, die Frau da unten sieht wirklich nicht mehr sehr lebendig aus, so dünn, so blass. Und sie scheint ins Leere zu schauen. Gehen wir doch hinab und reichen ihr etwas von dem Brot, das wir besitzen. Ob sie wohl auch Kirschen mag? Ich habe gesehen, wie die Mägde erste reife Kirschen pflückten und in die kühle Vorratskammer brachten.«
Aufgeregt lief das Kind hinab. Gehen oder gar schreiten war diesem kleinen Wirbelwind vollkommen fremd. Anouk, selbst jung und wendig, hatte Mühe zu folgen. Aus der Küche holten sie ein großes Stück Brot, etwas Käse und ein paar Kirschen, legten alles in einen Korb, in dem sie ein Tuch ausbreiteten, und stahlen sich zum Tor der Mauer hinaus, die den Park rund ums Schloss umgab. Madame Agnès mochte es, wenn Claudine ›die Welt kennenlernte‹, wie sie es nannte, aber Madame Veronique würde es niemals erlauben, das Kind außerhalb des Schlossgebietes mitzunehmen. Sie war ja schon außer sich, wenn es bei den Stallungen spielte, vom Kontakt zu den Kindern des Gesindes ganz zu schweigen. So kam es, dass Anouk mit ihrem Schützling jede Menge Geheimnisse teilte, die das Kind mit dem Herzen auf der Zunge auf keinen Fall vor Madame Veronique ausplaudern sollte.
Sie verließen den Schlosspark allerdings sehr selten und gerade deswegen erlebte die Prinzessin diese Ausflüge stets als Abenteuer. Ganz andere Menschen, verschiedene Tiere, die grunzten und meckerten, schreiende Esel und glucksende Truthähne, alles bunt gemischt, versetzten Claudine in taumelnde Begeisterung. Die Leute trugen mitunter Lumpen, hatten rot entzündete Füße, beachtlich schmutzige Hände und ungewaschenes Haar. Es gab aber auch solche, die bunt gekleidet und sauber waren, sie wirbelten im Kreis und spielten fröhliche Musik.
»Das sind Zigeuner«, hatte Anouk erklärt.
Welch ein aufregendes Wort! Eines jener Wörter, die grand-mère nicht hören dufte.
Nicht weit vom Tor entfernt hielten sich mehrere Leute auf. Es war der Tag, an dem Bauern verschiedene Feldfrüchte ins Schloss brachten, teilweise aber auch verkauften. Darum tummelte man sich um die Karren wie auf dem Markt. Die Gespensterfrau gehörte zu einer kleinen Gruppe von Personen, von denen ein Mann alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Dennoch blickte er sich freundlich um und schien sich an die Gaffer gewöhnt zu haben. In einem unbemerkten Augenblick lief die Prinzessin zu ihm hin, um sein Gesicht von der Nähe betrachten zu können.
»Bist du ein Mensch?«, fragte sie ohne Scheu.
Simon verstand sie nicht, bemerkte aber ihren Blick und lächelte.
»Du bist ein lieber Einaug-Mensch«, stellte sie fest und ging zu Paquette.
»Bist du ein Gespenst?«
Diese quietschte erschrocken, wenn auch in leisem Ton auf.
»Meine kleine Agnès! Meine kleine Agnès!«, flüsterte sie und streichelte Claudine übers Haar.
»Mademoiselle!«, rief Anouk panisch, weil sie nicht wollte, dass die Prinzessin von jemandem berührt wurde, zudem hatte sie bereits einige Augenblicke nach ihr gesucht. Hastig drückte sie Paquette den Korb in die Hand, fasste Claudine am Handgelenk und eilte zurück in den geschützten Schlossbereich, vorbei an den Wachen. Sie lief so lange, bis Claudine jammerte, dass sie nicht mehr mitkäme. Ihr Handgelenk war gerötet, weil Anouk sie so fest mit sich gezerrt hatte.
»Erzählt bitte niemandem, dass Ihr unter diesen Leuten verweiltet!«
Angesteckt von Anouks Panik nickte das Kind weinerlich.
Sophie hatte alles beobachtet. Zunächst rührte sie die Kleine, doch dann begann ihr Herz heftig zu schlagen, der Atem setzte beinah aus, als das fein gekleidete Mädchen so unbefangen mit Simon sprach. Die junge Frau, vielleicht eine Dienerin, konnte doch unmöglich eine Prinzessin mit sich auf gewöhnliche Wege genommen haben. Dennoch wurde Sophie das Gefühl nicht los, ihr sei gerade eine kleine Esmeralda begegnet. Die Sehnsucht nach der Tochter schmerzte regelrecht. Am liebsten wäre sie an den Wachen vorbei durch das Tor gelaufen, um zu sehen, wer dieses Mädchen war.
Wie so oft kam Claudine am Abend in das angrenzende Gemach ihrer Mutter gelaufen, sobald sich diese schlafen legte. Ganz in Gedanken an die Familie Jardinverde, die allein wegen ihrer Religionszugehörigkeit bangen musste, sich an welchem Ort auch immer ansiedeln zu dürfen, erinnerte sie sich an die Zeit, in welcher sie mit den Zigeunern von Stadt zu Stadt gezogen war, bis sie schließlich mit ihrer Madre in Paris so etwas wie eine Heimat gefunden hatte, wenn auch im ›Hof der Wunder‹. Damals war ihr nicht aufgefallen, wie feindlich ihre Sippe von ehrbaren Bürgern betrachtet wurde, denn als gefeierte Esmeralda fühlte sie sich von allen geliebt. Tatsächlich aber musste José, der damalige Anführer ihrer Truppe, oft mühselig feilschen, um außerhalb des Dorfes irgendwo an kalten Stellen ein Nachtlager aufschlagen zu können. Wenn sie sich nicht gerade den Darbietungen hingaben, wurden Zigeuner gemieden, als verbreiteten sie Krankheiten. Agnès wunderte sich darüber, das jetzt erst zu bemerken. Offenbar waren die Liebe ihrer Madre und der Spaß, den sie mit den anderen Zigeunerkindern gehabt hatte, so berauschend gewesen, dass sie die Misstöne ihres Daseins als Kind gar nicht mitbekam. Im Einschlafen sah sie ein großes Haus vor sich, in dessen Hof die Gauklertruppe aufrat. Man hatte ihnen dort mehrere Tage Quartier geboten. Monsieur Jardinverde kam ihr in den Sinn, Valencia, der Strand. Waren es Erinnerungen oder bereits ein Traum?
»Ich habe heute ein Gespenst gesehen, das war aufregend!«, raunte ihr Claudine schlaftrunken ins Ohr.
»Schön, dass dein Tag mit Anouk so aufregend gewesen ist. Bestimmt werde ich auch bald wieder mehr Zeit mit dir verbringen können. Ich freue mich schon darauf!«
Jetzt war sie wieder wach, wenn die Worte auch mehr gelallt als gesprochen klangen. Sie überlegte, ob sie ihrem kleinen Wildfang ein paar Kunststücke beibringen sollte, vielleicht das Radschlagen. Andererseits wäre das doch sehr auffällig. Welche Duchesse schlägt schon Räder oder jongliert mit Äpfeln?
»Ich habe auch einen Einaug-Menschen gesehen, der war lieb.«
Auch Claudine lallte fast, sie war nur noch teilweise wach. Agnès drückte sie sanft an sich, bereit weiterzuschlafen. Kurz bevor sie aber gänzlich in den Schlaf hinüberglitt, schreckte sie wieder hoch. Was hatte ihre Tochter gesehen? Ein Gespenst und einen Einaug-Menschen? Ihr Herz raste. Konnte es sein? Nein, wie käme denn der Glöckner Quasimodo nach Chartres? Und das Gespenst? Mit sehnsuchtsvollen Gedanken an ihre Madre schlief sie schließlich ein. Sie saß mit Sophie, mit Quasimodo, Jean und Enzo auf einer Wiese und aß saftige Früchte, die sie aus Spanien kannte, Stücke riesiger Melonen. Rund um sie flatterten Tauben, die alle kleine Botschaften ans Bein gebunden hatten. Sie wollte sie lesen, doch die Tauben entwischten ihr immer wieder.
Das Kind plauderte im Nebenraum mit Anouk, als Agnès am Morgen aus einem angenehmen Traum erwachte.
»Guten Morgen, ihr zwei!«, rief sie in den Nebenraum hinüber, während sie sich gähnend streckte. Anouk brachte den Becher mit frischem Aufguss, den Agnès stets beim Aufstehen trank. Claudine plauderte unentwegt und weigerte sich, ihre Schuhe anzuziehen.
»In diesen Schuhen kann ich das Gras gar nicht spüren!«, protestierte sie.
»Wir werden der Linde zu dritt unseren Morgengruß entbieten und dort die Schuhe ausziehen, was hältst du davon, Claudine?«, schlug Agnès vor. Das Kind ließ sich damit beruhigen.
»Danach kommst du aber zum gemeinsamen Frühmahl mit Papa und Madame Veronique. Sie legt großen Wert auf diese Rituale.«
Agnès bemühte sich um einen strengen Ton, obwohl Claudine wusste, dass die Mutter während dieser gemeinsamen Mahlzeiten ebenso gähnte wie sie selbst, wenn nicht sogar noch mehr.
»Nun gut, Maman«, sagte sie, »aber nur für eine Weile, ich muss nämlich danach noch mit den Hühnern wichtige Gespräche führen und auch den Tauben-Martin muss ich sprechen!«
Da lachte Anouk laut auf. Sie fand es drollig, wenn die Prinzessin Ausdrücke Erwachsener in ihre Spiele einbaute.
»Gibt denn Schwester Maria Pilar heute keinen Unterricht?«
»Die kommt nicht mehr. Sie mag meinen Gott nicht und ist sowieso langweilig!«, sagte die Prinzessin mit betont gleichgültigem Tonfall.
»Was heißt, sie kommt nicht? Ist etwas vorgefallen?«
Agnès schaute Anouk irritiert an. Diese erzählte vom gemeinsamen Besuch bei der Linde und dass die Prinzessin den Baum als Dreifaltigkeit beschrieben habe.
»Das wird Madame Veronique bestimmt wenig erfreuen«, fand Agnès. Inzwischen waren sie bei der Linde angelangt. Obwohl die Wiese noch taunass war, zogen sich Agnès und Claudine die Schuhe aus, es fühlte sich erfrischend an, barfuß auf dem Gras zu gehen.
»Aber vom Gespenst werde ich nichts erzählen, versprochen«, versuchte Claudine einen eventuellen Fehler wiedergutzumachen. Sie wusste nie so recht, was in den Augen der Erwachsenen ein Fehler war und was nicht. Das Einzige, was sie mittlerweile feststellen hatte können, war, dass manche etwas lustig fanden, was andere als schlecht erachteten. Und was eine Sünde sein sollte, verbarg sich ihrem kindlichen Verständnis ganz und gar. Wieder schaute Agnès ihre Zofe fragend an.
»Madame, wie soll ich es erklären, wir beobachteten von den Zinnen eine Frau, die wirklich wie ein Gespenst aussah; unglaublich dünn und totenblass. Als wir ihr Brot bringen wollten, sprach sie sogar mit ganz unheimlicher Stimme zur Prinzessin«, versuchte Anouk sich zu rechtfertigen.
Trotz der Vertrautheit zwischen ihr und Madame Agnès fühlte sich die Zofe bei diesem Bekenntnis denkbar unwohl. Sie hatte entgegen der Anweisungen das Schlossgelände verlassen.
»Und den Einaug-Menschen habe ich auch getroffen. Er lächelte und ich konnte sehen, dass er ein lieber Mensch ist, auch wenn er wie ein Riese aus den Erzählungen aussieht«, ergänzte Claudine.
Agnès lehnte sich gegen die Linde.
»War noch jemand bei diesen beiden Personen?«, fragte sie mit klopfendem Herzen.
»Madame! Ist Euch nicht gut?« Anouk bemerkte die aufgewühlte Reaktion ihrer Herrin.
»Nein, sie denkt nur nach«, beschwichtigte Claudine und beobachtete ihre Mutter. Nach einer Weile aber fragte auch sie bang,
»Hast du schon fertig gedacht, Maman?«
Mit beiden Händen bedeckte Agnès das Gesicht und setzte sich aufs feuchte Gras. Das Kind setzte sich zu ihr, Anouk mahnte aber, dass man vielleicht schon mit dem Frühmahl wartete.
»Wer war noch bei den beiden, Anouk?«, insistierte Agnès.
Die Zofe dachte nach. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, mit dem Kind unter die Leute gegangen zu sein.
»Da war noch eine edle Frau, allerdings in einfachem Gewand und ein junger Bursche, auch sehr einfach gekleidet, aber sauber. Alle wirkten sauber. Ich habe sie beobachtet, weil, weil …«
Anouk begann zu weinen.
»Es tut mir leid, Madame! Ich habe die Prinzessin nur für wenige Augenblicke aus den Augen verloren, nur ganz kurz. Und die verrückte dünne Frau hat ihr nur zweimal übers Haar gestreichelt, sonst ist nichts passiert.«
»Beruhige dich, Anouk, es ist ja zum Glück wirklich nichts passiert. Hat die Frau etwas gesagt?«
»Die dünne Frau? Sie sagte etwas wie ›meine Agnès‹. Seltsam, nicht wahr?«
Agnès de Valois ließ sich die vier Personen so gut wie möglich beschreiben. Nachdenklich ging sie anschließend mit Claudine hinauf zum Frühmahl, das längst serviert war.
»Meine Liebe, es wird langsam Zeit, der Prinzessin eine adäquate Ausbildung angedeihen zu lassen«, begann Madame Veronique ohne Umschweife in verärgertem Tonfall. Auf Pünktlichkeit legte sie großen Wert. Nun musste sie auch noch bemerken, dass sowohl die junge Duchesse als auch die Prinzessin mit taunassen Schuhen und feuchtem Gewand zum gemeinsamen Morgenmahl erschienen.
»Was ist eine adquaquate Ausbildung? Kommt dann Schwester Maria Pilar wieder für den Unterricht zu uns?«, wollte Claudine resigniert wissen.
»Die arme Nonne ist außer sich und weiß nicht, ob sie mit der Unterweisung für die Prinzessin fortfahren kann!«, schimpfte Madame Veronique.
»Weil Gott in der Linde wohnt und sie das nicht versteht?«
»Was sind das für ungehörige Aussagen? Kind! Du hast die Schwester zutiefst erschüttert!«
Madame Veronique tupfte sich mit einem kleinen Tuch den Mund ab, trank einen Schluck Kräutersud und wandte sich dann so freundlich wie möglich an ihre Schwiegertochter.
»Das Kloster der Dominikanerinnen ist nur einen halben Vormittag Kutschenfahrt von hier entfernt. Die meisten hochwohlgeborenen Familien geben ihre Töchter dorthin, um sie zu künftigen Müttern gottesfürchtiger Herrscher zu erziehen. Claudine ist mit so vielen Geistesgaben gesegnet, sie kann in ihrem zarten Alter bereits lesen und schreiben, singt mehrere Psalmen beim Gottesdienst mit, auf Latein! Diese Fähigkeiten gehören in gottgefällige Bahnen gelenkt, schließlich ist die Prinzessin kein Kleinkind mehr. Wenn sie weiterhin wie ein Fohlen über die Wiesen rennt und sich zu Hühnern hockt oder einen Baum für Gott hält, verliert sie womöglich den Verstand. Ich meine es ja nur gut mit ihr, meine Liebe.«
Madame Veronique, die seit den erfreulichen Verhandlungen bezüglich der Familie Jardinverde in bester Laune war, hatte tatsächlich nichts Böses im Sinn, das wusste Agnès de Valois, aber bei der Vorstellung, Claudine an ein Kloster zu verlieren und ihre Lebendigkeit in den Zwang von Gebeten, gesenktem Blick und ruhigen leisen Schritten einzusperren, wurde ihr übel. Überhaupt wollte sie nicht einen Tag ohne ihre Tochter verbringen. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie das Bild vor Augen, wie sie mit Claudine aus dem Schloss floh, dabei auf ihre Madre traf und wie ehemals als Zigeunerin durch die Lande zog. Das wäre ein Leben, welches Claudine wesentlich mehr entspräche als klösterliche Strenge. Als sei es kaum einige Jahre her, entstanden Bilder aus ihrer Kindheit vor Agnès’ Augen. Wie sie mit den Ziegen hinter den Karren herlief, die Eier aus den Käfigen holte, in welchen die Hühner übernachteten. Der kleine Djali kam ihr in den Sinn, seine Sprünge während sie tanzte und Kunststücke vorführte. Immer wieder wurde ihr die Zeit in Spanien vor Augen gerufen. Lag es nur daran, dass sie mit Ruben Jardinverde ein paar Worte auf Spanisch gewechselt hatte, oder stimmte ihre Vermutung, sie sei ihm in Valencia bereits begegnet? Ihre Sehnsucht, mit Claudine ein Leben zu führen wie damals mit Sophie, wuchs bei diesen Gedanken. Plötzlich erinnerte sie sich an ein prächtiges Gebäude in Valencia. In dessen Hof hatte die Truppe tagelang Darbietungen geboten, Leute aus der ganzen Stadt kamen herbei, sie waren die Attraktion für das mehrtägige Hochzeitsfest der Gastgeber gewesen. Man hatte ihnen Quartier bei den Stallungen gewährt, sie mit reichlich Speisen verwöhnt, das jung vermählte Paar war oft bei ihnen gesessen und hatte sie nach ihren Reisen durch ganz Spanien und Frankreich befragt. Reich und vornehm waren die beiden gewesen, aber ohne Dünkel. Plötzlich zuckte Agnès zusammen. Sie kannte diesen Mann von damals. War es nicht Ruben Jardinverde? Der Schreck durchglühte sie. Hatte er sie erkannt? Doch nichts wies darauf hin, sie war damals höchstens neun Jahre alt gewesen. Was für eine Fügung, ihm hier wieder zu begegnen. Eine Welle der Zuneigung für die Familie Jardinverde durchströmte sie.
»Madame Agnès! Soll ich Gespräche für solch eine gediegene Ausbildung veranlassen?«, riss sie die Schwiegermutter aus ihren Träumereien.
»Mon Seigneur, mein lieber Gemahl, glaubt auch Ihr, unsere Tochter sei für eine klösterliche Erziehung geeignet?«, suchte Agnès Hilfe. Raphael de Valois allerdings war selbst in Gedanken und hatte dem Gespräch nicht gelauscht.
»Kloster? Erziehung? Für unsere Prinzessin ist das Beste gerade gut genug!«, lächelte er.
»Und das Beste ist es, wenn ich meine wichtigen Gespräche mit den Hühnern führen kann und wenn mir der Tauben-Martin das Fliegen beibringt, so wie den Tauben«, rief Claudine.
»Da hört Ihr es! Das Kind hat vollkommen verdrehte Gedanken, es ist eine Sünde, die Prinzessin weiterhin wie eine Wilde aufwachsen zu lassen. Sie gehört umgehend in klösterlich solide Hände.«
Raphael horchte auf. Der strenge mütterliche Tonfall ließ ihn zusammenfahren, aufmerksam musterte er sie. Worum ging es eigentlich? Hatte sein kleiner Wildfang wieder etwas angestellt? Als er aber auch Agnès’ angespannte Miene sah, suchte er in den Augen seiner Tochter Rat. Diese verfolgte genau, was über sie gesprochen wurde. ›Kloster, Sünde, Wilde‹ hatte sie aufgeschnappt. Das klang nicht gut.
»Mon Seigneur, glaubt auch Ihr, unsere fünfjährige Tochter müsse in klösterlicher Strenge erzogen werden?«, insistierte Agnès in schneidendem Ton.
Sie legte ihm das Veto direkt in den Mund, war aber dermaßen aufgebracht, dass sie gedanklich bereits mit Claudine bei Nacht und Nebel floh; einfaches Gewand einer Küchenmagd und schon wäre sie keine Duchesse mehr. Frei von lächerlicher Etikette und frei vor allem von der Bevormundung einer engstirnigen Schwiegermutter, das lockte sie. Niemand sollte ihrem Kind die Freiheit nehmen! Drei weibliche Augenpaare durchbohrten Raphael. Er spürte, dass es um viel ging.
»Was meinst du, Claudine? Wie können wir sowohl deine Maman als auch deine Großmutter erfreuen?«, wand er sich heraus und blickte die Prinzessin erwartungsvoll an.
»Ich glaube, die Hühner haben nichts dagegen, wenn ich lateinische Psalmen mit ihnen singe. Würde dir das gefallen, grand-mère?«
»Machst du dich über mich lustig, Kind? Wie oft soll ich denn noch sagen, dass du dich dort nicht herumtreiben sollst, weder lateinisch noch französisch singend?«
Madame Veronique schlug kräftig mit der Faust auf den Tisch. Überrascht musterte Raphael sie.
»Madame. Ich habe Euch bereits gebeten, wesentliche Entscheidungen bezüglich unserer Tochter meiner Gemahlin und mir zu überlassen!« Seine Worte klangen gepresst und ungewöhnlich streng. Nach einer Schrecksekunde erhob sich Madame Veronique. Sie bemühte sich, besonders aufrecht zu gehen, wirkte aber gebeugt, als sie grußlos den Raum verließ.
»Raphael! Wie gut zu wissen, dass du es nie erlauben wirst, Claudine in ein Kloster zu sperren!«, sagte Agnès.
»Sprecht mich bitte nicht so vertraut an, wenn andere dabei sind, Madame«, war seine erste Reaktion. Er wirkte noch immer gereizt.
»Aber nur ich bin gerade da, Papa. Und ich bin auch vertraut«, mischte sich Claudine ein. Raphael blickte auf, als erwache er aus einem düsteren Traum. Er sah seine Tochter an und lächelte.
»Du! Mein kleiner Sonnenschein! Du bist meine tägliche Freude. Ich brauche dich und ich brauche es, deine Maman fröhlich zu sehen. Natürlich sollst du nur hier bei uns im Palast sein.«
Längst hatten sich alle zurückgezogen, die Glocken von Chartres läuteten mit zwölf dumpfen Schlägen Mitternacht. Agnès konnte keinen Schlaf finden, von Stunde zu Stunde wurde sie unruhiger und sie wusste nicht einmal, warum. Du, mein kleiner Sonnenschein hatte Raphael zu Claudine gesagt. Er liebte ihre Tochter von ganzem Herzen. Das rührte sie, versöhnte sie mit dem Schicksal, und es gab ihr Zuversicht, Claudine immer in königlichem Schutz zu wissen. Sie brauchte seine Bestätigung, Claudine nicht ins Kloster zu schicken, doch auch seine beruhigende Nähe brauchte sie in der Anspannung dieser schlaflosen Nacht. Es drängte Agnès, die Gemächer ihres Gemahls aufzusuchen. Doch das wäre unschicklich gewesen. Sie sehnte sich nach einer Umarmung, nach Zuwendung. Alle Welt erwartete den Erben von ihr, was lag also näher, den Gemahl des Nachts aufzusuchen, seine Gunst heraufzubeschwören, die Vereinigung mit ihm zu suchen?
In lodernden Nächten überschwemmst du mich mit dem
Regen deiner Gunst.
In eiskalter Einsamkeit glüht die Erinnerung an dich in
meinem Herzen, in meinem Leib.
In endlos leeren Tagen erfüllt mich allein dein Name mit
Wonne.
Sonne meiner Nacht,
Quelle meines Durstes,
Nahrung meines Hungers,
Komm!
Erlöse mich!
Leicht wie Sommerregen perlten die Worte des Dichters in ihren Gedanken. Wer war der Zauberer dieser Worte? Und wie konnte er so klar benennen, was sie empfand? Könnte sie doch Raphaels Liebe wecken, wie sie diese Verse rezitierte, sie würde alles dafür geben. So stark sich Agnès tagsüber auch fühlte, so souverän sie den Menschen auch begegnete und sich meist sogar gegen Madame Veronique durchsetzte, so verlassen fühlte sie sich als Weib. Die freundschaftliche Liebenswürdigkeit ihres Gemahls baute eine Mauer auf, die jegliche Leidenschaft verhinderte. Sie war bereit, Raphael mit seinem Freund Julien zu teilen, aber warum strafte der Gemahl sie mit Entbehrung jeglicher Zärtlichkeit? Er kannte das verbotene Büchlein so gut wie sie, kannte die Klagen darin, die Sehnsucht und die Leidenschaft. Blieb von all dem nichts für sie übrig?
Mein Leben ist Schande,
Heuchelei ist mein Leben.
Und dennoch bin ich reich,
bin umjubelt von allen Thronen und Mächten.
Sie erheben mich als ihren Stern,
sie jauchzen mit mir, weil ich der Weisheit Kleinod kenne,
dich.
Und was kannte Raphael von ihr, von der Mutter der geliebten Tochter? Seine Zuneigung äußerte sich durch beruhigendes Einlenken, sanfte Ermahnungen, Geduld ob ihrer ungewöhnlichen Manieren. Es stimmte, was der Dichter sagte, wer immer es auch war:
Nie wirst du mich ansehen mit meiner Liebe,
nie mit jeglicher Liebe.
Nie wirst du Freude nennen, dass ich mich nach dir
verzehre.
Ekel ist es für dich, was mich zu dir hinzieht.
Ein Wurm bin ich in deinem Leben,
ein Schädling.
Die Ewigkeit bist du in meinem Leben,
die Erlösung.
Während dieser Gedanken, dieser nächtlichen Unruhe, war Agnès wie traumwandelnd aufgestanden und über den kalten finsteren Gang zu Raphaels Gemach gegangen. Vor der schweren Tür stand sie und wagte nicht zu klopfen. Ihr war, als höre sie gedämpftes Kichern und Plaudern. Raphael unterhielt sich mit jemandem. War das Juliens Stimme? Oder täuschten sie Einflüsterungen der Nacht? Vielleicht war sie schlaftrunkener als vermutet. Als sie zu frösteln begann, schlich Agnès wieder zu ihren Gemächern zurück. Sie trug außerdem nur ein Nachtgewand und hatte sich ein Wolltuch übergeworfen. Raphael hätte womöglich die Augen gerollt, sie in diesem Aufzug zu mitternächtlicher Stunde vor seiner Tür zu treffen.
Marquis Daniel de Sanslieu machte sich inzwischen daran, ein Grundstück, noch besser aber ein bereits bestehendes, nicht allzu großes Anwesen für sich zu suchen. Der Gedanke dieses Neubeginns regte ihn an. Er dachte an eine Zucht edler Pferde, auch ein paar Jagdhunde wollte er sich als ständige Begleiter erziehen. Seit sein Bruder Alfons verstorben war und er nach Jahrzehnten wieder in die heimatliche Burg zog, erkannte er den Wert der Sesshaftigkeit. Das freie Leben als Raubritter, zu welchem er durch seine Verbannung gezwungen gewesen war, gehörte der Vergangenheit an. Es war bereichernd gewesen, aber auch gefährlich. Von Jahr zu Jahr baute zudem die Inquisition ihre Vernetzungen aus, in jeder zufälligen Begegnung konnte man auf einen ihrer Spitzel treffen. Auch seine üblichen Kontakte zu Zigeunertruppen musste Daniel aufgeben, weil diese als Erste Ziel kirchlicher Beobachtung wurden, denn wer nicht regelmäßig die heilige Messe besuchte und keinen Obolus abgab, konnte ja nur verdächtig sein und mit bösen Mächten im Bunde zu stehen. Die Heilige Schrift war voll von Aussagen über Liebe und Barmherzigkeit, wie aber passte die Inquisition dazu? Daniel schüttelte den Kopf. Nichts war ihm suspekter als die Kirche.
Bei näherer Betrachtung fand er allerdings ein ebenbürtiges Übel, die weltliche Macht. Dennoch schien ihm die Macht der Kirche umfassender, weil sie nicht nur über irdische Belange urteilte, sondern vor allem auch über die ewige Seele. Diese wollte kein Christ verwirken und war bereit, alles zu tun, um sie nach kirchlichen Vorstellungen zu bewahren. Wonach aber strebte er selbst? Verlangte ihn nach Gerechtigkeit, nach Anerkennung, nach Genuss? Bei diesem Gedanken fiel ihm die Prinzessin am Schloss de Valois ein, welche mit Kindern der Dienerschaft herumtollte. Dort schien eine erstaunliche Freiheit zu herrschen. Seit wann vermischte sich die Obrigkeit mit dem einfachen Volk? Seit wann wurden Hochwohlgeborene so frei erzogen, dass sie überhaupt Gelegenheit fanden, auf Wiesen herumzulaufen? Kamen in adeligen Familien nicht schon ganz junge Mädchen zu Nonnen ins Kloster? Und wurden nicht adelige Knaben von sechs Jahren gedrillt und frühmorgens mit kaltem Wasser geweckt, damit sie später wackere Herrscher abgaben? Jedenfalls hatte die Erziehung seines ältesten Bruders Alfons so ausgesehen und die seiner anderen Geschwister ebenfalls, welche allesamt früh an Krankheiten oder durch Unfälle verstorben waren.
Er, als Jüngster, war wegen seiner schwächlichen Gesundheit vor solch rigider Erziehung verschont geblieben. Man glaubte nicht, dass er die ersten Lebensjahre überstehen würde. Eine der niedrigsten Mägde hatte sich um ihn zu kümmern, während sich nur hochnoble Lehrer um seine Geschwister bemühten. So trieb sich Daniel als Kind mit dem Sohn jener Magd bei den Stallungen herum, während die Brüder das Strammstehen übten, oft stundenlang in der prallen Sonne oder bei eisigem Wind und Regen. Die Schwäche und das Husten früher Kindertage überwand er, während ein Bruder nach dem anderen verstarb.
Alfons hatte es Daniel stets übelgenommen, dass er nur Lesen, Schreiben und einige kirchliche Gesänge lernen musste, während er von klein auf hart im Schwertkampf und Reiten gedrillt worden war. Wann immer er sich unbeobachtet fühlte, lauerte er ihm auf, oft gemeinsam mit den anderen Brüdern.
»Ergebt Euch, Schurke! Ihr habt gegen Gott und den König gesündigt!«, rief er und balgte sich mit Daniel oder schlug ihn mit dem hölzernen Übungsschwert. Jetzt musste Daniel bei diesen Erinnerungen lächeln.
»Schurkenpack, macht euch auf etwas gefasst, jetzt kommen wir, die Gloriosen!«, hörte er noch immer den damals zwölfjährigen Alfons rufen.
»Ihr werdet von uns besiegt! Glorios wird dann keiner von euch mehr sein!«, schrie Antoine, der Sohn seiner Amme. Sie bildeten zwei Banden, Daniel mit drei Kindern aus der Dienerschaft und Alfons mit den beiden Brüdern. Die Rangeleien waren hart, aber auch aufregend. Doch dann erwischte man sie mitten im schönsten Kampf. Daniels Anhänger wurden hart bestraft, weil sie sich mit Adeligen geprügelt hatten. Alfons und die Brüder mussten einen ganzen Nachmittag vor dem Burgtor strammstehen, nur Daniel blieb verschont, weil er wieder einmal Fieberschübe mit starkem Husten hatte. Das war von allem das Schlimmste. Vergeblich versuchte er Antoine und die beiden anderen Freunde mit Köstlichkeiten aus der Küche zu trösten. Sie waren ihm nicht böse, schlimmer; ihnen wurde klar, dass es kein Miteinander zwischen adeligen Kindern und ihnen geben konnte.
Sobald der Vater in hohem Alter gestorben war, hatte Alfons als Erbe seinen einzigen noch lebenden Bruder von der Burg verbannt. Er bekam eine prall gefüllte Geldkatze, den ältesten Knecht als Begleitung, ein Pferd und eine Jagdhütte als Wohnort. Alfons brauchte keine Begründung für sein Vorgehen, er war der Burgherr. Beim Bischof suchte er um eine junge Braut an und hoffte auf reichen Kindersegen. Das verängstigte Mädchen überlebte Alfons’ Männlichkeit nur wenige Wochen, ebenso war es mit der zweiten Bedauernswerten gewesen. Einige Zeit später hielt ein tapferes Mädchen aus dem Hause de Mortain länger durch und gebar sogar einen Sohn. Dieses missgestaltete Kind wurde von der jungen Mutter mit all ihrer Liebe beschützt, und er, Daniel de Sanslieu, hatte die Ehre, ihr und dem Säugling zu helfen. In den Jahren danach beobachtete er sie ab und zu aus der Ferne, wenn Josés Truppe in verschiedenen Städten Frankreichs aufgetreten war.
Er hoffte, sie einmal von der Truppe seines Freundes herausholen und ihr vielleicht sogar ein Leben an seiner Seite bieten zu können, gemeinsam mit ihrem Sohn. Nie gab er sich zu erkennen, wollte sie nicht in Gefahr bringen, denn er war der Anführer der gefürchteten Raubritter, die in weiten Teilen des Landes wütete und allen Adeligen nahm, was sie zuvor den Vasallen abgenommen hatten. Doch irgendwann hoffte er, sie in ruhigeren Zeiten wiederzusehen. Und diese waren nun angebrochen, allerdings hatte er ihre Spur nur wenige Jahre nach ihrer Flucht verloren und auch von José nichts mehr gehört. Zwar konnte er in Erfahrung bringen, dass es die Truppe noch gab, aber sie schien bestimmte Gegenden Frankreichs zu meiden. Warum? Das Leben war voller Abenteuer, aber auch voller Fragen ohne Antworten.