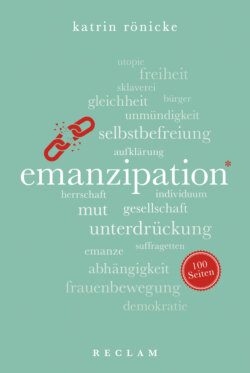Читать книгу Emanzipation. 100 Seiten - Katrin Rönicke - Страница 4
ОглавлениеVorwort: Vom Baum der Erkenntnis bis Google
Warum ein Buch über Emanzipation? Ist das nicht ein ziemlich altmodisches Wort? Eines, das man heute kaum noch benutzt? Es stimmt wohl: Emanzipation klingt für viele nach einem Wort aus vergangenen Zeiten. War das nicht irgendwas aus den Siebzigern und mit Frauen? – Ja, auch. Aber Emanzipation ist viel mehr als das! Schaut man in die Geschichte der Menschheit, ist sie überall: Es beginnt mit der biblischen Geschichte von Adam und Eva, die Früchte vom Baum der Erkenntnis pflücken und sich damit von Gott emanzipieren – aber leider daraufhin aus dem Paradies fliegen. Um Emanzipation handelt es sich immer dann, wenn Menschen sich aus dem Zustand einer Unterdrückung oder Unmündigkeit befreien. Das Ende des Mittelalters und die einsetzende Renaissance, das aufstrebende Bürgertum, die Bibelübersetzungen Martin Luthers, die Revolutionen in den USA und in Frankreich, das Ende von Absolutismus und Monarchie sowie die Einführung der Demokratie in den neuen Republiken, die Gründung Israels, das Ende der Sklaverei und der Kolonialzeit, die Suffragetten im Kampf für das Wahlrecht der Frauen, die Anerkennung Homosexueller – die Geschichte der Menschheit ist bei genauer Betrachtung eine Geschichte vieler Emanzipationen, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es damit schon vorbei wäre. Denn immer werden Menschen das Bedürfnis haben, frei, selbstbestimmt und unabhängig zu sein.
Bis heute schlagen sich viele Staaten des Globalen Südens mit den Folgen der Kolonialzeit herum – für sie ist der Prozess der Emanzipation noch lange nicht abgeschlossen. Aber auch die reichen Industrienationen geben noch Anlass zu Befreiungsversuchen aller Art: Was ist etwa mit der Emanzipation des Mannes? Wie frei ist ein Mensch, wenn er ohne Geld nicht überleben kann? Gibt es wirklich nur zwei Geschlechter und nichts dazwischen? Auch im Kleinen spielt Emanzipation immer wieder eine Rolle: In Familien und Beziehungen, in unseren Arbeitsverhältnissen und nicht zuletzt in unserem Bild von uns selbst sind wir mit einer Reihe von Abhängigkeiten konfrontiert, die mit Zwängen und Unterdrückung zu tun haben. Viele kennen beispielsweise Konflikte mit einem herrischen Vater oder das Problem, dass die ganze Fürsorgearbeit an den Frauen in der Familie hängenbleibt.
Emanzipation hat daher kein richtiges Ende – weder für die einzelne Person noch global gesehen: Die ganze Menschheit erkämpft sich von Generation zu Generation neue Freiheiten, und doch scheint es, als ob jede neue Freiheit mit einer neuen Unterdrückungsform einhergehe. Jede Epoche erfordert deswegen neue Emanzipationen, etwa von der Kirche, von kolonialistischen Unterdrückern oder von den Männern, die über uns Frauen bestimmten. Ja, das Ende des Mittelalters, die Reformation, der Beginn des Kapitalismus und die Demokratie haben viele äußere Zwänge abgeschafft – aber bei genauem Hinsehen bringen sowohl die Neuzeit als auch Kapitalismus und Demokratie neue Formen von Ungleichheit und Diskriminierung mit sich.
Meine Freundin Alex hat sich zum Beispiel von Facebook unabhängig gemacht – eine digitale Emanzipation. Der britische Autor und Faulheitsphilosoph Tom Hodgkinson hat sich vom Leistungsdiktat emanzipiert. Moderne Städter befreien sich aus der Abhängigkeit vom Auto, und auf dem Land emanzipieren sich viele Menschen von der Beschleunigung. Junge Leute emanzipieren sich von den Erwartungen ihrer Eltern, oder sie kämpfen gegen konkrete Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Islamophobie. Emanzipation ist ein Impuls, der sich nur gewaltsam unterdrücken lässt. Beispielsweise gehen im Iran seit Dezember 2017 jeden Mittwoch Frauen auf die Straße und schwenken ihr Kopftuch aus Protest gegen das Gesetz, das sie zum Tragen des Tuches zwingt – sie haben sich von der Angst befreit. Selbst wenn sie dafür ins Gefängnis kommen, hört der gewaltlose Protest nicht auf, so groß ist ihre Sehnsucht nach einem Ausbrechen aus der staatlich-religiösen Unterdrückung.
Aus dem Wörterbuch
Emanzipation ist die Befreiung aus gesellschaftlichen oder persönlichen Abhängigkeiten und der Gewinn von Selbständigkeit. Oder auch: Befreiung aus entwürdigender Abhängigkeit. Mögliche Synonyme sind: (Akt der) Selbstbefreiung, Abnabelung, Kampf um Unabhängigkeit, Zugewinn an Selbständigkeit.
Emanzipation bedeutet wörtlich die »Entlassung aus der väterlichen Gewalt« oder auch die »Freilassung eines Sklaven« – so steht es zumindest im Etymologischen Wörterbuch von Kluge. Und wenn man die US-amerikanische Geschichte betrachtet, kommt man an diesem Begriff nicht vorbei: Da ist etwa die Emanzipationsproklamation (Emancipation Proclamation), 1862 von Abraham Lincoln erlassen, in der die Abschaffung der Sklaverei erklärt wurde. Sie trat am 1. Januar 1863 in Kraft und war der Beginn der endgültigen US-weiten Abschaffung dieser menschenunwürdigen Praxis, in der schwarze Menschen zum Eigentum von weißen geworden waren.
Aber sowohl die väterliche Gewalt als auch die Sklaverei scheinen heute keine Themen mehr zu sein. Heute geht es vielmehr um die Frage: Wer oder was bestimmt über mich? Bewegungen wie Occupy sehen vor allem soziale und ökonomische Ungleichheit als Hindernisse für die persönliche Entfaltung eines jeden Menschen. Sie kritisieren Banken und Finanzspekulationen, die auf Kosten der Mehrheit einigen wenigen zu immensem Reichtum verhelfen. Damit stehen sie geschichtlich alles andere als alleine da: Schon Karl Marx hoffte auf eine große Emanzipationsbewegung durch das sogenannte Proletariat. Er sah im Kapitalismus vor allem ein ausbeuterisches und auch unterdrückerisches System – viele teilen diese Diagnose bis heute.
Emanzipation ist auch deswegen heute noch aktuell, weil sich unsere Art der Kommunikation und die Ausgestaltung politischer Debatten mit den digitalen Medien grundlegend verändert hat. Noch vor etwa 20 Jahren waren die Hierarchien eindeutig: Es gab Sender und es gab Empfänger. Radio, Fernsehen und Presse berichteten, interviewten, hoben hervor und wählten Themen aus – heute kann theoretisch jeder selbst zum Sender werden und sogar eine Revolution mithilfe der sozialen Medien besser koordinieren, wie es zum Beispiel im Arabischen Frühling geschah. Und doch haben uns die neue Freiheit und die neuen Möglichkeiten der Teilhabe an einem öffentlichen Diskurs, einem Diskurs, der nicht einmal vor Ländergrenzen haltmacht, wieder eine neue Unterordnung eingebracht: Die Monopolisten in der neuen digitalen Welt heißen Google, Amazon und Facebook. Sie beeinflussen in einem enormen Maß, was wir sehen und wie wir es sehen – und nebenbei biegen sie sich unsere bürgerlichen Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz erheblich nach ihrem Gusto zurecht.
Meine erste Emanzipation habe ich im Alter von 14 Jahren erlebt. Jahrelang war ich ein Underdog in meiner Klasse gewesen, eine, die nicht »cool« war, es aber unbedingt sein wollte. Dummerweise kam ich aus der ehemaligen DDR, und das war in den 1990er Jahren in der westdeutschen Kleinstadt ein Stigma. Um dennoch cool zu sein, hängte ich mich an die Mitschüler, die »cool« waren: Sie rauchten, trugen stets »coole« Klamotten und trafen sich jeden Nachmittag, um miteinander »abzuhängen«. Damit ihr Glanz auch auf mich abstrahlen möge, verbog ich meine Identität, so weit es nur ging. Ich wurde eine Art Mitläuferin, für sie jedoch nur ein nützlicher Idiot. Nie war ich ein gleichberechtigter Teil der Clique, sondern eher ein fünftes Rad am Wagen – ganz praktisch für die anderen, aber im Grunde eher überflüssig.
Eines Tages beschloss eine Schülerin aus der Clique, dass sie meiner überdrüssig war. Es folgte eine Mobbingkampagne gegen mich, an der sich beinahe alle Mädchen aus meiner Klasse beteiligten. Bei gemeinsamen Treffen zog man dermaßen über mich vom Leder, dass ich am liebsten sterben wollte. Als Reaktion auf diese Ausgrenzung entwickelte ich selbstzerstörerisches Verhalten in Form einer Essstörung. Und obwohl diese Mädchen mich so tief verletzt hatten, wollte ich immer noch nur eines: dazugehören. Ich hatte mich selbst und mein eigenes Glück davon abhängig gemacht, ein Teil dieser Gruppe zu sein, und ich brauchte ein ganzes Jahr, um zu begreifen, wie erniedrigend und zerstörerisch meine Sehnsucht war. Erst dann begriff ich, dass ich damit meine psychische Gesundheit gefährdete, die sogar schon ganz schön ramponiert war. Nur dank einer guten Freundin aus der ehemaligen DDR wurde mir bewusst, dass es besser war, alleine zu sein, als weiter um die Freundschaft dieser Leute zu betteln. Von einen Tag auf den anderen sagte ich alle Cliquentreffen ab, hörte ich auf, die Musik meiner Freunde zu hören, ihre Kleidungsordnung zu befolgen, um ihre Anerkennung zu werben. Ich zog einen Schlussstrich unter diese Zeit, um etwas Neues zu beginnen. Nicht sie bestimmten, was ich tat, trug, hörte und nachmittags unternahm – ich selbst bestimmte nun.
Tatsächlich blieb ich gar nicht lange alleine. Schnell entwickelte sich eine Freundschaft zu einem Mädchen, das einige Zeit vor mir schon einmal die Außenseiterin der Klasse gewesen war und das Mobbing kannte – auch sie hatte sich längst von dem Ideal verabschiedet, von den anderen »cool« genannt zu werden. Plötzlich war da außerdem ein Junge, der mich knutschen wollte, und noch einer, der mit mir gehen wollte – womit meine kühnsten Teenieträume wahr wurden, überraschenderweise ganz ohne dass ich zu den Coolen gehört hätte. Dann traf ich einen Jungen, der auch aus dem Osten kam. Er wurde mein erster Freund und wir verbrachten tolle Jahre miteinander. All das gelang mir, weil ich gelernt hatte, aus mir selbst heraus Sinn und Freude zu ziehen. Genau das machte mich dann für andere unwiderstehlich. Emanzipierte Menschen werden oft von anderen bewundert, denn sie haben meistens Mut bewiesen, Stärke und meistens auch Klugheit, indem sie eine Abhängigkeitssituation überhaupt als solche erkannt und sich dann entschieden haben, diese zu beenden. Sie wagen es, hinterher mit nichts von vorne anzufangen.
So pathetisch das klingt: Die erste Emanzipationserfahrung kann mir keiner nehmen. Immer wieder hilft mir diese Erinnerung aus meiner Jugend dabei, Beziehungen und Verhältnisse zu hinterfragen sowie immer wieder neu zu entscheiden, ob es wirklich so weitergehen soll oder ob ich besser neu anfange. Im Studium, im Job, bei Freundschaften, im Netz. Für uns westliche Menschen mögen keine ganz großen Emanzipationen mehr nötig sein, wie sie damals von den Suffragetten erkämpft wurden, die dafür sorgten, dass Frauen überhaupt wählen können. Wir brauchen keinen Mahatma Gandhi, um uns aus der Kolonialherrschaft zu befreien. Aber wir brauchen immer noch viel Mut, wenn wir das Studium schmeißen, den Vater unserer Kinder verlassen, den Twitteraccount löschen oder den Job an den Nagel hängen wollen.