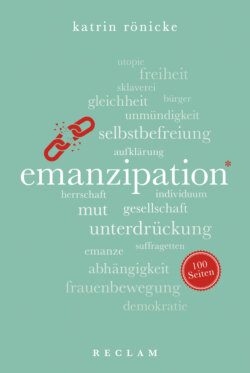Читать книгу Emanzipation. 100 Seiten - Katrin Rönicke - Страница 5
ОглавлениеAdam und Eva und die Folgen bis ins Mittelalter
In der biblischen Geschichte von Adam und Eva emanzipieren sich die Menschen von Gott. Gerade noch lebten sie in Frieden und ohne Leid oder unerfüllte Bedürfnisse im Paradies, da setzen sie auch schon die ganze Sache aufs Spiel, denn sie wollen vom verbotenen Baum essen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Waren sie eben noch eins mit der Natur, verstoßen sie nun gegen die Regeln, die Gott aufgestellt hat. Seitdem ist der Mensch, wie er nun einmal ist: Er leidet wie ein Hund im Kampf um sein Überleben, er weiß, dass er sterben muss, er fühlt sich seltsam abgetrennt vom Rest der Natur wie auch von den anderen Tieren und so fort. Menschsein ist eine Zumutung – immer schon. Die Geschichte von Adam und Eva wurde erfunden, um diese Zumutung zu erklären und zu bewirken, dass sie sich weniger ungerecht anfühlt. Adam und Eva, so diese Erklärung, haben eine Sünde begangen, indem sie sich über Gottes Gebot hinweggesetzt haben. Also ist das, was der Mensch heute ist, nichts anderes als dessen gerechte Strafe für diese Ungehörigkeit!
Man könnte aber auch anders an die Sache herangehen und sagen: Hey cool – Adam und Eva haben sich von Gott emanzipiert! So sieht es auch der Philosoph Erich Fromm (1900–1980), der bereits 1941 in seiner Schrift Die Furcht vor der Freiheit bemerkte: »Vom Standpunkt der Kirche aus […] ist diese Handlung eine Sünde. Vom Standpunkt des Menschen aus bedeutet sie hingegen den Anfang der menschlichen Freiheit.« Fromm sieht in den beiden Wesen, die Gott da im Paradies beherbergt, nicht einmal wirkliche Menschen, wenn er außerdem diese »Sünde« als »erste menschliche Tat« bezeichnet und das Leben im Paradies als »vormenschlich«. Kurz: Erst die Emanzipation von Gott macht den Menschen zum Menschen. Darin sind sich Fromm und die Kirche zumindest einig. Doch die Kirche trägt diese Begebenheit lange als eine Schreckensgeschichte vor: Da die beiden gesündigt haben, müssen seither alle Menschen büßen.
Mit einem Schaudern denken deswegen viele Menschen an das Mittelalter. Die Historiker können diese Zeit sicherlich besser erklären, als ich es kann, aber so viel habe ich doch verstanden: Die Strukturen im Mittelalter basierten in erster Linie darauf, dass man keine Wahl hatte. Man wurde in einen bestimmten Stand hineingeboren und gelangte so an einen Platz, der unverrückbar war. »Als Bauer geboren, als Bauer gestorben – Bauer ein Leben lang«, wie der kleine Ritter Trenk in der gleichnamigen Geschichte von Kirsten Boie. Tatsächlich rechtfertigte man diese Unfreiheit indirekt mit der Geschichte vom »Sündenfall«, also von Adam und Eva, denn das, was man war, was einem widerfuhr, das war von Gott genau so gewollt. Deswegen nahm man es auch so hin. Egal, wie arm oder reich einer war, wie gesund oder krank – Gott wollte es eben so. »Das Leben besaß für ihn einen Sinn, der keine Zweifel aufkommen ließ«, sagt Erich Fromm: »Jeder war mit seiner Rolle in der Gesellschaft identisch.« – Fast ein bisschen wie im Paradies also. Das Mittelalter bot damit auch ein gewisses Maß an Sicherheit – nur war diese an Knechtschaft gebunden.
Hinzu kamen verschiedene Macht- und Wissensmonopole, die zur Aufrechterhaltung dieser Knechtschaft notwendig waren. Diese Macht und das Wissen teilten sich die Herrscher – Könige und Fürsten – mit dem Klerus, also den Kirchenoberhäuptern. Die Geschichte von Adam und Eva zum Beispiel wurde mitsamt der ganzen Bibel von den Priestern und Bischöfen überliefert und interpretiert, da die Leute einerseits meistens nicht lesen konnten und andererseits die Bibel bis zur Übersetzung durch Martin Luther nur in der lateinischen Sprache vorlag. Daher hatte die normale Bevölkerung keine Möglichkeit, die Aussagen des Klerus über Gebote, Regeln, Pflichten und Bestimmungen zu prüfen. Vermutlich wären sie auf diese Idee aber ohnehin nicht gekommen, denn ein kritisches Wesen, das hinterfragt und reflektiert, war der Mensch damals noch nicht. Der Historiker Jacob Burckhardt beschrieb diesen Zustand als »träumend oder halbwach«, wie unter einem Schleier seien die Menschen damals in »Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn« gefangen gewesen. Dieser Zustand änderte sich mit dem Ende des Mittelalters vor allem durch zwei Faktoren: Erstens kam die Reformation, zweitens eröffnete der Kapitalismus dem Bürgertum eine Möglichkeit, den eigenen Stand zu verlassen.