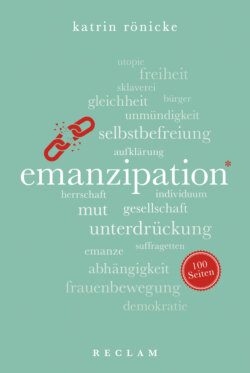Читать книгу Emanzipation. 100 Seiten - Katrin Rönicke - Страница 7
Die Emanzipation stellt das Individuum in den Mittelpunkt
ОглавлениеIm Interview gibt der Historiker Matthias von Hellfeld einen Überblick über die verschiedenen Momente der Emanzipation in unserer Geschichte. Welche Denker und Lenker waren von zentraler Bedeutung?
Gibt es einen historischen Zeitpunkt, an dem die Emanzipation »erfunden« wurde?
Den zu benennen werden sich Historiker sicher schwer tun, aber immerhin reichen die Versuche, das Individuum in den Mittelpunkt politischen Handelns zu stellen, bis in die griechische Antike zurück. Der Reformer und oberste Beamte in Athen Solon (ca. 640–560 v. Chr.) löste im 6. Jahrhundert v. Chr. die »drakonischen Gesetze« seines Vorgängers Drakon ab und setzte eine Art Teilhabe der Menschen an den Entscheidungen des Gemeinwesens durch. Er ließ die Gesetze aufschreiben, so dass jeder die Regeln des Zusammenlebens prüfen und sich daran halten konnte. Der Willkür der Herrschenden war damit etwas entgegengesetzt. Bei Solon stand das emanzipierte Individuum im Mittelpunkt des Interesses. In den folgenden Jahren wurden die Rechte für den Einzelnen ausgebaut. Beim griechischen Philosophen Protagoras (490–411 v.Chr.) liest sich das so: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge«.
Während der Zeit des Humanismus und der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert wurde die griechische Antike wiederentdeckt. Nicht nur die Philosophen galten wieder etwas, sondern mit ihnen auch ihre Auffassungen vom Gemeinwesen und der Rolle des Menschen. Die Entdeckung des Individuums während des Renaissancehumanismus ging unmittelbar auf die griechische Antike zurück, weil sich die Dichter und Denker mit den Originaltexten beschäftigten und deren mittelalterliche Interpretationen außer Acht ließen. Insofern also begann die Emanzipation des Menschen bei den alten Griechen, deren Gedanken zuerst durch die »karolingische Renaissance« der Zeit Karls des Großen (ca. 747–814) vor dem Vergessen bewahrt und archiviert wurden. Über den Renaissancehumanismus kam der Gedanke der Emanzipation des Individuums zu uns in die Neuzeit.
War die Renaissance also ein emanzipatorisches Unterfangen?
Da fällt die Antwort eindeutig aus: Ja! Der Mensch wurde während der Renaissance auch mehr und mehr in den Mittelpunkt der Arbeit von Künstlern und Philosophen gerückt. Maler und Bildhauer fertigten zum ersten Mal Detailstudien des menschlichen Körpers an, sie malten die Menschen, wie sie wirklich aussahen – Hände, Gesichter, Füße oder ganze Akte.
Da die Künstler wissen wollten, wie der Mensch funktioniert und wie er unter der Haut aussieht, wurden illegale Obduktionen durchgeführt. Die Kirche wollte das mit aller Macht verhindern, weil sie befürchtete, dass dieses Wissen die Menschen von Gott und der Kirche emanzipieren würde. Diese nahezu biologische Entdeckung des Ich führte tatsächlich zu emanzipatorischen Ideen. Die Reformation Martin Luthers, die am Beginn der Moderne die alte römische Kirche erschütterte, ging von der Idee aus, es gebe eine direkte Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Gott nimmt also auch ohne Vermittlung der Kirche jeden Einzelnen wahr und schätzt ihn.
Diese Bedeutung oder Wichtigkeit des Individuums im Sinne Luthers gab es bis dahin in der Kunst nicht. Die Menschen waren auf Gemälden eher Beiwerk in der Sakralkunst. Gesichter wurden geradezu schematisch dargestellt. Es galt als wichtiger, Gott, seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist darzustellen, die alles auf Erden beherrschten und lenkten. Die Renaissancekünstler hingegen präsentierten den Menschen in seiner unvergleichlichen Schönheit. Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo, Albrecht Dürer, Tizian und viele andere zeigten den Betrachtern zum ersten Mal ihr tatsächliches Ebenbild und entzogen es dadurch dem Mythos der »göttlichen Kreation«. Zwar blieb die religiöse Aufgabe der Kunst erhalten – schließlich war die Kirche meistens die Auftraggeberin –, aber die neuen Bilder signalisierten die gestiegene Bedeutung des Menschen in der Kunst. Die Künstler schufen ein Abbild der Menschen und nahmen ihnen so den Schleier einer Gotteskreation.
Diese berühmte Zeichnung von Leonardo da Vinci entstand 1490 und zeigt den männlichen Körperbau so detailliert wie realistisch.
Welche geschichtlichen Voraussetzungen führten dazu, dass es zur Aufklärung kam?
Viele Länder Europas waren in der Mitte des 17. Jahrhunderts nach dem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges in wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten geraten, Städte und Dörfer waren teilweise niedergebrannt, Familien dezimiert. Lange Zeit hatten marodierende Banden sich genommen, was sie wollten, und vielen Menschen die Lebensgrundlage entzogen. Mehr als vier Millionen Tote verringerten die europäische Bevölkerung auf etwa 70–75 Millionen. Während sich in England mit der »Glorious Revolution« 1689 Parlamentarismus und konstitutionelle Monarchie durchsetzten, begann in Frankreich die Epoche des Absolutismus. Französische Herrscher waren absolutistische Könige aus eigener Machtvollkommenheit, deren Untertanen sich politisch in keiner Weise einbringen konnten. In diesem Klima der Unfreiheit begannen vor allem in Frankreich, aber auch in anderen Ländern Europas, Philosophen darüber nachzudenken, wie diese den Fortschritt behindernden Strukturen überwunden werden könnten, um eine Atmosphäre des rationalen Denkens und Handelns zu schaffen. Sie wollten die Welt mit der Vernunft begreifen und Entscheidungen nach rationalen Kriterien fällen. Man könnte sagen, die Maxime der Aufklärer lautete: »Wissen statt Glauben«.
Zum ersten Mal fanden ihre Gedanken in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 Widerhall. In Frankreich trafen aufklärerische Ideen auf eine Situation großer gesellschaftlicher Ungerechtigkeit: Bauern und Handwerker hatten sämtliche Ausgaben des Staates zu tragen, Adel und Klerus hingegen waren von Steuern befreit. Dass diese unerträgliche soziale Lage ein Ende haben musste, war leicht zu vermitteln. 1789 mündete das in die Französische Revolution. Die Revolutionäre ließen innerhalb kurzer Zeit ihren Worten auch Taten folgen, indem sie ihre Vorstellungen teilweise mit brutaler Gewalt durchsetzten: Sie entmachteten den Adel sowie den Klerus, führten eine Säkularisierung durch, schafften Steuerprivilegien ab und beendeten – jedenfalls für einen gewissen Zeitraum – die Monarchie.
Was genau bedeutete »Aufklärung«?
Man könnte es sich einfach machen und den Satz von Immanuel Kant (1724–1804) zitieren, wonach die Aufklärung der »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« sei. Tatsächlich ist dies der prägende Satz der Aufklärung, und er beschreibt auch, was die Aufklärer eigentlich erreichen wollten. Solange dem Menschen durch das Definitionsmonopol der Kirche ein Verhaltenskodex vorgesetzt war, dessen Missachtung Sanktionen nach sich zog, war er eben »unmündig«. Um das Gegenteil zu erreichen, mussten die Menschen umfassend gebildet werden. Würde der »Glaube« (an die Kirche, den Papst und Gott) durch »Wissen« (über alle Zusammenhänge des Lebens) ersetzt, wäre der Mensch in der Lage, eine eigene Entscheidung zu fällen– und damit seine »selbst verschuldete Unmündigkeit« zu verlassen. »Habe den Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen«, formulierte Kant in seiner 1784 erschienenen Schrift »Was ist Aufklärung?«. Die Verwendung des Verstandes war auf gesicherte Erkenntnisse oder wissenschaftlichen Studien angewiesen, deshalb setzte die Aufklärung auch eine Verwissenschaftlichung der Welt in Gang. Überall sollte der Glaube durch Wissen ersetzt werden, Wissen musste gesammelt und den Menschen zugänglich gemacht werden.
Sichtbarster Ausdruck war die in der Mitte des 18. Jahrhunderts entstandene Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Die beiden Aufklärer Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert sowie 142 weitere Autoren trugen in 35 Bänden dieser »Enzyklopädie des Wissens«, die zwischen 1751 und 1780 erschien, das Wissen der damaligen Welt zusammen. Jeder konnte in diesem vielbändigen Werk nachlesen und erfahren, was die Welt zu dieser Zeit wusste, wie Waren hergestellt wurden oder nach welchen Prinzipien in den Manufakturen gearbeitet wurde.
150 Jahre später entwickelte der Soziologe Max Weber (1864–1920) den Begriff der »Entzauberung der Welt«: Die gestiegene »Intellektualisierung und Rationalisierung«, schrieb er, habe nicht nur die allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen verbessert, sondern auch die Überzeugung verbreitet, dass es »prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte« gebe, sondern dass man alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne. Das aber, so Weber weiter, »bedeutet die Entzauberung der Welt«. In dieser vollständig rationalen Welt war für die Kirche und den Glauben an einen Gott, die das genaue Gegenteil der Aufklärung darstellten, kein Platz mehr. Dementsprechend waren die Aufklärung und die Französische Revolution, in der einige Gedanken der Aufklärung politisch umgesetzt wurden, ein Frontalangriff auf Papst und Kirche.
Welche historischen Figuren waren besonders wichtig für die Aufklärung?
Ein paar Namen ragen heraus aus der Vielzahl der Philosophen, die die Aufklärung beeinflusst haben. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) aus Genf entwarf den »Gesellschaftsvertrag«, der als Ausdruck eines »idealen Gemeinschaftswillens« ein gesellschaftliches Organisationsmodell darstellte, dem sich der aufgeklärte Mensch aus eigenem und freiem Willen unterwerfen könne. Indem der Mensch sich freiwillig unterwerfe, sei er nicht mehr an den Willen der Obrigkeit gebunden, sondern handele aus eigener Überzeugung – so die optimistische Grundidee Rousseaus. In seinem pädagogischen Hauptwerk Emile oder über die Erziehung schilderte er die ideale Erziehung. Rousseau stellte sich darin einen Menschen vor, der als Erwachsener in der Lage sein wird, den Gesellschaftsvertrag zu schließen, weil er gelernt hat, dass er eigentlich sich selbst gehorcht, wenn er dem Gesellschaftsvertrag gehorcht.
Der Franzose Voltaire (1694–1778) gehört ebenfalls zu den wichtigsten Aufklärern – mitunter wird das 18. Jahrhundert als »das Jahrhundert Voltaires« bezeichnet. Er kritisierte den Absolutismus und die Feudalherrschaft in Frankreich, galt aber auch als schärfster Kritiker der katholischen Kirche. Die Ideen des Deutschen Immanuel Kant haben sowohl die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung als auch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 ebenso beeinflusst wie sämtliche demokratische Verfassungen der Neuzeit und die Deklaration der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen von 1948. Auch der Brite John Locke (1632–1704) ist von Bedeutung. Er lieferte die Grundlage einer demokratischen Verfassung, indem er sagte, dass eine Regierung nur dann legitim sei, wenn sie die Zustimmung der Regierten habe. Zudem müsse eine so legitimierte Regierung das Naturrecht auf Leben, Freiheit und Eigentum schützen.
Auf den Franzosen Montesquieu (1689–1755) geht das Prinzip der Gewaltenteilung zurück. Er studierte Aufstieg und Niedergang des Römischen Reichs und stellte anschließend fest, dass die Freiheit des Individuums garantiert werden müsse. Zudem könne eine Gesellschaft nur dann bestehen, wenn Legislative, Exekutive und Judikative strikt voneinander getrennt seien. Dieses Prinzip der Gewaltenteilung gilt bis heute in allen demokratisch verfassten Staaten.
Gehen wir in der Geschichte ein wenig weiter: Was passierte im 19. Jahrhundert – und wieso wird es eigentlich »lang« genannt?
Auch das ist unter Historikern durchaus umstritten. Manche bleiben beim kalendarischen Beginn und Ende des Jahrhunderts, andere verweisen darauf, dass wirkmächtige Ideen des 18. Jahrhunderts das 19. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst, ja geradezu vorherbestimmt hätten. Die beiden Revolutionen in Amerika und Frankreich von 1776 bzw. 1789 haben politische Ideen in die Welt gesetzt, die auch das folgende Jahrhundert geprägt haben: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit waren Fanfarenstöße, die über ganz Europa zu hören waren und zu vielen Revolutionen und Umsturzversuchen im 19. Jahrhundert führten.
Zudem war das 19. Jahrhundert von mindestens zwei Entwicklungen geprägt, die wiederum das 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflussten: der Industrialisierung und den Nationalstaatsbewegungen. Die Industrialisierung, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker verbreitete, machte viele der zeitgleich entstehenden Nationalstaaten zu Konkurrenten um Rohstoffe, Absatzmärkte oder Kolonien. Einige Historiker sehen im infolgedessen übersteigerten Nationalismus eine der wesentlichen Ursachen für den Ersten Weltkrieg (1914–1918), der die »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts war. Als Ergebnis dieses Weltkrieges wurde im Vertrag von Versailles 1919 u. a. festgehalten, dass Deutschland und Österreich/Ungarn die alleinigen Verursacher des Krieges gewesen seien. Die Nationalsozialisten riefen nach einer Revision dieses als »Schandfrieden« bezeichneten Vertrags und wollten diese im Zweiten Weltkrieg vollziehen.
Das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs war aber nicht die Revision des Vertrags von Versailles, sondern die Spaltung des europäischen Kontinents und die Teilung Deutschlands. Der nach 1945 im »Kalten Krieg« manifestierte Gegensatz zwischen Sozialismus und Kapitalismus bestimmte den größten Teil der weltweiten Nachkriegspolitik. Die politischen Revolutionen in vielen Ostblockstaaten leiteten 1989/90 das Ende des »Kalten Krieges« ein. Die Auflösung des ideologischen Antagonismus zwischen Ost und West revidierte einen Großteil der Ergebnisse der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts: Viele Staaten des Balkan wurden wieder gegründet, die deutsche und europäische Teilung wurde aufgehoben und die politischen wie ökonomischen Beziehungen zwischen Ost und West normalisierten sich. Insofern kann man sagen, dass das 19. Jahrhundert lang war und von 1776 bis 1914 reichte. Folgerichtig war das 20. Jahrhundert »kurz« und reichte unter diesem Blickwinkel nur von 1914 bis 1990. Derzeit deutet sich allerdings an, dass die politischen Entwicklungen seit den Anfangsjahren des 21. Jahrhunderts wieder zu einer Situation führen könnten, die der des »Kalten Krieges« ähnlich ist.
Welche Folgen hatte die Industrialisierung für Gesellschaft und Familie?
Das kann man nur erahnen. Der britische Historiker John Hobsbawm (1917–2012) hat gesagt, die Industrialisierung sei die gründlichste Umwälzung menschlicher Existenz gewesen, die jemals in schriftlichen Quellen festgehalten worden sei. Und diese »gründlichste Umwälzung« hat alle Teile der europäischen Gesellschaft massiv verändert. In Deutschland (bis 1866 im »Deutschen Bund«, dann im Norddeutschen Bund und schließlich ab 1871 im Deutschen Reich) sank der Anteil der Landarbeiter von 73 Prozent auf 38 Prozent, während der Anteil der städtischen Arbeiter von 17 Prozent auf 55 Prozent stieg. Das hatte Konsequenzen für Familien, die allein deshalb auseinandergerissen wurden, weil immer mehr Männer der Arbeit hinterherziehen mussten (in die Städte), aber ihre Familien oft nicht mitkamen. Denn in den Städten gab es anfangs für die Heerscharen der Arbeiter nicht genügend Wohnraum, keine Schulen und keine Infrastruktur.
Gleichzeitig wuchs die deutsche Bevölkerung zwischen 1780 und 1914 von 21 auf 68 Millionen, obwohl Millionen Deutsche in mehreren Ausreisewellen ihre Heimat verließen und in die USA auswanderten. Heute haben mehr als 45 Millionen Amerikaner deutsche Wurzeln. Der Anteil der unter 14-jährigen Deutschen lag bei 33 Prozent, während die über 60-Jährigen nur 6 Prozent der Bevölkerung ausmachten. In dieser Zeit hat es auch Hungerkatastrophen gegeben, weil zwischen 1816 und 1847 drei Missernten verkraftet werden mussten. Außerdem überschwemmte englische Massenware, die man aus billigen Rohstoffen aus den Kolonien hergestellt hatte, Teile der kontinentaleuropäischen Märkte. Das löste Absatzeinbrüche und Aufstände etwa der Weber in Schlesien aus.
Inwiefern ist das wichtig für die Frage nach der Emanzipation?
Die neuen gesellschaftlichen Strukturen infolge der veränderten Produktionsbedingungen fanden auch in sozialen Bewegungen ihren Niederschlag: 1849 entstand der erste »gewerkschaftliche« Verband bei den Druckern, rund 10 Jahre später wurde der »Industrie- und Handelstag« gegründet. Fortan standen sich Arbeiternehmer und Arbeitgeber nicht mehr unmittelbar gegenüber, sondern wurden durch Verbände und deren Funktionäre vertreten. 1865 wurde der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet, die Ziele klingen merkwürdig modern: Gleicher Lohn für Frauen und Bildungschancen verbessern. 1906 folgte die Gründung eines »Wandervogel-Ausschusses für Schülerfahrten in Berlin-Steglitz«. Die in dieser Bewegung versammelten Jugendlichen lehnten die Auswüchse der Industrialisierung mit ihrer Verstädterung und ihrem Materialismus ab, stattdessen propagierten sie den Rückzug in die Natur. Wenig später tauchten die ersten Reformpädagogen auf, die die überkommenen Erziehungsmethoden in Schule und Elternhaus ablehnten und die Jugendlichen frei von Zwang, ganzheitlich und gewaltfrei erziehen wollten. Bei ihnen lebte das Ideal der griechischen Antike wieder auf, nach dem der Mensch im Mittelpunkt der Pädagogik zu stehen habe und nicht die Erfüllung gesellschaftlicher Ansprüche.«
Matthias von Hellfeld lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Von Hellfeld ist außerdem Mentor und Vertrauensdozent der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie Geschichtsexperte in der Sendung »Eine Stunde History« bei Deutschlandfunk Nova.