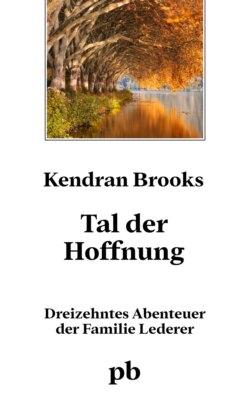Читать книгу Tal der Hoffnung - Kendran Brooks - Страница 4
Am Nachmittag
ОглавлениеKenia
»Haschib?«, die Stimme von Saleh klang brüchig und leise, drang nicht weit in die völlige Dunkelheit vor. Trotzdem bemerkte der Kenianer eine Regung neben sich, wiederholt lauter, »Haschib?«
»Ja … was ist … passiert?«, kam es stockend zurück.
Saleh wusste es nicht, versuchte sich zu erinnern. Da war die Diskothek, der wilde Tanz, die ausschweifende Sex-Orgie, die er und sein Liebhaber begeistert mitgefeiert hatten. Doch was kam danach? Einer wollte noch woanders hin, erinnerte sich Saleh, eine weitere, private Party. Sie kannten den dreißigjährigen Mann nicht, der sie angesprochen hatte, waren trotzdem begeistert mitgegangen. Man führte sie durch einen Nebenausgang auf den Parkplatz, ließ sie in einen noblen Wagen steigen. Ein älterer Mann hatte bereits hinten gesessen, machte ihnen Platz, lächelte sie erwartungsvoll an. Und er hatte auch eine Flasche Whiskey dabei, eine teure amerikanische Marke. Sie tranken ihm zu, auch wenn sie sexuell mit altem Fleisch wenig am Hut hatten. Doch der Herr, und das war der distinguiert wirkende, gut gekleidete Mann mit Sicherheit, versprach viele andere junge Leute in seiner Villa auf dem Land. Sie mussten irgendwann während der Fahrt eingeschlafen sein und erwachten nun in diesem dunklen, kühlen Raum und mit dröhnenden Köpfen.
»Wo sind wir?«, fragte Haschib und Saleh blickte sich suchend um. In Bodennähe war nichts zu erkennen. Blickte man jedoch nach oben, so erkannte man einen sehr hohen Raum, dessen Dach nicht lückenlos aufsaß, so dass an manchen Stellen ein klein wenig Licht einfiel, das aber nicht bis zu ihnen hinunter reichte.
»Weiß nicht.«
»Man hat uns betäubt«, stellte Haschib klar und schien seinen Kopf ungläubig zu schütteln, stöhnte gleich danach auf, »ich glaub meine Birne platzt gleich.«
»Geht mir genauso.«
»Der freundliche alte Knacker. Hat der uns etwa betäubt? War was im Whiskey?«
Haschib konnte dermaßen dämlich fragen, fand Saleh, nickte trotzdem und zuckte unter dem Schmerz in seinem Schädel erneut zusammen.
»Wer sonst?«, nuschelte er mehr als dass er es aussprach.
»Was will der denn von uns? Bist du auch gefesselt?«
»Ja.«
Saleh versuchte, den Strick um seine Handgelenke zu sprengen, ohne Erfolg. Er zog die Beine an, rollte auf die Knie, versuchte aufzustehen, sackte mit einem zuckenden Schmerz in seinem Kopf wieder zusammen.
»Oh, verdammt«, keuchte er, versuchte es erneut, kam diesmal hoch und auf die Füße.
»Wie lange liegen wir hier wohl schon?«
»Keine Ahnung. Wahrscheinlich Stunden.«
Äußerst vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter, tastete sich Saleh in der völligen Dunkelheit in eine Richtung voran, entfernte sich von Haschib. Nach wenigen Metern stieß er bereits gegen eine Wand, drehte sich um und befingerte sie mit seinen gebundenen Händen, fühlte roh behauene Quader.
»Hier ist eine Mauer aus großen Steinen«, meldete er in Richtung Haschib.
»Ein Keller?«, vermutete der und schien sich nun ebenfalls erheben zu wollen.
»Ich geh mal der Wand entlang«, informierte Saleh seinen Liebhaber, und folgte mit den Fingern fühlend der Mauer, stieß nach einer Weile auf die Holzfüllung einer Tür. Er tastete sich weiter vor, fand einen Knopf, drehte ihn ohne Erfolg. Das Schloss war wohl abgesperrt.
»Hier ist eine Tür, aber abgeschlossen«, meldete er seinem Freund Haschib, ging danach weiter.
Die Wand des Kellerraums, der eher ein Turm war, führte Saleh nach fast endlos lang empfundener Zeit wieder zur wohl selben Türfüllung, ohne dass Saleh etwas anderes als Stein gefühlt hatte, was er Haschib vermeldete. Der saß oder stand wahrscheinlich immer noch in der Mitte des Raums, wo man sie beide bewusstlos abgelegt hatte, beteiligte sich weiterhin nicht an der Suche nach einem Ausgang oder Fluchtweg.
»Warum haben die uns bloß kassiert und eingesperrt?«, wunderte sich Saleh.
»Wie spät es wohl ist? Sollen wir mal rufen?«
»Um Hilfe?«
»Warum nicht? Irgendetwas müssen wir unternehmen.«
Gemeinsam bemühten sie ihre Lungen, schrien sich die Kehle wund, verstummten immer wieder, horchten nach Antwort, auf Schritte oder wenigstens irgendein Geräusch von draußen. Doch alles blieb still.
»Ich hab einen wichtigen Termin am Nachmittag«, meinte Saleh, »Professor Endogo wollte mir mitteilen, ob er mich in sein neues Projekt übernimmt«, jammerte der Architektur-Student nach einer Weile.
»Den hast du bestimmt längst verpasst«, meinte Haschib niedergeschlagen, »was werden die bloß zu Hause denken?«
Und wie auf Kommando schrien und krächzten sie erneut nach Hilfe.
»Niemand in meiner Familie darf erfahren, dass ich schwul bin«, jammerte Haschib, als sich weiterhin nichts tat.
»Bei mir dasselbe. Die werden sich doch längst riesige Sorgen machen. Bisher bin ich immer spätestens zum Mittagessen zu Hause erschienen«, meinte Saleh niedergeschlagen.
Die beiden Freunde schwiegen, hatten sich längst wieder gesetzt oder hingelegt, fragten sich, ob man sie hier elend zugrunde gehen ließ.
*
Schweiz
»Wunderbar. Genau so, wie ich es mir vorgestellt haben. Antoine, Sie sind ein Genie.«
Alabima Lederer blickte in den großen Spiegel, drehte ihren Kopf nach links und dann nach rechts, besah sich mit Wohlgefallen ihre neue Frisur. Der schwule Friseur Antoine stand knapp hinter ihrem Stuhl und strahlte sie mit seinen hellblauen Augen und einem stolz-süßen Lächeln an, hielt noch in seiner linken Hand den Trockner lässig in die Höhe, in der rechten die Bürste, mit denen er den Haaren seiner Kundin den allerletzten Schliff verliehen hatte.
Alabima war die Ehefrau und Lebensgefährtin von Jules Leder, einem Selfmade-Millionär, der sich sein Geld in früheren Jahren mit der Erledigung von heiklen und gefährlichen Aufträgen für eine reiche Klientel verdient hatte. Die aparte, dunkelhäutige Frau stammte aus Äthiopien, gehörte zum Stamm der Oromo, hatte Medienwissenschaften in Addis Abeba studiert und als Radiomoderatorin gearbeitet. Vor zwölf Jahren lernte sie Jules Lederer kennen und lieben. Die beiden heirateten, adoptierten den damals fünfzehnjährigen philippinischen Waisenjungen Chufu, bekamen ein Jahr später ihre Tochter Alina. Chufu lebte allerdings schon seit einigen Jahren in Rio de Janeiro, wo er zusammen mit seiner Freundin Mei Ling Psychologie studiert hatte. Mei war eine chinesisch-stämmige Brasilianerin. Ihre Eltern betrieben eine Kette von Restaurants und galten als ähnlich vermögend wie die Lederers. Seit dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums arbeiteten Chufu und Mei für eine Universitätsklinik und versorgten dort traumatisierte Kinder aus zerrütteten Familienverhältnissen. Sie waren jedoch weiterhin auf der Suche nach ihrer wahren Berufung und Bestimmung, die sie wahrlich nicht in einer Lohnarbeit für einen Staatsbetrieb sahen.
Alabima und Jules Lederer lebten zusammen mit ihrer fast 10-jährigen Tochter Alina in einer großzügigen Villa direkt am Ufer des Genfersees in der Ortschaft La Tour-de-Peilz, unweit der Kleinstadt Lausanne, wo Antoine, der schwule Friseur von Alabima, schon viele Jahre lang seinen Salon betrieb.
Die Äthiopierin hatte an diesem Vormittag nicht mehr viel vor. Sie wollte noch ein wenig durch die Stadt bummeln, auf dem Markt Gemüse und Früchte kaufen, vielleicht noch kurz im Café Saint Pierre vorbeischauen, bevor sie wieder nach Hause fuhr. Schon seit vielen Jahren ließ sie ihr langes, schwarzes Haar glätten und in sanfte Wellen legen, hatte sich diesmal jedoch für eine deutlich kürzere und damit frechere Frisur entschieden. Und nun blickte ihr aus dem Spiegel eine weitaus jüngere und damit attraktiver erscheinende Frau an. Entsprechend aufgeräumt und in Hochstimmung fühlte sich die Frau, die wohl gegen die vierzig ging.
Was würde wohl ihr Jules zu seiner neuen Alabima sagen?
Sie seufzte innerlich nun doch auf, als sie an ihren Ehemann dachte. Die beiden hatten in ihren gemeinsamen zwölf Jahren schon manchen steinigen Weg gehen müssen, hielten jedoch weiterhin aneinander fest, ob aus Gewohnheit oder aus Liebe. Wer mochte das entscheiden? Zumindest der früher wirklich tolle Sex und selbst der Austausch gewöhnlicher Zärtlichkeiten hatten in den letzten Jahren merklich nachgelassen. Doch das war wohl der Zahn der Zeit in jeder guten Ehe, dachte sich die Frau.
Sie bezahlte mit der Karte, schaute sich noch einmal kontrollierend im Spiegel an der Tür an, lächelte glücklich auf und schritt in die Welt hinaus, ganz im Bewusstsein, erneut viele bewundernde und durchaus auch neidische Blicke auf sich zu ziehen, denen sich alle attraktiven Menschen nun einmal ständig ausgesetzt sahen.
Sie schlenderte den Gehsteig entlang, blickte in die Auslagen der Geschäfte, musterte ab und zu die Passanten, traf auf keine Bekannten. Zwei junge Männer kamen ihr entgegen, schienen etwas heftig miteinander zu diskutieren, waren völlig in ihrem Gespräch vertieft, hätten die Äthiopierin beinahe umgerannt, wichen ihr im letzten Moment doch noch geschickt aus und umrundeten sie, ließen ein knappes »Excusez-moi, Madame« hören, gingen auch schon weiter, ohne sie richtig angesehen zu haben. Alabima hatte sich umgedreht und schaute den zwei amüsiert nach, betrachtete sich ihre strammen Hintern, lachte gleichzeitig ein wenig irritiert auf, weil die beiden jungen Männer so gar nicht auf ihre aparte Erscheinung angesprochen hatten. So zuckte sie kurz mit ihren Schultern und ging beschwingt weiter die Ladenfront entlang.
Vermehrt achtete sie nun aber auf die anderen Passanten, wie sie von ihnen gemustert oder gar taxiert wurde. Die Ausbeute fiel bescheiden aus, wie sie sich verwundert eingestand. Ihre neue Frisur schien niemanden anzusprechen. Dabei sah sie mit ihr doch so viel jünger und noch attraktiver aus?
»Na, wenn schon«, sagte sie laut zu sich selbst, betrat das Café Saint Pierre und setzte sich an einen freien Tisch am Fenster, bestellte sich einen Cappuccino, denn die Uhr hatte noch nicht halb elf Uhr vormittags geschlagen. Der Mann hinter dem Tresen war keine dreißig. Ihn hatte sie hier noch nie gesehen, obwohl sie doch jeden Monat ein paar Mal hier hereinschaute. Und so fragte sie ihn, als er ihr den Milchkaffee an den Tisch brachte: »Sie sind neu hier, Monsieur? Wann haben Sie angefangen?«
»Hier«, meinte er auf Französisch und damit gestern, »heute ist mein zweiter Tag.«
»Und Sie schmeißen den Laden bereits ganz alleine? Wow«, wunderte sie sich ein wenig gespielt theatralisch. Der junge Mann verzog keine Miene, sondern warf sich in seine schmächtige Brust: »Ich bin ausgebildeter Barista, Madame.«
»Aha«, erwiderte die Äthiopierin mit einem etwas schrägen Lächeln, denn dass auch dieser Kerl so überhaupt nicht auf ihre aparte Erscheinung reagierte, sondern sie wie einen durchschnittlichen Gast behandelte, irritierte sie nun doch. Normalerweise wurden in solchen Situationen wenigstens ein paar tiefere Blicke ausgetauscht, man lächelte sich wissend zu und gab sich so gegenseitig anerkennend zu verstehen, wie sehr einen das Aussehen des anderen überzeugte. Doch auch dieser Mann reagierte nicht auf ihre neue Frisur und ihr verjüngtes Aussehen.
Waren ihre Haare unbemerkt verrutscht oder gar zerzaust? Hatte sich die Frisur aus irgendeinem Grund aufgelöst?
Der Barista verzog sich wieder hinter seine Theke und Alabima kontrollierte ihr Aussehen mit Hilfe des kleinen Spiegels in der Puderdose ihrer Handtasche. Alles saß perfekt wie zuvor im Salon. Wiederum erblickte sie eine weitaus jüngere Ausgabe von sich selbst, zuerst durchaus skeptisch, dann aber doch wieder äußerst selbstbewusst und zufrieden.
War die gesamte Männerwelt über Nacht etwa schwul geworden?
Sie musste über ihren Gedanken lächeln. Und nun freute sie sich erst recht auf das Nach-Hause-Kommen und auf die Reaktionen von Jules. Er würde die Veränderung an ihr bestimmt erkennen und auch lieben. Denn welcher Ehemann hielt nicht gerne eine verjüngte Ausgabe seiner Lebenspartnerin im seinen Armen und später im Bett?
Sie trank rasch aus, bezahlte, eilte über den Markt und kaufte ein, fuhr danach direkt nach Hause.
*
Philippinen
An diesem frühen Morgen war einige Aufregung in den Räumen der U.P. zu spüren und zu sehen. Professoren eilten aus ihren Büros und durch die Gänge, strebten alle dem größten Vortragssaal zu. Studenten sammelten sich vor den Gebäuden, gaben sich meist lässig und unaufgeregt, ließen ihre Anspannung trotzdem erkennen, in ihren erwartungsvoll blickenden Augen, den lockeren Sprüchen, der gespielten Unbekümmertheit. Denn heute besuchte Präsident Rodrigo Duterte die University of the Philippines, hielt vor Lehrkörper und Studierenden eine Rede, wollte sich angeblich hinterher gar den freien Fragen der Zuhörer stellen.
Rodrigo Duterte war kein unbestrittener Mann an der Spitze seines Landes. Als Bürgermeister der Millionenstadt Davao City hatte er sich einen Namen als überharter Kämpfer gegen die Kriminalität gemacht. Mehr als eintausend Menschen waren durch Todesschwadronen, die Duterte schützte oder gar unterstützte und organisierte, umgekommen, die meisten von ihnen Kleinkriminelle aus armen Stadtteilen. Und im Präsidentschaftswahlkampf gab er als Ziele seiner Amtszeit die Ermordung von mindestens 100´000 Kriminellen an, die Wiedereinführung der Todesstrafe, die Auflösung des Kongresses und die Einsetzung einer Revolutionsregierung, wobei alle Beamte und Offiziere freiwillig ihre Posten räumen sollten, um sie durch fähigere zu ersetzen. Er bezeichnete Papst Franziskus als Hurensohn, nannte die Mutter des US-amerikanischen Präsidenten Obama eine Hure. Seitdem er mit 39% der Stimmen zum Präsidenten gewählt worden war, starben bereits viele Tausende von Drogensüchtige und Kleinkriminelle im ganzen Land. Sie wurden regelrecht hingerichtet, von Todesschwadronen, aber auch von Polizei und Militär. Die hatten die präsidiale Anweisung, stets gezielt zu töten und keine Warnschüsse abzugeben. Niemand wurde auf den Philippinen für die Ermordung dieser vielen Menschen verfolgt oder gar angeklagt. Und die Bevölkerung nahm diese Art der Säuberung nicht nur hin. Die Mehrheit begrüßte sie sogar. Duterte war beliebt, für seine schnoddrige Art, für seine Frechheiten, trotz seiner Nähe zum wiedererstarkten Familienclan der Marcos, die zu ihrer Zeit so viel Elend unter der Bevölkerung auslösten.
Die Mehrzahl der Professoren und Studierenden der U.P. gehörten allerdings nicht zu den Anhängern des neuen Präsidenten. Sie hatten die zunehmende Verrohung in der Bevölkerung längst auch empirisch festgehalten. Während der Einfluss der katholischen Kirche von Rodrigo Duterte systematisch zurückgedrängt wurde, beispielsweise durch seine Anti-Diskriminierungs-Verordnung gegenüber Homosexuellen, Transgendern und Behinderten. Allein die seltsame Vermischung dieser Minderheiten zeigte die wahre Gesinnung dieses Präsidenten auf, der sich selbst gar mit Adolf Hitler verglich.
Es ging gegen neun Uhr und die Studenten strebten nun ebenso dem Vortragssaal zu, wo die Sitzplätze rasch belegt waren und sich auch die Treppenstufen und die Gänge dazwischen immer mehr füllten. Um halb zehn trat Präsident Duterte auf. Zuerst betraten zwei finster blickende Body-Guards die Bühne über einen Seiteneingang, wohl um sie zu sichern. Sie hätten bestens in jedem Film als skrupellose Gangster auftreten können. Dermaßen arrogant und brutal wirkten sie auf die Anwesenden. Nur Sekunden später stürzte Duterte herein, winkte den Studenten leutselige zu, schüttelte einigen Professoren die Hände, trat ans Rednerpult.
Eine volle Viertelstunde lang traktierte er die Versammlung mit einem endlos scheinenden Redeschwall. Er sprach kurz seine bisherige Amtszeit an, die großen Erfolge gegen die Kriminalität, die Wiedereinführung der Todesstrafe als wirksames Mittel gegen das Bandenunwesen, aber auch ein paar soziale Errungenschaften, die zwar nach Meinung von Experten kaum Wirkung zeigten, die trotzdem als wichtige Meilensteine für das Land dargestellt wurden. Nach dieser Einleitung kam er auf den Westen zu sprechen, insbesondere auf die USA und ihren neuen Präsidenten, aber auch auf Europa und Japan. Er bezeichnete alle diese Länder als Schmarotzer Asiens, als Blutsauger, als Vampire am philippinischen Volk und anderen Nationen. Und er lobt im gleichen Atemzug China, seine kluge Führung, das vorbildliche Volk. Selbst auf Nordkorea und seine Bedrohung kam er zu sprechen, milderte jedoch seine früheren Worte, geißelte dafür die viel zu große Präsenz des US-Militärs in den asiatischen Gewässern.
»Die Aggressionen des Westens sind beispiellos«, übertrieb der Präsident wie so oft, »und falls in unserer Weltregion ein Krieg ausbrechen sollte, dann werden dafür einzig die imperialen Drohgebärden der USA und seiner westlichen Verbündeten verantwortlich sein.«
Duterte schob eine Kunstpause ein, erwartete von der versammelten Menge für diese ungeheuren Anschuldigungen Applaus und lärmende Zustimmung. Einige Studenten und zwei der Professoren klatschten tatsächlich in die Hände. Der Rest ließ sich jedoch keineswegs anstecken, hielt mehrheitlich und demonstrativ ihre Arme verschränkt, so, wie sie es vorgängig abgesprochen hatten, zeigten ihrem Präsidenten, wie wenig sie von ihm hielten. Doch Rodrigo Duterte ließ sich nicht beirren, im Gegenteile. Er grinste seine Zuhörer an, zeigte dabei seine Zähne wie ein Wolf seinen Fang, so als wollt er sie jeden Moment anspringen und zerreißen, wandte sich auch zu den Professoren um, betrachtete sie, als müsste er sich ihre Gesichter einprägen. Dann stellte er sich wieder vors Pult, umfasste die Kanten der Notiz-Auflage mit beiden Händen, blickte die Studenten zwingend an.
»Wer weiterhin glaubt, der Westen wäre unser Freund, unser Verbündeter, der hat nicht erkannt, wie hinterlistig er gegen uns operiert. Die US-Basen in unserem Land beispielsweise sind Ausgangspunkte subversiver Tätigkeiten in der gesamten Region. Ich habe mit Präsident Trump darüber gesprochen. Er wollte sich darum kümmern, hat es mir versprochen. Doch bislang ist nichts dergleichen geschehen. Weiterhin stiften die Geheimdienste der USA immer wieder Unfrieden zwischen den Südost-asiatischen Ländern. Nehmen wir als Beispiel nur die nachvollziehbaren Ansprüche des großen Chinas im südchinesischen Meer und die Haltung der US-Amerikaner und Japaner. China war über viele Jahrhunderte unsere Schutzmacht und wir pflegten eine tiefe Freundschaft. Und seit die dortige Regierung das Land zunehmend öffnet und so ihre früheren, kommunistischen Doktrin aufweicht, kann China wieder zum großen Freund und Bruder aller asiatischen Nationen werden. Die Zukunft der Philippinen liegt auch und nicht zuletzt in China.«
Fassungslosigkeit hatte sich in vielen Gesichtern breit gemacht. Rodrigo Duterte schien den Verstand verloren zu haben. China war doch der wirkliche Aggressor im südchinesischen Meer, schüttete sogar künstliche Inseln auf, um von ihnen immer noch größere Seerechte abzuleiten. Was für eine seltsame Freundschaft entwickelte sich da zwischen ihrem Präsidenten und der Großmacht China? War das zum Wohle des Landes und des Volkes? Und warum vergraulte Duterte die US-Amerikaner? Wollte er die beiden Gegner gegenseitig ausspielen, um lukrative Freihandelsabkommen zu erzwingen? Zumindest die Wirtschaftsstudenten dachten und hofften auf einen solchen Plan. Denn weitere Zoll-Erleichterungen gegenüber den mächtigen Nationen der Erde zahlten sich mit Sicherheit aus. Vielleicht deshalb applaudierten nun weitaus mehr Anwesende, als Duterte erneut eine kurze Redepause einlegte. Viele der Zuhörer erwarteten nun zusätzliche Ausführungen, womöglich konkrete Schritte oder die Aufzeichnung des zukünftigen Wegs dieser Regierung. Doch stattdessen meinte der Präsident nur, dass er leider wichtige Termine wahrzunehmen hätte und man deshalb die Fragestunde ausfallen lassen müsste, was er unendlich bedauerte.
Dreißig Sekunden später waren Duterte und seine Leibwächter entschwunden und Professoren und Studenten saßen und standen entsprechend verunsichert und ratlos herum.
Danilo Concepcion, der Präsident der Universität, stellte sich ans Rednerpult und löste die Versammlung offiziell auf, ermahnte alle Anwesenden, dass am Nachmittag der ordentliche Universitäts-Betrieb ab dreizehn Uhr wieder starten sollte.
*
Brasilien
Sihena war die Mutter von Mei Ling. Der Vater hieß Zenweih. Die beiden Elternteile betrieben eine gut gehende Kette von China-Restaurants in Rio de Janeiro, mit einigen Ablegern in weiteren Großstädten Brasiliens. Die Lings waren wohlhabend, für hiesige Verhältnisse ausgesprochen reich. Doch Sihena und Zenweih waren nur noch geschäftlich ein Paar, hatten sich privat schon lange nichts zu sagen, hatten sich vor Jahren getrennt und waren in der Zwischenzeit geschieden worden. Seitdem spielte Sihena mehrheitlich die stille Teilhaberin, bekam jeden Monat ihren Check und Ende Jahr die Abrechnung mit ihrem Gewinnanteil, lebte und liebte den Müßiggang, genoss ihr Vermögen.
Während sich Zenweih eine luxuriöse Penthouse-Suite in einem Geschäftsviertel der Stadt leistete, bewohnte Sihena weiterhin die Familien-Villa in einem ruhigen Quartier, wo sich hinter hohen Mauern ein großes Anwesen an das nächste reihte. Fünf ständige Angestellte umsorgten die Frau. Neben dem Chauffeur und dem in Rio notwendigen Wächter und Bodyguard gab es einen fest angestellten Gärtner für den großen Park. Die Köchin Marta Gonzales-Vinerva und die Zofe Naara Huaterdo besorgten den Haushalt. Beide arbeiteten schon seit vielen Jahren für die Lings. Der Gärtner, der Chauffeur und der Hauswächter waren dagegen in den letzten Monaten ausgewechselt worden. Denn Sihena hatte das beklemmende Gefühl, von ihnen im Sinne ihres geschiedenen Mannes überwacht und ausspioniert zu werden. Das war zwar reine Einbildung von Sihena, doch wer konnte schon mit der Angst leben, ständig beobachtet zu sein? Da half auch die Fürsprache von Marta nichts, nein, im Gegenteil. Die gute Seele bekam von Sihena zu hören, auch sie könnte jederzeit gehen, wenn ihr die Entscheidungen der Herrin des Hauses nicht schmeckten. Marta war ebenso verstummt, wie Naara schweigend zugehört hatte. Beide Frauen lebten in wenig ersprießlichen Beziehungen. Die verheiratete Marta musste zu Hause einen Säufer versorgen, der ihr den Verdienst stahl und vertrank und sie sogar schlug, wenn sie sich dagegen wehrte. Und Naara wurde fast regelmäßig von ihren wechselnden festen Freunden betrogen und ausgebeutet. Denn auch wenn die junge Frau von Ende zwanzig nicht schlecht aussah und zudem über ein zwar tiefes, dafür regelmäßiges Einkommen verfügte, so war sie einfach nicht zum Heiraten bestimmt. So jedenfalls dachte mittlerweile das Mädchen fürs Putzen und Waschen und Bettenmachen und und und ...
Das Leben war hart. Doch vielen Brasilianern ging es weit dreckiger. Was sollte man sich da über die Arbeitgeberin oder die Umstände oder die geringe Bezahlung aufregen? Denn eines blieb einem doch stets, nämlich die Hoffnung, dass es irgendwann besser wurde, der Säufer endlich an Leberversagen starb oder einer der wechselnden Freunde sich doch irgendwann zur Ehe durchrang.
»Unser Leben ist wie das Wandern durch ein Tal der Tränen«, hatte Köchin Marta dem Dienstmädchen Naara eines Nachmittags erklärt. Sie saßen zusammen in der Küche, genossen gemeinsam ihre fünfzehn Minuten gewerkschaftlich durchgesetzte Pause, hatten sich eine Tasse Kaffee gemacht, die ihnen Sihena vorsorglich und von Beginn an vom Lohn abgezogen hatte, auch wenn sie nicht jeden Tag einen tranken.
»Oder ein Wandern durch ein Tal der Hoffnung?«, fragte die nicht einmal halb so alte Naara die Köchin von Mitte fünfzig.
»Für dich mag es ja noch Hoffnung geben«, meinte Marta und wirkte verdrießlich, was so gar nicht zur meist gut gelaunten, den Schmerz und die Schmerzen verdrängende Brasilianerin passte, »doch in meinem Alter wird alles immer nur noch schlimmer und schlechter.«
»Wieso denn das?«, fragte Naara zurück, auch wenn sie die Antworten darauf längst von früheren Nachmittags-Pausen kannte.
»Solange mein Alter lebt, macht er mich zur Schnecke. Und stirbt das Scheusal endlich, flieg ich mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Wohnung. Sie gehört einem Verwandten von Marinos und der droht uns ständig mit Rausschmiss, weil er sie zu einem weit höheren Preis vermieten könnte, wie er immer behauptet.«
Naara sagte nichts darauf, wusste auch so, was gleich folgen musste.
»Entweder geschlagen werden oder obdachlos sein. Was ist das schon für ein Leben?«
»Aber Marta«, warf nun Naara doch noch ein und wiederholte das, was sie schon so manches Mal zur Köchin gesagt hatte, »du siehst alles viel zu negativ, viel zu schwarz. Du bist doch eine gute Köchin? Du könntest ein eigenes Restaurant eröffnen und hättest bestimmt großen Erfolg«, und ebenso wie in ihren früheren Gesprächen driftete die junge Frau an dieser Stelle auch schon in ihre Tagträume ab, »und ich serviere für dich und werde den Männern so richtig einheizen, damit sie immer wiederkommen und uns beide reich machen.«
Nun war es an Marta Gonzales-Vinerva zu schweigen, was sie auch tat.
Manches Mal sprach sie allerdings von »du gutes Kind« und von »wunderschönen Träumen, die nicht wahr werden können«, weil sie niemals das Geld für ein eigenes Lokal zusammensparen konnten und niemand ihr eine derart große Summe vorstrecken würde.
Ja, vor ein paar Jahren, als Zenweih die Villa verließ, da hatte auch Marta noch gehofft, dass er sie in sein neues Penthouse mitnehmen würde, ja dass sie beide auf diese Weise von der schrecklichen Sihena loskommen könnten. Doch schon bald wurde ihnen schmerzlich bewusst, dass weder Naara, noch sie ein solches Glück verdient hatten.
Selbstverständlich versuchen beide Angestellte immer wieder, in einem anderen wohlhabenden Haus zu einem besseren Lohn unterzukommen. Sie hatten im Internet die Stellenangebote durchsucht, sich auch über Bekannte erkundigt. Mancher Arbeitsort klang verlockend und die Bedingungen schienen ausgezeichnet. Dann wieder hörte man von irgendwoher irgendwelche Gerüchte, über Schläge und andere Misshandlungen, über ausgebliebene Bezahlung und ständige Überstunden ohne zusätzliches Geld.
»Was man hat, das hat man«, war so ein Spruch von Marta, die sich genötigt sah, Naara immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück zu holen, wenn die junge Frau von all den Möglichkeiten in anderen Häusern schwärmte, von einer besseren Zukunft, mehr Geld und weniger Schelte.
»Alle diese Geldprotze gehen doch mit uns kleinen Leuten wie mit Abfall um«, meinte die Köchin, »für die sind wir kaum mehr als Tiere. Erst letzte Woche stand in den Zeitungen wieder ein solcher Fall. Hübsches Dienstmädchen, vergewaltig, erdrosselt und danach in einem Straßengraben entsorgt. Die Familie ihres Arbeitsgebers wusste selbstverständlich von nichts. Und die Polizei schaute weg, nahm noch nicht einmal Sperma-Proben von den männlichen Angehörigen des Arbeitgebers, um sie mit den Proben an der vergewaltigten Leiche zu vergleichen. Kleine Leute sind kleine Leute, weil sie niemanden kümmern und sich niemand um sie kümmert. So ist das.«
»Nicht alle reichen Leute sind böse«, warf Naara ein, »Isabella, du kennst sie doch?«, und Marta nickte stumm und kurz, »also Isabella erzählt mir Dinge über die Franchescos«, und die junge Frau verdrehte träumerisch ihre Augen, »tolle Feste und ausschweifende Partys, mit hunderten von Gästen und darunter immer wieder auch junge Männer, die ihr deutliche Avancen machen.«
»Na und? Jeder von denen fickt zwischendurch gerne mal ein hübsches Dienstmädchen, wenn es nur leichtsinnig und naiv genug ist, seine Beine zu spreizen«, warf Marta griesgrämig ein.
»Gar nicht wahr«, maulte Naara, »mit einigen ist Isabella bis heute befreundet. Und sie wurde auch schon eingeladen, auf eine Jacht oder in ein Ferienhaus.«
Nun war es an Marta, ihre Augen zu verdrehen, jedoch nicht verzückt, sondern genervt.
»Am Ende werden die jungen Dinger schwanger und danach entsorgt, so wie dieses Dienstmädchen von letzter Woche in der Zeitung. Mach dir nichts vor, Naara. Wir stehen ganz unten auf der Leiter zum Glück und wir beide werden nie auch nur eine Sprosse auf ihr hochsteigen. Glaub´s mir.«
So oder ähnlich liefen die meisten Gespräche der beiden ab, sofern sie sich nicht um ihre direkten Sorgen und Nöte drehten, sondern von Träumereien.
Während die beiden in der Küche unten saßen und redeten, hatte sich Sihena nach ihrem Entspannungs-Schlaf nach dem Mittagessen aus ihrem Bett erhoben, hatte sich nackt, wie sie war, vor den großen Spiegel gestellt und ihre Figur prüfend betrachtet.
Ja, sie war über fünfzig, hatte etwas dicke Oberschenkel, befand sich, wie seit ihrer Jugend, als zu klein, zu gedrungen, mit zu runden Schultern und zu schlaffen Brüsten. Und doch. Sie wurde immer noch begehrt. Nicht nur von den jungen Männern, die sie sich ab und zu kaufte. Denn zumindest gab es den Einen, der sie von ganzem Herzen liebte, der ihr richtiggehend hörig geworden war, seit sie das Spektrum ihrer eigenen sexuellen Begierde ganz auf die Bedürfnisse dieses Mannes ausgerichtet hatte.
Roberto della Montoya hieß er, sah gut aus und trat auf wie ein Spanischer Grande, war intelligent und besaß perfekte Umgangsformen, war ein wichtiger Beamter im Dienste der Botschaft Argentiniens.
Leider war ihr Roberto verheiratet, derzeit noch liiert mit irgendeiner adligen Pute aus der Hauptstadt, die immer noch in Buenos Aires lebte und ihrem Mann nicht nach Brasilien gefolgt war. Doch die Scheidung lief längst, hatte Roberto ihr anvertraut. Schon in wenigen Monaten konnte er frei sein, für sie und für eine gemeinsame Zukunft.
Roberto liebte so richtig versauten Sex, der durchaus mit Perversitäten gewürzt sein durfte. Je mehr, desto besser. Fesselungen und Peitsche, das hatte Sihena auch schon früher mit ihren gekauften Liebhabern ausprobiert. Sado-Maso hatten ihr jedoch kaum Lustgewinn gebracht. Sie selbst sollte doch im Mittelpunkt des Geschehens stehen, nicht der Mann. So jedenfalls dachte die chinesisch-stämmige Brasilianerin bis heute. Aber nun hatte sie ihre Spiele ganz auf ihren Roberto ausgerichtet.
Was konnte der Mann denn dafür, dass er sich gerne von einer Frau mit dem Umschnalldildo ficken ließ? Es gefiel ihm nun mal, in die Rolle einer kleinen, dreckigen Nutte zu schlüpfen, sich dazu auch Netzstrümpfe, BH und Hochhackige anzuziehen. Und schlecht sah der Argentinier in dieser Kleidung nun wahrlich nicht aus. Mit seiner stark gebräunten Haut, dem flachen Bauch, den ansehnlichen Muskeln an den Oberarmen und der gewölbten Brust, den schlanken, langen und festen Schenkeln. Und sie bekam doch auch von ihm immer all das, was sie sich nur wünschte. Sein Penis war zwar nicht der mächtigste. Doch dafür fleißig und ausdauernd, zumindest mit Hilfe der kleinen, blauen Pillen. Und wenn er auf ihr lag und sie so richtig rammelte und sie mit ihren Händen seine festen Po-Backen umfasste und so spürte, mit welcher Kraft er in sie eindrang, dann konnte sie sich doch fast immer einen Höhenpunkt erdenken, irgendwie ergründen oder ihm zumindest glaubhaft vorspielen.
War doch auch nichts dabei, wenn man sich zwischendurch von einem professionellen Frauenbeglücker in die höchsten Wonnen hochschaukeln ließ, während man zu Hause eher schmale Kost bekam? Denn Roberto della Montoya sah einfach hinreißend aus, mit kühner Nase und scharf blitzenden, schwarzen Augen, die manchmal auch ausgesprochen lüstern oder gar unterwürfig blickten, wenn sie ihn mit dem künstlichen Schwanz genüsslich fickte.
Sihena malte sich, während sie sich immer noch vor dem Spiegel rekelte und streckte, ihre Brüste hoch schob oder ihren etwas faltigen Bauch kritisch betrachtete, wie ihr Leben in wenigen Wochen oder Monaten aussehen konnte. Sobald Roberto geschieden war, würde er sie hier zu seiner Ehefrau machen oder zumindest zur ständigen Begleiterin. Sie würde an rauschenden Empfängen des Botschafters mit hochgestellten Persönlichkeiten teilnehmen, wichtige Leute treffen und sich mit ihnen unterhalten. Bestimmt würden die rasch erkennen, wie geistreich und intelligent sie doch war, auch wenn sie bloß als Mitbesitzerin einer China-Restaurant-Kette galt. Doch Roberto wertete sie auf. Und niemand musste wissen, womit sie ihr Geld verdiente. Es genügte doch, sie als höchst erfolgreiche Geschäftsfrau zu präsentieren?
Selbstverständlich war Sihena nicht mehr derart naiv oder blind, um nicht auch ein gewisses Misstrauen zu spüren. Denn was wusste sie tatsächlich von der Beziehung ihres Robertos zu seiner Puta in Buenos Aires? Womöglich lebten die beiden gar nicht in Scheidung? Sie hätte eine Detektei mit der Abklärung der Verhältnisse beauftragen können. Doch Sihena fürchtete eine Entdeckung. Der stolze Roberto hätte ihre Beziehung mit Sicherheit sogleich abgebrochen. Nein, noch musste sie sich auf sein Wort verlassen, durfte nicht ungeduldig sein. Denn welche Alternative hatte der stolze Argentinier denn? Sie war es doch, die ihn im Bett auf eine Weise beglückte, wie er sie zuvor wohl noch nie erlebt hatte.
Sie trat näher zum Spiegel, schaute sich die Haut in ihrem Gesicht penibel an, suchte nach zu großen Poren oder gar einer Unreinheit. Ein Schatten fiel ihr auf, unter der Nase. Sie hielt ihren Kopf noch näher, konnte jedoch so nichts mehr sehen. Darum holte sie sich den Handspiegel vom Frisiertisch, hielt ihn schräg unter das Kinn. Und tatsächlich, da war ein Fleck, gelb-braun und zum größten Teil in der Wölbung ihres rechten Nasenlochs versteckt. Was war das? Etwa Dreck? Sie kratzte leicht daran. Nein, kein Schmutz. Der Fleck sah aus, wie eine Verfärbung nach einer Quetschung, wenn sich ein Bluterguss langsam und gelb-braun auflöste. War das etwa Hautkrebs? Doch warum in der Nase und nicht auf ihren Flügeln? Wahrscheinlich also doch bloß eine Verfärbung, die wieder von selbst verschwand.
Sihena setzte sich vor den Schminktisch und griff zum Puder, nahm mit der Fingerspitze ein wenig davon auf und bestrich den Fleck mit Hilfe des Spiegels.
»Das sieht doch gleich viel besser aus«, sagte sie laut zu sich selbst und überlegte dann, in welchen Dessous sie ihren Roberto diesmal empfangen sollte? Auf Schwarz stand er ganz besonders, aber auch auf Lila. Sollte sie heute Apricot versuchen? Sihena lächelte sich im Spiegel an, versuchte verführerisch zu wirken, machte dazu ein paar Posen und war mit sich und der Welt zufrieden.
Noch eine Stunde bis zur Landung seiner Maschine. Danach eine Dreiviertelstunde bis hierher. Sihena klingelte nach Naara für den Nachmittagstee.
*
Schweiz
Alina Lederer ging auf die Etablissement Primaire de Vevey, eine öffentliche Schule. Ihre Eltern waren zwar sehr wohlhabend. Doch sie wollten ihre Tochter nicht in einem der vielen internationalen Privatinstitute der Genferseeregion ausbilden lassen. Alina sollte möglichst normal und mit Gleichaltrigen aus der Gegend aufwachsen. Die fast Zehnjährige war ein höchst aufgewecktes und an vielem interessiertes Mädchen.
Erst vor einer Woche begann ihr Unterricht in der vierten Primarschul-Stufe. Die dritte hatte sie übersprungen, was an der permanenten Förderung durch ihre Eltern lag. Eigentlich seit ihrer Geburt wurde sie von den beiden gefordert und gefördert, erhielt während den letzten beiden Jahren zusätzlichen Unterricht durch Privatlehrer. So hatte sie sich ganz nebenbei den Schulstoff der dritten Primarstufe angeeignet und galt unter den Lehrern als hochbegabt. Alabima und Jules waren anfänglich allerdings recht skeptisch gegenüber dem Vorschlag zum Überspringen einer Klasse gestanden. Noch zu jung, zu zart, zu verspielt schien ihnen ihr Kind. Doch für Alina war das ein ganz großes Abenteuer und sie hatte sich schon die ganzen Sommerferien über riesig auf den Tag gefreut, an dem sie »mit den Großen zusammen« zur Schule gehen durfte. So kam es, dass Alina nicht nur die Jüngste in der Klasse war, sondern auch die körperlich Kleinste und Schwächste.
In einer Familie war es in der Regel ein großer Vorteil, das Nesthäkchen zu sein. Man wurde von der gesamten Verwandtschaft besonders nett behandelt, erhielt vielerlei Unterstützung und niemand konnte einem selbst nach einem Streich so richtig böse sein.
Eine Schulklasse war aber keine Familie, oh nein. Eine Schulklasse war ein Ort, an dem man sich seinen Rang verdienen oder erstreiten musste. Das hatte Alina innerhalb der letzten Tage bereits mehrfach und schmerzhaft erfahren müssen.
»Schau nur, da kommt das hässliche braune Entchen«, war eine oft gehörte Begrüßung, wenn sie auf den Schulhof trat. In jeder Klasse gab es Rädelsführer. In dieser vierten waren das vor allem Susanne, die strohblonde und strohdumme Elfjährige. Passend zu ihr gab es noch einen Stefan, den hochaufgeschossenen Zwölfjährigen, dessen Vater die Filiale der Kantonalbank in Vevey leitete und der sich deswegen ungeheuer wichtig vorkam, obwohl er einmal sitzengeblieben war. Die zwei konnten Alina gestohlen bleiben. Doch leider gab es für die beiden keine interessierten Diebe.
Schon an ihrem ersten Tag in der Vierten begannen die Hänseleien, Sticheleien und Anfeindungen. Die anderen Schüler in ihrer neuen Klasse waren nämlich mehr oder weniger seit der ersten Primar zusammen, kannten einander seit Jahren, hatten längst ihre Gruppen und Grüppchen gebildet, in denen sie sich akzeptiert fühlten und sich entsprechend frei bewegten, die sich aber auch eifersüchtig gegen außen abschotteten, als gelte es, einen Stellungskrieg zu gewinnen. Alina war offen auf alle Mitschüler zugegangen, hatte sich von den ersten, spitzen Bemerkungen kaum irritieren lassen, war freundlich und höflich geblieben. Doch die Mauern um sie herum wurden unerbittlich hochgezogen. Man isolierte sie, verhöhnte sie, ließ sie sogar Verachtung spüren.
Warum das so war? Alina hatte keine Ahnung, wusste auch nicht, wie sie auf die kompakte Ablehnung reagieren konnte.
Ihre Lehrer jedenfalls schien nichts von all dem zu bemerken, selbst nicht, als Stefan sie einmal vor der gesamten Klasse und nach einer falschen Antwort niedermachte. Im Gegenteil. Mademoiselle Grandson musste über das Wortspiel des vorlauten Jungen sogar selbst verschmitzt lächeln.
Auf die Frage in Schweizer Geographie: »Wo mündet die Vièze in die Rhone«, hatte Alina »Martigny« geantwortet, statt »Monthey«. Zuerst wollte sie zwar Monthey sagen, war sich plötzlich nicht mehr sicher, verwechselte die Vièze mit der Dranse und schwenkte deshalb um. Und dieser blöde Stefan hatte nichts anderes zu tun, als aus der hintersten Bankreihe hämisch nach vorne zu rufen: »Alina Lederer ist in Martine verliebt«.
Martine Joicy aber war ihre Sportlehrerin, eine freundliche, klein gewachsene, blonde junge Frau, für die wohl die meisten ihrer männlichen Schüler heimlich schwärmten. Und auch Alina mochte die hübsche Lehrerin sehr gut leiden.
Selbstverständlich lachten die anderen Kinder in der Klasse sogleich laut auf und Alina fühlte sich zutiefst verletzt. Nicht so sehr durch die dummen Worte des doofen Stefan, vielmehr vom unterdrückt-amüsierten Lächeln der Mademoiselle Grandson, ihrer Geographie- und Geschichts-Lehrerin.
Alina war nur als Kleinkind mit ihrem um sechzehn Jahre älteren Adoptiv-Bruder Chufu aufgewachsen. Denn als sie fünf war, zog es den Philippinen bereits nach Brasilien, um dort Psychologie zu studieren. Seit diesem Tag war Alina wie ein Einzelkind in der Familie behandelt worden und so hatte sie schon früh damit begonnen, sich fast ausschließlich auf Erwachsene einzustellen, ihnen zu gefallen und von ihnen respektiert zu werden. Mit Gleichaltrigen kam Alina zwar fast immer gut zurecht. Doch Anerkennung suchte die fast Zehnjährige vor allem von ihren Eltern und den Lehrern, nicht von ihren Klassenkameraden.
Mit ihrem halb-verschämten Schmunzeln hatte Mademoiselle Grandson jedoch viel zerstört, vor allem die Hoffnung der kleinen Alina Lederer auf Schutz vor den größeren und älteren Klassenkameraden. Auch die Hoffnung auf Anerkennung ihrer Leistungen. Eine ganze Welt war für die fast Zehnjährige zusammengebrochen und sie fühlte sich von diesem Moment an entsetzlich einsam und allein.
Schon in der nächsten Unterrichtspause machte der unsägliche Spruch von Stefan die Runde im Schulhof. Von überall her wurde sie nur noch mit Loulou Martine angesprochen. Es war entsetzlich demütigend und sie konnte den Rest des Tages dem Unterricht kaum noch folgen, dachte nur noch an die erlebten, hässlichen Szenen und immer, immer wieder an das schmunzelnde Lächeln ihrer Geographie-Lehrerin. So wirkte sie immer noch ziemlich verstört, als sie von Maman am späteren Nachmittag abgeholt wurde.
»Wie war dein Tag?«, kam die fast schon obligatorische Frage von Alabima.
»Ganz gut. Nichts Besonderes«, log sie ihre Mutter an, hoffte, dass man ihr die wilden Gedanken nicht ansah.
»Du siehst bedrückt aus? Ist was?
»Nur etwas Bauchschmerzen.«
Das fehlte ihr noch. Dass sich Maman einschaltete, womöglich bei der Schulleitung vorsprach, um ihre Tochter in Schutz zu nehmen. Alina hätte vor Scham im Boden versinken müssen. Nein, mit derartigen Problemen musste sie in ihrem Alter selbst fertig werden. So hatte sie ihr Vater angeleitet. So waren nun mal die Regeln bei den Lederers.
»Wir alle sind Kämpfernaturen, Alina«, hatte ihr Vater einmal eindringlich gesagt, »wir beißen uns durch, auch wenn es mal schwierig wird.«
Ja, sie wollte ihrem Vater gefallen, wollte ihrer Familie genügen. Denn es durfte doch nicht sein, dass gerade sie, die hochbegabte Alina Lederer, wie ihr die früheren Lehrer sogar schriftlich bestätigt hatten, an ihrer neuen Klasse und der neuen Lehrerin scheiterte.
»Du wirst stolz auf mich sein, Papa«, flüsterte sie unhörbar für Alabima vor sich her, blickte dabei starr auf die Kopfstütze von Maman, sah die Naht im geprägten Leder ganz scharf und deutlich vor sich und überlegte fieberhaft, wie sie diesen Kampf gewinnen konnte.
Denn gewinnen, das war nun einmal der Segen und gleichzeitig der Fluch der Lederers. Doch das wurde Alina erst bewusst, als sie viel älter war.
*
Nordkorea
Kim Jong-un war auf allen Bildschirmen des Landes zu sehen, so auch in der Offiziersmesse des 3. Panzerregiments, dessen Stützpunkt im Goljjagi Gidae, dem Tal der Hoffnung, lag. Der alte Fernseher flackerte allerdings bedenklich, schien seine Bildröhre durch ein eigentliches Blitzlichtgewitter gleich selbst zerstören zu wollen. Trotzdem war hinter dem vielen Schnee und dem Geflacker die Erhabenheit des Großen Führers deutlich zu erkennen, wie er hinter einem Pult und vor einem halben Dutzend Mikrophonen saß und einmal mehr zu seinem Volk sprach. Es war der 10. Juli im Jahre 106 und die Feierlichkeiten zum Todestag des Großen Führers Genosse Kim Il-sung erst zwei Tage her.
Nach einer etwas langatmigen und irgendwie trotzdem schnoddrigen Begrüßung kam der junge Machthaber auf sein Lieblingsthema der letzten Wochen zurück, den so plötzlichen und bedauerlichen Tod von Kim Jong-nam, dem älteren Bruder des Großen Führers. Er war vor wenigen Monaten auf dem Flughafen in Kuala Lumpur von ausländischen Agenten getötet worden. Allerdings schoben dekadente, westliche Medien die Ermordung des allseits beliebten Mannes Nordkorea zu. Eine bösartige Unterstellung, selbstredend, eine ungeheure Frechheit, ein eigentlicher Skandal, mit Sicherheit gesteuert vom verhassten Amerika.
»Zweifelsfrei hat unser Geheimdienst die wahre Täterschaft hinter der feigen Tötung unseres geliebten Bruders und Genossen ermittelt. Es waren von der CIA gekaufte Agenten, die unseren werten Kim Jong-nam aus der Mitte unserer Gemeinschaft rissen. Und nicht nur das. Ich erwarte weitere und noch weit schwerwiegendere Übergriffe der westlichen Imperialisten, allen voran die USA und Japan. Doch wir sind gewappnet und werden uns zu wehren wissen und genauso siegreich sein, wie in all unseren Schlachten zuvor. Teile der Volksarmee wurden von mir höchst persönlich in Bereitschaft gesetzt und die Grenzen unseres Landes werden von zusätzlichen Kontingenten abgeriegelt und beschützt. Die Volksarmee ist bereit, unsere geliebte Heimat bis zum letzten Tropfen ihres Blutes zu verteidigen.«
Das fast ausdruckslose Gesicht des Großen Führers und höchsten Genossen stand im Widerspruch zu den so markigen und angriffslustigen Worten. Doch das war man von ihm gewöhnt. Kim Jong-un besaß nun einmal nicht die Ausstrahlung seines Großvaters oder die seines Vaters. Doch er würde im Laufe der Jahre weiter an seiner Aufgabe wachsen. Da waren sich alle Zuseher und Zuhörer sicher. Selbst unter den hungernden Gesichtern an den Fernseh-Bildschirmen des Landes gab es bestimmt keinen einziges, das nicht verstanden hatte, wie sehr alle seine Entbehrungen der Erhaltung des gemeinsam Geschaffenen diente. Was Mao Zedong im großen China geschaffen hatte, das würde auch Kim Jong-un irgendwann in Nordkorea gelingen.
Noch musste man all die Sanktionen und bösen Anfeindungen der westlichen Imperialisten über sich ergehen lassen, musste man darben, zum Wohle der Zukunft. Dank der Atombomben und der Langstrecken-Raketen hatte man sich aber bereits eine Machtposition in der Welt erarbeitet, die selbst die größten, feindlichen Mächte USA, Japan und Südkorea im Zaum hielten. Nicht mehr lange und ganz Amerika musste vor Nordkorea zittern, musste in der Folge endgültig einknicken und dem Land die ihm zustehende, hervorragende Stellung in der Welt einräumen.
Auch Chang Seung-zin und Ri Chol-hwan, zwei Leutnants des 3. Panzerregiments zweifelten keine Sekunde daran. Die beiden Männer Ende zwanzig waren stolz auf ihren noch so jungen Großen Führer, auf seine Umsicht, seine Tatkraft, auf seinen unerbittlichen Kampf für die Rechte der Bevölkerung. Sie schauten sich deshalb begeistert an und nickten sich kurz zu, wurden von den nächsten Worten von Kim Jong-un jedoch geradezu elektrisiert.
»Doch wir haben eine große Sorge, Genossinnen und Genossen. Denn es gibt Verräter in unseren Reihen, Abtrünnige, die mit dem feindlichen Ausland korrespondieren und sich mit ihm heimlich verbünden. Ich rufe deshalb jeden Mann, jede Frau, ja auch jedes Kind auf, in nächster Zeit ganz besonders aufmerksam zu sein. Beobachtet eure Nächsten, schaut, was sie tun, wie sie sich verhalten. Jeder Auffälligkeit solltet ihr gründlich nachgehen und eurem Vorgesetzten, euren Lehrern oder einem höheren Parteimitglied sogleich berichten. Nur wenn wir alle fest zusammenhalten, können wir gegen all die fremden Feinde bestehen.«
Wiederum sahen sich Chang Seung-zin und Ri Chol-hwan verstehend an und bei beiden leuchteten die Augen kurz auf. Ja, sie würden wachsam sein und wachsam bleiben. Denn ihre geliebte Heimat war von immer mehr Feinden umgeben, die ständig weiter aufrüsteten, um das große Nordkorea irgendwann zu überfallen. Auch etwas Kummer war in den Gesichtern der beiden Leutnants zu sehen. Denn die Volksarmee verfügte zwar über weit mehr als dreitausend Panzer. Doch die allermeisten waren alt, viele sogar uralt. Manche stammten noch aus dem Zweiten Weltkrieg, wiesen mit ihrer geringen Panzerung, ihrer Zielungenauigkeit und ihrer wenig schlagkräftigen Bewaffnung große Defizite zu den modernen Geräten anderer Mächte auf. Doch wo ein Wille, da war immer auch ein Weg. Und so würde gerade die 3. Panzerdivision jedem Beschuss standhalten, wenn nötig bis zur totalen Vernichtung oder dem endgültigen Sieg.
Der Große Führer, Genosse Kim Jong-un, hatte seine Ansprache beendet. Es folgten aktuelle Informationen zur erwarteten Rekordernte an Getreide und Gemüse in diesem Jahr. Die vor drei Jahrzehnten begonnene Anbauschlacht sollte endlich aufgehen, würde jeden Mann, jede Frau und jedes Kind schließlich ausreichend ernähren und so Nordkorea endgültig unabhängig vom Ausland machen.
Chang und Ri rückten ihre Stühle und setzten sich an ihrem Tisch in der Offiziersmesse wieder gegenüber, steckten dann ihre Köpfe zusammen.
»Was meinst du?«, begann Chungwi Seung-zin, »könnte es auch in unseren Reihen Verräter geben?«
Chungwi Chol-hwan hob seine Schultern, ließ sie unschlüssig sinken.
»Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder doch?«
»Jeder Fisch beginnt am Kopf zu stinken«, meinte Leutnant Seung-zin bedeutungsvoll.
»Unser Großer Führer ist doch über jeden Zweifel erhaben?«, reklamierte sogleich Leutnant Chol-hwan.
»Ich sprech doch nicht von Genosse Jong-un«, entrüstete sich Chang, »nein, ich spreche von unserem Kommandanten, Oberst Chung Syng-man.«
Nun schwiegen sich die beiden jungen Männer erst einmal aus, wobei Chang beinahe gierig seinen Leutnant-Kollegen Ri anstarrte. Der rief sich seine wenigen Begegnungen mit dem drahtigen Kommandanten des 3. Panzerregiments in Erinnerung.
»Ja, du hast womöglich recht«, stimmte Chungwi Chol-hwan endlich seinem Kollegen halbherzig und durchaus skeptisch zu, »Genosse Syng-man fällt schon etwas aus dem Rahmen, wenn man ihn mit anderen Kommandeuren vergleicht.«
»Sag ich doch«, meinte Chungwi Seung-zin, »ich habe gehört, Oberst Syng-man soll in seinem persönlichen Quartier einen UKW-Sender verstecken, mit dem er ausländische Sender empfangen kann.«
Ri Chol-hwan blickte höchst erstaunt drein und ereiferte sich gleich danach entrüstet: »Nein! Das kann nicht sein! Oder doch? Wer hat dir denn das gesteckt? Wenn das stimmt, so ist das Hochverrat!«
Chungwi Chang Seung-zin nickte bedeutungsvoll und verlangte verschwörerisch: »Du darfst es aber niemandem weitererzählen...«
Ri Chol-hwan nickte zustimmend.
»... Pak Su-yong, der Adjutant des Obersts. Nach den Feierlichkeiten zum Todestag von Genosse Kim Il-sung und nach viel zu viel Bier.«
»Und du hast dich nicht verhört?«, staunte Leutnant Chol-hwan immer noch ungläubig.
Leutnant Seung-zin schüttelte verneinend den Kopf.
»Was brütet ihr denn aus?«
Die laute, aufdringlich Stimme von Hauptmann Han Myong-hui ließ die beiden am Tisch zusammenzucken und aufschrecken.
»Ihr hockt hier wie zwei Verschwörer zusammen«, lachte er sie dröhnend aus, packte einen Stuhl vom Nebentisch und setzte sich zu ihnen hin. Doch seine Mimik und vor allem seine Augen verrieten ihn, straften seine lockeren Worte Lüge, zeigten deutlich ein abschätzendes Lauern.
»Wir haben uns bloß über die Schwester von Chang unterhalten, Genossin Lee. Sie will heiraten. Einen Fremdenführer aus Pjöngjang«, warf Ri Chol-hwan geistesgegenwärtig ein.
»Einen Fremdenführer? Nichts für Ungut, Chang, aber das sind doch alles verkappte Kapitalisten«, ereiferte sich Hauptmann Myong-hui sogleich, »ich kann eh nicht verstehen, warum man diese Fremden in unserem Land duldet und sie sogar herumführt und ihnen alles zeigt. Die verbreiten im Ausland doch bloß Lügen über uns und unseren Großen Führer.«
Hauptmann Myong-hui hasste alles Fremden, das wussten beide Chungwi.
»Aber sie bringen Devisen ins Land«, meinte Ri Chol-hwan versöhnlich.
»Und meine Schwester will endlich von zu Hause ausziehen. Du weißt selbst, dass man keine Wohnung zugewiesen bekommt, solange man nicht verheiratet ist.«
»Also eine Zweckehe?«, fragte der Hauptmann den Leutnant und der nickte, »na dann kann ich es verstehen. Wir allem müssen manchmal Kompromisse eingehen.«
Hauptmann Han Myong-hui war ein Arschloch. Doch einer seiner Onkel gehörte zu den höheren Tieren in der Partei der Arbeit Koreas. Und Vitamin B war und blieb nun einmal eines der wirksamsten Mittel, um rasch Karriere zu machen, ob in der Armee, in der Verwaltung oder in der Industrie. Besser man stellte sich gut mit solchen Leuten, bot ihnen möglichst keine Angriffsfläche.
»Und was haltet ihr von der Rede unseres Großen Führers?«
»Die Volksarmee steht wie ein Mann hinter ihm«, befleißigte sich Ri Chol-hwan sogleich klar zu stellen und warf sich in die Brust.
»Lang lebe Genosse Kim Jong-un«, beeilte sich Chang Seung-zin zu ergänzen.
Hauptmann Myong-hui erhob sich, grüßte sie militärisch, aber äußerst lässig, und verließ ihren Tisch ohne Abschied, ging hinüber zur Theke, wo ein paar seiner besonderen Kumpels saßen, die vor wenigen Augenblicken lachend und lärmend in die Offizierskantine gedrängt waren.
»Und was hältst du von ihm«, meinte Chang und deutete verstohlen auf den Rücken ihres direkten Vorgesetzten.
»Er ist ein Idiot und wird immer ein Idiot bleiben.«
»Doch er hat gute Beziehungen bis hoch hinauf«, gab Leutnant Seung-zin zu bedenken.
»Ja, er könnte uns nützlich sein.«
Beide sahen sich an und dachten unabhängig voneinander an Oberst Syng-man, dem Kommandanten des 3. Panzerregiments und möglichen Kollaborateur mit dem feindlichen Amerika.
»Aber behutsam müssen wir vorgehen«, mahnte Chang sich selbst und seinen Kollegen.
»Vorsichtig wie der Mungo, der die Schlange jagt«, antwortete Ri ebenso leise.
»Zum Wohle des Großen Führers.«
»Und zum Wohle unserer geliebten Heimat.«
*
Kenia
Fu Lingpo kam von der Arbeit nach Hause, falls man das, was er tat, als Arbeit bezeichnen wollte und dort, wo er anlangte, als sein Zuhause. Sophie Shi hatte das Abendessen fast schon fertig, warf nun eine Handvoll Spaghetti in den großen Topf mit dem kochenden Wasser. Denn die Sauce wartete stets auf die Pasta, nie umgekehrt.
Das chinesisch-stämmige Paar war um die sechzig, hatte sich erst vor ein paar Jahren kennen gelernt. Fu Lingpo arbeitete damals für eine der Triaden in Hongkong, Sophie Shi verdiente sich den Lebensunterhalt als selbstständige Telefon-und Internet-Sex-Anbieterin. Als sich die beiden ineinander verliebten, mussten sie vor der chinesischen Gangsterbande fliehen, gelangten nach Kenia, versuchten seitdem hier nicht nur Fuß zu fassen, sondern ein neues, gemeinsames Leben aufzubauen. Einige Chancen hatten die beiden ausprobiert und leider allesamt vertan. Vor zwei Jahren versuchten sie es in Garissa, einer größeren Stadt im Osten des Landes, nahe der Grenze zu Somalia. Fu verdingte sich dort als kleiner Angestellter der Universität, während Sophie einen Laden für chinesische Medizin betrieb. Doch die beiden hatten kein Glück und kehrten nach Nairobi zurück, noch bevor die al-Shabaab-Miliz im April 2015 an der Universität von Garissa zuschlug. Fast zweihundert Menschen starben damals bei dem Überfall der Terroristen aus Somalia. Professoren, Studenten, Angestellte wurden als Ungläubige gemeuchelt, falls sie keine Koran-Verse auswendig aufsagen konnten, wurden von dem halben Dutzend eingedrungene Mörder gnadenlos erschossen. Das Töten der unschuldigen Zivilisten durch die Selbstmord-Attentäter war als Racheakt für die Einmischungen der kenianischen Armee im Bürgerkrieg des Nachbarlandes gedacht.
Kurz nach ihrer Rückkehr in die Hauptstadt konnten Fu und Sophie den Terroranschlag auf die Universität in Garissa beinahe live im Fernsehen mitverfolgt. Dass Fu dem Morden der Terroristen entgehen konnte, beruhte auf seiner Erfahrung und seinem ständig vorhandenen Misstrauen. So kam er hinter die Verschwörung einiger Studenten. Sie spionierten für die Terror-Miliz den Campus und die Stadt aus, lieferten die Informationen an die Terror-Miliz. Die eigentlichen Drahtzieher waren Chemal Njoroh und sein Vater Heri Njoroh, ein bekannter Industrieller in Garissa. Beim Terror-Akt der al-Shabaab wurde auch der damalige Vorgesetzte des Chinesen getötet. Fu Lingpo hatte Hughudu wirklich gemocht. Denn der Einheimische hatte ihn, den eingewanderten Fremden, von Beginn an unterstützt. Deshalb kehrte Fu Lingpo zwei Wochen nach dem Anschlag nach Garissa zurück, entführte zuerst den Sohn des Industriellen, quälte ihn solange, bis er von Chemal alles über das Anwesen des Vaters mit all den Sicherheitsvorkehrungen wusste, zog ihm danach einen Plastikbeutel über den Kopf, klebte ihn an dessen Hals fest, ließ den Erstickenden in der Wüste als Mahlzeit für die Schabracken-Schakale und für andere Wildhunde liegen. Noch in derselben Nacht besuchte Fu Lingpo auch Heri Njoroh, fand ihn wie vom Sohn beschrieben allein im großen Schlafzimmer vor, schlug ihn bewusstlos, verklebte ihm den Mund, fesselte Arme und Beine an die Bettpfosten, verwendete dazu breite, ziemlich weiche Bandagen, die keine Spuren an den Gelenken hinterließen. Dann setzte sich der Chinese auf die Brust des Sechzigjährigen und weckte ihn mit leichten Ohrfeigen auf. Als Heri wieder klar sah, erklärte Fu ihm ausführlich die Gründe, warum er nun sterben musste, drückte anschließend mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand die Nasenlöcher des Gefesselten zu, dachte dabei an Hughudu, sah das stets freundlich lächelnde Gesicht seines ermordeten Vorgesetzten vor sich, während Njoroh unter ihm die Augen aus dem Kopf quollen, der kenianische Industrielle sich unter dem Chinesen aufbäumte und an seinen Fesseln zerrte, hinter dem zugepflasterten Mund auch schreckliche Schreie auszustoßen versuchte, bis er plötzlich erschöpft inne hielt, dann noch einmal ungläubig und fassungslos den Asiaten über ihm anstarrte, bevor seine Augen brachen.
Fu zog das Klebeband von den Lippen des Toten, nahm auch die Fesseln ab, verstaute alles in den Taschen seiner Jacke, richtete das Bett wieder her, verließ die Villa so unbemerkt, wie er sie betreten hatte.
Der junge Sohn spurlos verschwunden, der alte Vater am nächsten Morgen leblos im Bett gefunden. Die Familie war ratlos. Die Autopsie bei Heri ergab als Todesursache einen Erstickungstod. Doch die Atemwege der Leiche waren nicht etwa durch Erbrochenes verstopft. Zudem übersah der Coroner die kaum sichtbaren Leimreste vom Klebeband um den Mund des Toten herum. So änderte der Leichenbeschauer kurzerhand seine eigene erste Diagnose ab und entschied auf plötzlichen Herzinfarkt, auch wenn seine diesbezüglichen Untersuchungen keine Anzeichen lieferten. Doch niemand sollte an seinem Fachwissen oder gar an seinen Fähigkeiten zweifeln.
Nach ihrer Rückkehr in die Hauptstadt des Landes hatte Sophie Shi in der Nachbarschaft zu ihrer Wohnung erneut einen Laden für chinesische Medizin eröffnet. Zu Beginn lief das Geschäft einigermaßen ansprechend, trug sich zumindest selbst. Doch mit den vielen chinesischen Migranten in der Stadt schossen auch spezielle chinesische Geschäfte in Nairobi wie Pilze aus dem Boden und die Konkurrenz gerade unter den Apotheken war immens groß. Die Umsätze von Sophie sanken, die finanzielle Situation verschlechterte sich von Monat zu Monat. Während dessen hatte sich Fu Lingpo erfolglos bei Dutzenden von Firmen beworben, ähnlich wie zwei Jahre zuvor, bevor sie gemeinsam nach Garissa auswichen. Der Chinese wurde nur selten zu einem Anstellungsgespräch eingeladen, erhielt danach auch stets Absagen. Denn wer stellte schon einen fast sechzigjährigen Chinesen ein, wenn er halb so alte, ach was, ein Drittel so alte Einheimische an jeder Straßenecke fand? Fu hatte zudem nie einen Beruf ordentlich erlernt, war schon als Halbwüchsiger ins Triaden-Geschäft eingestiegen, kannte sich bestens mit Erpressung, Entführung und Ermordung aus, alles Fähigkeiten, die er in Afrika und in seinem neuen Leben nicht hauptberuflich ausüben wollte. So war er gezwungenermaßen zu einem Spitzel geworden, für die Polizei genauso, wie für andere interessierte Kreise. Den ganzen Tag über trieb er sich in den chinesischen Lokalen und Läden herum, galt dort als erfolgreicher Zuhälter, der zwei Bordelle in Pretoria betrieb und sich hier in Nairobi nach weiteren Geschäftsstandorten umsehen wollte. Auf dieser halb-kriminellen Basis bekam er zunehmend Kontakt zu einheimischen Gangster-Organisationen und wenig später auch die ersten unzweideutigen Angebote. Doch er lehnte Drogendeals genauso ab, wie die Vermittlung einheimischer Tänzerinnen.
»Ich nehme nur Ausländerinnen, aus Ghana und der Elfenbeinküste. Und blutjung müssen sie sein. Alles über vierzehn interessiert mich nicht.«
Das war seine Standard-Ausrede und sie löste auf der Gegenseite eher Respekt und niemals Ekel aus.
Die andere Hälfte seines Lebensunterhalts verdiente sich Fu mit dem Ankauf gestohlener Waren. Er bevorzugte dabei Schmuck, Münzen und Medaillen und zahlte überdurchschnittlich gut. Edelmetall und Steine verschob er nach Südafrika zu einem Hehler, der sie über längst stillgelegte Minen wieder in den ordentlichen Wirtschaftskreislauf führte. Doch von der gelegentlichen Hehlerei und seinen Diensten als Spitzel lebte Fu Lingpo mehr schlecht als recht, ähnlich wie Sophie Shi mit ihrem Laden. Und so warteten die beiden im Grunde genommen auf eine neue Chance, hofften, dass sie sich irgendwann zu erkennen gab. Auch ein Tal der Hoffnung, das die beiden nun schon seit zwei Jahren durchschritten und aus dem sie noch nicht herausgefunden hatten. Doch Zukunftsängste, die kannten die beiden nicht. Jedenfalls versicherten sie sich dies immer wieder gegenseitig. Und litten weiter.