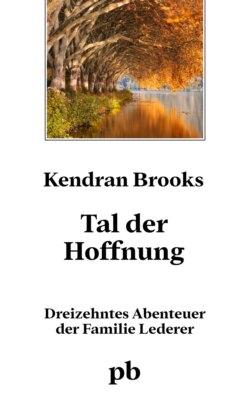Читать книгу Tal der Hoffnung - Kendran Brooks - Страница 5
Gegen Abend
ОглавлениеKenia
Endlich tat sich etwas. Sie hörten zuerst das harte, metallische Wegschieben eines Riegels und waren sogleich hellwach. Dann öffnete sich quietschend die Tür zu ihrem Verlies. Gleichzeitig drang Lichtschein ein. Ein korpulenter Mann in einfacher Kleidung trug mit schweren, schleppenden Schritten eine Karbidlampe vor sich her, hielt sie tief, auf Schenkelhöhe, so dass vor allem der Boden, die Wände und eines seiner Hosenbeine angestrahlt wurden. Haschib und Saleh starrten stumm und mit angstvoll geweiteten Augen auf Mann und Lampe, brachten kein Wort heraus, warteten voller Furcht auf das, was kam.
Der Korpulente trat näher, beugte sich etwas nieder und betrachtete sich die Gesichter der beiden Gefangenen, lange und genau. Haschib und Saleh sahen einen haarlosen Schädel, wulstige, schwarze Augenbrauen, eine breite, knotige Nase und dumpfe Augen, die weder gut, noch böse blickten.
»Binde mich los«, verlangte Haschib, »bitte. Warum hält man uns hier fest? Wer bist du? Was willst du von uns.«
Der Korpulente grunzte unverständlich.
»Hilfeee…«, schrie Saleh plötzlich und Haschib stimmte sogleich ein, »Hilfeeeeee…«
Sie hofften auf die immer noch offenstehende Tür, auf die Möglichkeit, dass sie nun gehört wurden.
Der Dicke grunzte erneut, als sie verstummten um Atem zu schöpfen. Diesmal klang der Laut allerdings unwirsch, beinahe drohend. Trotzdem schrien die beiden Freunde erneut los, so laut und so lang anhaltend sie nur konnten. Doch da sich der Korpulente nicht zur Tür wandte, um sie rasch zu schließen, war zumindest Saleh bereits klar geworden, wie sinnlos ihr Schreien war.
Der Mann mit der Lampe trat nun mit zwei kurzen Schritten näher an Haschib heran, holte langsam mit seinem rechten Fuß aus und trat dem jungen Mann mit aller Kraft in den Bauch. Einmal, zweimal und noch ein drittes Mal. Haschib hatte nur beim ersten Tritt laut aufgeheult, konnte hinterher nur noch voller Schmerzen keuchen und stöhnen, spuckte Speichel und Blut, lag wie ein weidwundes Tier auf dem gestampften Boden, als müsste er sterben.
Der Dicke ging langsam und bedächtig hinüber zu Saleh, der ihn mit weit aufgerissenen Augen angstvoll anstarrte. Als der Lampenträger erneut seinen Fuß nach hinten zog, rollte sich der junge Kenianer rasch von ihm weg, drehte sich zur Seite und trat mit seinen Füßen um sich wie ein Esel, der sich gegen ein Rudel Schakale wehren musste, traf dabei das linke Schienbein des Korpulenten und seine Wade. Der Kerl quiekte erschrocken und schmerzvoll auf, ruckte auch zwei Schritte zurück, um weiteren Tritten seines Gefangenen zu entgehen. Dann beugte er sich schnaufend hinunter und rieb sich den misshandelten Schenkel, starrte Saleh jedoch keineswegs hasserfüllt an, sondern immer noch mit diesem dumpfen Blick ohne bestimmten Ausdruck. Er schien zu überlegen, wie er den jungen Kenianer am besten erwischen konnte.
Saleh drückte sich mit seinen Füßen ab, rutschte so in Richtung der Wand, fühlte bald die Steinklötze in seinem Rücken, richtete sich an ihnen etwas auf. Denn er wollte seine Haut weiterhin so teuer wie möglich verkaufen, machte sich selbst Mut.
»Komm doch, wenn du dich traust«, rief er dem Dicken zu, »ich lass mich nicht einfach so treten. Ich geb dir alles mit Zinsen zurück.«
Der korpulente Mann glotzte ihn an, als hätte er kein Wort verstanden. Dann drehte er sich langsam ab und ging in Richtung Tür.
»Ja, hau bloß ab. Und sag deinem Boss, dass er uns endlich freilassen soll.«
Ein weiterer, unverständlicher Grunzer war die einzige Antwort, als der Lampenträger durch die Tür schritt, sie jedoch offen stehen ließ. Saleh sah dahinter einen niedrigen, schmalen Gang, von dem weitere Türen abgingen. Und an seinem Ende lehnte eine lange Gabel an der Wand, wie man sie fürs Ausmisten von Ställen benutzte. Die griff sich der Mann und kehrte schnaufend zurück in den Kerker.
»Oh … geht’s mir schlecht …«, stöhnte Haschib derweil und drehte seinen Kopf herum, suchte Blickkontakt zu seinem Freund. Er hatte wohl noch gar nichts von der Auseinandersetzung zwischen dem Korpulenten und Saleh mitbekommen. Doch als der Dicke mit Lampe und Gabel näher trat, erkannte er endlich die voller Schrecken geweiteten Augen seines Liebhabers. Saleh wirkte wie ein in die Enge getriebenes Tier, lehnte mit seinem Rücken an die Mauer und zitterte trotzdem voller Furcht.
Haschib drehte sich mühsam schnaufend wieder herum, sah zum nähertretenden Dicken: »Oh, Gott. Was will der Kerl mit der Mistgabel …?«
Saleh sagte nichts, bereitete sich innerlich auf den Kampf vor, spürte von einem Augenblick zum nächsten keinerlei Furcht mehr, war nur noch angespannt und konzentriert.
Als Junge hatte er sich in seinen Träumen oft ausgemalt, wie er in Bedrängnis geriet und sich heldenhaft herausschlug. In der Schule, es war in der Dritten, musste er gegen den Klassen-Grobian kämpfen. In der langen Pause am Vormittag stürzte sich der viel größere und schwerer Kerl, der zwei Mal sitzen geblieben war, auf ihn und traktierte ihn mit Fäusten und Tritten, wollte ihn, wie so viele andere zuvor, nach kurzem Kampf besiegt am Boden sehen, zertreten wie ein Wurm. Doch nicht mit ihm, nicht mit Saleh. Er war vor dem ersten, schlecht koordinierten Angriff ein paar Schritte zurückgewichen, stürzte sich dann aber vor und haute dem stärkeren Jungen seine Faust unters Kinn, traf äußerst glücklich dessen Gurgelknoten. Der andere bekam sogleich keine Luft mehr und sein Kopf lief rot an. Dazu röchelte er verzweifelt, ließ sich zu Boden sinken und sah angstvoll zu Saleh hoch, der längst von den anderen umringt war und als glorreicher Sieger gefeiert wurde.
Das war zwar lange Zeit her, schon mehr als zehn Jahre. Doch seit diesem Tag floss echtes Heldenblut in Salehs Körper, brodelte immer dann hoch, wenn er sich in Gefahr sah, schenkte ihm eine unnatürliche Gelassenheit angesichts einer direkten Bedrohung.
Der Korpulente stellte die Lampe sorgfältig auf dem Boden ab, um beide Hände für die Gabel mit den vier langen, stählernen Zinken frei zu haben. Saleh zog seine Beine an, machte sich bereit. Auch wenn er wusste, dass der Holzgriff des Werkzeugs weit länger als seine Schenkel war, würde er seine Haut so teuer wie möglich verkaufen.
Der Dicke stieß eher spielerisch mit der Mistgabel ein paar Mal zu. Saleh trat immer wieder zu, traf auch mit der Spitze seines Turnschuhs immer wieder die Seite des Werkzeugs, brachte es aus der Richtung. Doch der Korpulente stellte sich rasch darauf ein, drehte blitzschnell die Gabel um und stieß erneut zu, erwischte diesmal Salehs rechten Unterschenkel mit einem der Zinken und piekte ihn auf dem Boden fest.
Als der Stahl durch sein Muskelfleisch fuhr, fühlte Saleh zuerst nur, dass sein Bein festgehalten wurde. Doch gleich danach, als er sich frei treten wollte, spürte er den schlimmen Schmerz und heulte auf. Das Gesicht des Dicken zeigte nun ein zufriedenes Lächeln, wie bei einem Fischer, der sein Netz einholte und reiche Beute darin fand. Vorsichtig zog er die Gabelspitzen aus der Erde, aber nicht aus dem Schenkel und ging danach langsam in Richtung Mitte des Kerkers. Saleh musste notgedrungen hinterher rutschen, um den Schmerz im Bein einigermaßen erträglich zu halten. Der Dicke stellte dort die Gabel an und trat sie mit seinem Fuß tief in die Erde, fixierte auf diese Weise Salehs Bein wie ein Sammler den Schmetterling mit einer Nadel.
Saleh lag nun ganz ruhig da, atmete flach, fühlte, wie die zurückgekehrte Furcht sich immer mehr in Panik wandelte, als der Dicke langsam um Gabel und Bein herumging und sich vor seinem Bauch und der Brust aufbaute. Er sah auch zu, wie der Schinder seinen rechten Fuß nach hinten anhob und Schwung holte. Mit angstvoll geweiteten Augen blickte er auf den Lederschuh, auch als der plötzlich vorschnellte und sich in seinen Körper grub, versuchte noch seine Bauchmuskeln anzuspannen, auf die er so stolz war, fühlte trotzdem den überaus harten Aufprall und wie sein Magen gestaucht wurde, spürte eine starke Schmerzwelle durch seinen Körper schwappen, schrie auf, hob seine Hände vor den Unterleib, wollte so den nächsten Tritt dämpfen. Doch der Schuh durchbrach diese schwache Sperre und Saleh schrie erneut laut auf, hatte das Gefühl, seine Unterarme müssten gebrochen sein. Noch vier oder fünf Mal trat der Schinder zu. Dann erst schien es ihm genug der Mühe. Grunzend wandte er sich ab, zog die Gabel aus Dreck und Schenkel, packte auch die Lampe vom Boden und ging langsam hinaus, zog das Türblatt hinter sich ins Schloss, schob den Riegel wieder vor.
Beide Gefangenen hörten atemlos zu, wie sich die Schritte hinter der Tür verloren.
»Saleh?«, flüsterte Haschib aus der Dunkelheit.
Saleh schwieg, gab sich ganz seinen Schmerzen hin, atmete äußerst flach, weil sie nur so erträglich waren.
»Wie geht es dir, Saleh?«, hörte er erneut Haschib flüstern, »was ist mit dir?«.
Saleh schämte sich, über seine Hilflosigkeit, über seine Schwäche. Lautlose Tränen liefen ihm über das Gesicht.
*
Schweiz
Ihre Enttäuschung hielt sich in Grenzen, als sie in der Villa ankam. Denn Jules war gar nicht zu Hause, hatte auch keine Mitteilung hinterlassen. Dann konnte er eigentlich auch nicht weit sein und musste in absehbarer Zeit zurückkehren.
Nach dem Eintreten in den Flur hatte sie sich noch einmal im Wandspiegel kontrollierend betrachtet und war weiterhin höchst zufrieden mit ihrem Aussehen. Erst danach hatte sie nach Jules gerufen und keine Antwort erhalten. Sie ging in die Küche, ordnete dort die gekauften Gemüse in die Fächer im Kühlschrank ein, legte das Obst in die große Früchteschale. Anschließend zog es sie hinauf und ins Schlafzimmer. Dort setzte sie sich an den Schminktisch und betrachtete sich erneut und kritisch im Spiegel.
Ja, da waren schon ein paar Fältchen, vor allem um die Mundwinkel herum und unter den Augen. Auch ihre Stirn schien weniger glatt und ebenmäßig als auch schon. Doch mit fast vierzig Jahren war das alles doch ganz normal und eine reife Cougar gehörte doch längstens ins Beuteschema vieler junger Männer, die den Sex mit erfahrenen Frauen liebten.
Machte sie ihre neue Frisur etwa zu jungendlich?
Sie schaute im Spiegel nach, fand weiterhin alles perfekt an ihr, besonders auch die kleinen Fältchen, die doch bloß ihre Lebenserfahrung unterstrichen.
Warum also hatten vorhin in Lausanne kaum ein Mann und keine einzige Frau auf sie reagiert? In den USA wurde sie schon vor Jahren einmal von einem jungen Tölpel am Schalter eines McDonald´s Drive Thru »Ma´am« genannt. Damals war sie sich unendlich alt vorgekommen. Und Jules zog sie selbstverständlich noch Wochen später immer wieder mit der Anrede auf, wenn er sie ärgern wollte. War nun das eingetreten, was sie damals unnötigerweise empfand? Hatte sie die unsichtbare Grenze überschritten und war alt geworden?
Nein, das konnte nicht sein. Trotzdem erhob sie sich und ging hinüber zum Spiegelschrank, betrachtete ihren gesamten Körper kritisch, angefangen bei den Füssen und bis hinauf zu ihrer neuen Frisur. Alles sah doch erfreulich aus, ja, verlockend, sagte sie sich selbst. Und doch? Ihr Kostüm stammte aus Paris, eine Kreation von Lagerfeld, schick, beinahe lässig, hatte sie es immer empfunden. Oder war es nicht eher altbacken und langweilig? Trotz der Ärmellosigkeit und dem Ausschnitt am Rücken? Doch mit der dazugehörenden Jacke darüber hatte das selbstverständlich niemand sehen können. Das war ihr immer bewusst. Doch der Stoff war wirklich nicht das Gelbe vom Ei, ein eher langweiliges uni-hellblau, so als wäre sie eine Zeitreisende aus den 1960er-Jahren. Mein Gott, warum hatte sie das nicht schon früher erkannt?
Rasch schlüpfte sie aus den Kostüm, hängte es zurück in den Schrank, kontrollierte erneut ihren Körper und ihre Haare, hob kurz mit beiden Händen ihre großen, immer noch recht festen Brüste hoch, die vom Wonderbra weiterhin richtig gut zur Geltung gedrückt wurden. Sie holte sich ein anderes Kleid hervor, schlüpfte hinein, schloss im Rücken den Reißverschluss so hoch sie konnte, betrachtete sich erneut eingehend, drehte sich vor dem Spiegel und schaute sich kritisch an. Denn auch dieses Modell gefiel ihr nicht richtig, schien ihr ebenfalls altbacken und von vorgestern, was es ja auch tatsächlich war, nämlich aus einer Kollektion von Valentino von vor zwei Jahren.
Hatte sie die Zeit verschlafen? Hielten ihr Geschmack und ihr Modebewusstsein nicht mehr mit der Moderne mit?
Doch das ließ sich bestimmt ohne großes Problem korrigieren. Gleich morgen früh würde sie losziehen, nach Lausanne oder noch besser gleich nach Genf fahren und dort für eine neue Garderobe sorgen. Vielleicht kam sogar Jules mit und half bei der Auswahl? Denn auf den Geschmack ihres Ehemanns konnte sie sich zu hundert Prozent verlassen. Wenn auch immer er ein Kleidungsstück anpries, dann war es entweder längst aus der Mode gekommen, hatte eine völlig falsche Farben oder wies einen schrecklichen Schnitt auf und sie konnte es getrost vergessen.
Alabima schmunzelte bei diesen Bildern vor ihren Augen und sah sich erneut wohlgefällig im Wandspiegel an.
*
Philippinen
Man traf sich nicht in einem Regierungsgebäude, sondern in den Büros der halbstaatlichen San Miguel Corporation. 1890 als Bierbrauerei gegründet, war San Miguel nicht nur zum größten Lebensmittel- und Getränkehersteller Südostasiens gewachsen, hatte seine gierigen Finger zudem längst im Energiesektor und in der Infrastruktur stecken. Fernando Rizal war ein enger Vertrauter von Präsident Duterte, hatte ihm schon in den Jahren als Bürgermeister von Davao City treue Dienste geleistet. Der Empfang einer hochrangigen Delegation aus China war für den fünfunddreißigjährigen, hoch aufgeschossenen Mann mit dem schwarzen, glatten und modisch kurz geschnittenen Haar und dem etwas altmodischen Soul Patch Unterlippenbart eigentlich längst zur Routine geworden. Doch an diesem Morgen ging es um Geld, um sehr viel Geld, wie er wusste. Und so fühlte sich der Mann aus Mindanao seit seinem viel zu frühen Aufwachen am Morgen höchst angespannt.
Liu Jintao führte die Männer aus dem Land des Lächelns an. Er war derzeit noch erster Sekretär des Wirtschaftsministers, doch längst auf dem Sprung ins Polit-Büro. Die anstehenden, als sehr schwierig eingestuften Verhandlungen auf den Philippinen galten als eigentliche Bewährungsprobe für zukünftig höhere Aufgaben im Apparat der Kommunistischen Partei. Liu Jintao wurde von Fan Leji und Meng Yang begleitet. Sie gehörten nicht dem Wirtschaftsministerium an, sondern waren erfahrene Geheimdienstleute, hoch spezialisierte Analysten. Sie spielten auch nicht Kindermädchen für den Sekretär des Wirtschaftsministers, sondern sollten die philippinischen Verhandlungsführer einschätzen und wenn immer möglich aushorchen.
Fernando Rizal wollte keine Zeugen des Gesprächs, hatte deshalb die gesamte Etage im achtstöckigen Verwaltungsgebäude räumen lassen, saß mit seinen drei Gästen in einem mit breiten Ledersesseln eingerichteten, großzügigen Sitzungsraum zusammen. Tee und Kaffee standen in Kannen bereit. Dazu gab es Dim Sum in einer Warmhaltebox. Rizal fragte die Chinesen nach ihren Wünschen und bediente sie vom Beistelltisch, bevor er sich selbst mit einer Tasse Kaffee zu ihnen setzte.
»Dieses Meeting wird nicht aufgezeichnet. Ich werde auch kein Gedächtnisprotokoll erstellen, sondern den Präsidenten hinterher ausschließlich mündlich über den Inhalt unseres Gesprächs und über die eventuellen Vereinbarungen berichten«, stellte der Vertraute von Duterte klar.
Liu Jintao nickte zustimmend und durchaus zufrieden. Fan Leji und Meng Yang verzogen keine Miene, so als hätten sie gar nichts verstanden.
»Unsere beiden Länder stehen erst ganz am Anfang neuer und tiefer gehender Beziehungen«, begann der chinesische Delegationsleiter salbungsvoll, »doch selbstverständlich hoffen wir auf rasche und höchst fruchtbare Abschlüsse für beide Seiten. Unsere heutige Zusammenkunft sollten wir nutzen, die ungefähren Bereiche und die groben Rahmen abzustecken, in denen wir zukünftig detailliertere Pläne ausarbeiten und Übereinkünfte abschließen. Sie sprechen im Namen von Präsident Duterte?«
Fernando Rizal nickte zustimmend und auch ein wenig stolz: »Der Präsident hat mir weitreichende Kompetenzen eingeräumt. Ich nehme an, Sie haben gewisse Vorschläge bereits ausgearbeitet?«
Erneut nickte Liu Jintao und zog aus einer Mappe ein einfaches Blatt Papier, reichte es wortlos dem Philippinen. Der schien die Notizen bloß zu überfliegen, schaute nach exakt fünfundzwanzig Sekunden die drei Chinesen lächelnd an.
»Mit vielen Ihrer Ideen können wir uns bestimmt anfreunden. Manche allerdings stehen derzeit nicht zur Verhandlung. Auch scheinen mir einige der aufgeführten Summen nicht unbedingt der Tragweite und der Wichtigkeit Ihrer Ideen angemessen.«
Zu diesem leichten Tadel lächelte der Fünfunddreißigjährige entwaffnend und entschuldigend. Auch Liu Jintao lächelte, wenn auch ein wenig gequält.
»Selbstverständlich handelt es sich bei dieser Liste nur um einen ersten Entwurf, den wir am besten Punkt für Punkt durchgehen, während wir die nächsten Schritte gemeinsam festlegen.«
In den nächsten fünfundvierzig Minuten sprach man über chinesische Investitionen in verschiedenen Philippinischen Häfen, über den Bau einer neuen Autobahnverbindung zwischen Manila und Cabanatuan, dem Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Bahnnetzes zwischen allen Wirtschaftszentren des Landes, aber auch über verschiedene neue, kulturelle Einrichtungen, die China seinen neuen Freunden und Partnern auf den Philippinen schenken wollte.
»Eine chinesische Militärbasis müssen wir allerdings ablehnen«, gab Fernando Rizal bedauernd und mit den Schultern zuckend bekannt, »Präsident Duterte kann die USA derzeit nicht vollends brüskieren. Auch würde unsere Bevölkerung Stützpunkte von zwei konkurrierenden Großmächten im Land kaum akzeptieren.«
»Es gibt immer Mittel und Wege ...«, meinte Liu Jintao und wirkte das erste Mal scharf wie ein Rasiermesser. Denn China brauchte mittelfristig eine Militärbasis in der Region, wollte das Riesenreich irgendwann die USA als lokale Weltpolizei ablösen, » ... unsere Führung wäre in diesem Punkt mit Sicherheit zu weitgehenden Zugeständnissen bereit ...«
Rizal leckte sich über die Lippen, so als könnte er die Süße eines immensen Geldstroms bereits darauf schmecken.
»Ich werde meinen Präsidenten entsprechend informieren. Aber bitte, rechnen Sie nicht mit einer raschen Lösung. Die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Bindungen meines Landes an die USA sind vielfältig und weit weniger fragil, als man womöglich auf den ersten Blick von außen vermuten könnte. Entsprechend umsichtig muss jede Vorgehensweise sein.«
Liu Jintao lächelte verbindlich, dachte jedoch ganz anders. Selbstverständlich war der Plan, die Philippinen und die USA auf Dauer zu trennen, auf diese Weise die bisherige Stabilität im südchinesischen Meer aufzuweichen und China in der gesamten Region als neuen und ersten Garanten für Wirtschaft und Verteidigung zu etablieren. Falls die Philippinen nicht mitspielen sollten, gab es Alternativen wie Malaysia, auch wenn der dortige Präsident derzeit durch die Skandale rund um den Staatsfonds 1MDB arg geschwächt schien.
»Der chinesischen Führung liegt eine starke und dauerhafte Verbindung zwischen unseren Ländern sehr am Herzen. Und im selben Masse, wie sich der amerikanische Einfluss in der Region seit der Wahl des früheren US-Präsidenten Obama spürbar verringert hat, möchte China diese Lücken füllen, im Interesse und zur Sicherheit aller Länder im und am südchinesischen Meer.«
Das war Warnung genug an die Adresse von Fernando Rizal und damit auch an seinen Präsidenten Rodrigo Duterte, den Bogen nicht zu überspannen. China war bereit, viel Geld in seine Hände zu nehmen, jedoch nicht bereit, sich über den Tisch ziehen zu lassen.
Rizal lächelte ebenso verbindlich.
»Reden wir doch noch über einige Zahlen«, meinte er freundlich, beinahe einschmeichelnd, denn nur darauf kam es seinem Präsidenten letztendlich an, »wir sprechen bei den Hafenanlagen, der Autobahn und den Eisenbahnstrecken von einem Investitionsvolumen von über zwei Billionen Peso?«
»Zwei Komma drei Billionen, falls chinesische Unternehmen den Großteil der Bauarbeiten übernehmen, zwei Komma neun bis drei Billionen, falls wir nur die Ingenieurleistungen erbringen und die eigentlichen Bauten durch einheimische Subunternehmen erstellt werden.«
»Und China gewährt den Philippinen einen entsprechend hohen Kredit? Zu welchen Bedingungen?«
»Ein halber Prozentpunkt mehr, als der jeweilige Leitzins Ihrer Zentralbank.«
»Also drei Komma fünf derzeit?«
»Ja, genau.«
»Und der halbe Prozentpunkt?«
»Der wird selbstredend zur alleinigen Verfügung von Präsident Duterte stehen. Zwanzig Jahre lang werden wir das halbe Prozent auf den noch nicht zurückbezahlten Schulden auf diejenigen Konten und in denjenigen Währungen überweisen, die Sie uns nennen.«
Fernando Rizal rechnete im Kopf überschlagsmäßig nach und kam auf zwei bis vier Milliarden US-Dollar, die sein Präsident in den nächsten beiden Jahrzehnten abkassieren konnte, falls die Pläne der Chinesen aufgingen.
»Und wenn wir China eine Militärbasis zur Verfügung stellen sollten?«, provozierte der Vertraute von Duterte ein verbessertes Angebot.
»Dann werden sich die Zahlungen auf ein Prozent verdoppeln.«
Fernando Rizal fühlte den kalten Schauder, der ihm über den Rücken kroch. Niemals hätten er oder sein Präsident von solchen Summen geträumt, Milliarden von US-Dollar, versprochen vom großen China und unauffällig über einen langen Zeitraum verteilt von guten Freunden an einen guten Freund überwiesen.
Die vier Männer beendeten das Meeting lächelnd und lachend, bezeugten einander gegenseitige allen Respekt. Und während die drei Chinesen zurück ins Hotel fuhren, traf sich Fernando Rizal bereits mit Präsident Duterte, der die Versammlung in der Universität etwas vorzeitiger als ursprünglich geplant verlassen hatte, um so rasch als möglich durch seinen Vertrauten informiert zu werden.
Höchst zufrieden grinste Duterte, als er sich von Rizal die Summen vorrechnen ließ, hatte ein überhebliches Leuchten im Gesicht, das ihn in den Augen so vieler philippinischer Wähler ausgesprochen kompetent und durchsetzungsstark erscheinen ließ.
Rodrigo Duterte nahm sich den Nachmittag frei und kehrte in sein Haus zurück, wo ihn seine Lebensgefährtin Honeylet Avanceña aufgrund seines Anrufs erwartete.
»Ist was passiert?«, fragte die Frau etwas Bange, »warum kommst du so früh zurück? Heute Morgen hast du noch gesagt, es werde mindestens acht Uhr abends?«
Duterte grinste breit und siegessicher.
»Heute waren die Chinesen hier. Fernando Rizal hat sie begrüßt und bei ihnen vorgefühlt. China plant Investitionen in Billionenhöhe hier bei uns. Wir müssen ihnen bloß ein wenig entgegenkommen.«
»Und was heißt das? Dieses Entgegenkommen?«
»Wir müssen die Amerikaner los werden.«
Honeylet Avanceña runzelte ihre Stirn.
»Die USA loswerden?«, fragte sie erstaunt. Dass die Frau nicht auf den Kopf gefallen war, bewies sie mit ihrer nächsten Frage: »Und dafür die Chinesen zu uns einladen? Ihnen vielleicht sogar militärische Stückpunkte einrichten lassen?«
Duterte grinste erneut und ließ als Antwort nur seine Augen aufleuchten.
»Und was bringt uns das?«, fragte die Frau äußerst geschäftstüchtig zurück.
»Bis zu acht Milliarden amerikanische Dollar«, gab ihr Lebenspartner triumphierend zurück.
»Wie? Acht Milliarden?«, schien Honeylet Avanceña nicht zu verstehen.
»China investiert 30 bis 40 Milliarden US-Dollars bei uns, gewährt uns dafür entsprechenden Kredit und leitet von den Zinszahlungen des Staates einen kleinen Betrag direkt auf unsere privaten Konten um. Und das für die nächsten zwanzig Jahre.«
Die Frau schüttelte irritiert den Kopf.
»Du meinst, du kassierst acht Milliarden Dollar? Privat? Auf deine Konten?«
Duterte nickte lächelnd: »Als eine Art von Vermittlungsgebühr.«
»Und die Chinesen übernehmen dafür unser Land? Unsere Wirtschaft«, warf die Frau zweifelnd und beinahe erschütternd ein.
»Nicht mehr, als es heute die US-Amerikaner tun«, gab der Präsident etwas unwirsch zurück, »ich wechsle bloß unsere Schutzmacht aus und verdiene dabei ein wenig Geld. Niemand kommt zu Schaden. Alle profitieren.«
»Und die vierzig Milliarden US-Dollar an Schulden, die du unserem Land aufbürdest? Das ist doch Wahnsinn?«
»Wenn ich es nicht mache, wird’s mein Nachfolger tun. Du weißt genau, wie der Marcos-Clan tickt und dass er längst wieder Ambitionen zur Machtergreifung zeigt. Sie lassen mich vorerst noch gewähren, suchen sogar meine Freundschaft. Diese wenigen Jahre müssen wir unter allen Umständen für uns nutzen. Schon im Interesse unserer Kinder und Enkelkinder.«
Honeylet Avanceña sagte nichts darauf, schien sehr nachdenklich geworden, ja fast ängstlich.
»Sich mit den Amerikanern anlegen?«, sagte sie leise zu sich selbst, als Duterte längst den Raum verlassen hatte, »kann das gut gehen?«
*
Brasilien
»Schau dir das hier mal an, Naara«, verlangte Sihena und deutete auf ihr rechtes Nasenloch, hob das Kinn etwas an und legte ihren Kopf in den Nacken. Das Dienstmädchen trat zwei Schritte näher, schaute scheu hinein, trat wieder einen Schritt zurück.
»Meinen Sie die Haare, Senhora Ling?«
»Die Haare? Welche Haare? Nein, du dummes Huhn. Den Fleck hier«, und sie deutete mit dem Zeigefinger ungefähr auf den Punkt, »bist du blind?«
Noch einmal musterte die junge Frau die Nase ihrer Dienstherrin.
»Ein Altersfleck vielleicht?«, mutmaßte sie, erhielt zum Dank einen vernichtenden Blick von Sihena.
»Du bist und bleibst ein unbedarftes Ding, Naara«, verbat sich die chinesisch-stämmige Brasilianerin jeden Bezug auf ihre dreiundfünfzig, »geh rasch hinunter in die Küche und hol Marta hoch.«
Die junge Frau verschwand wie der Blitz, froh genug, der kritischen Sihena vorerst entkommen zu sein.
»Die spinnt doch«, beklagte sie sich wenig später bei der Köchin, »hat irgendwelchen Dreck in der Nase und will wissen, woher er kommt oder was das ist. Du sollst zu ihr hoch gehen und es dir ebenfalls ansehen.«
Marta seufzte, legte das Schälmesser auf die Ablage, ließ die Süßkartoffel zurück ins Becken plumpsen, seufzte noch einmal und setzte sich in Bewegung.
»Warum dauert das so lange«, beschwerte sich Sihena bei den beiden, als sie in das Schlafzimmer ihrer Arbeitgeberin traten.
»Bin keine zwanzig mehr«, meinte Marta auf eine mundfaule, störrische Art, auf die Sihena diesmal allerdings nicht scharf antwortete.
»Schau dir den Fleck hier an und sag mir, was du von ihm hältst.«
Marta ging zum Schemel vor dem Schminktisch, beugte sich vor und blickte in das angewiesene Nasenloch. Sie sah einen kleinen braunen Fleck, bei weitem nicht so dunkel wie ein Muttermal, eher ein gelb-braun mit Ausläufern.
»Gürtelrose?«, fragte sie die Hausherrin, »allerdings winzig klein und kaum zu sehen.«
»Meinst du?«, die Stimme von Sihena klang irgendwie erleichtert, wenn auch weiterhin angespannt, »nur eine Gürtelrose? Und ich dachte schon ...«
Sie beendete ihre eigene Diagnose nicht, sondern sah ihre Köchin eindringlich an, forderte von ihr weitere Klarstellung und Analyse.
»Schon eine etwas seltsame Stelle«, entschied Marta pflichtbewusst und fügte dann hinzu, »für eine Gürtelrose genauso, wie für Hautkrebs.«
Während sie den Satz beendete, verspürte die Köchin eine gewisse Schadenfreude, vor allem, als sie das entsetzt blickende Gesicht ihrer Dienstherrin erkannte.
»Hautkrebs?«, flüsterte die Chinesisch-stämmige mehr zu sich selbst als zu ihren Angestellten, »Hautkrebs?«
Ihre Schultern sanken ein und ihr Oberkörper beugte sich, als plagten sie plötzlich Bauchschmerzen.
»Hautkrebs!«
Das Wort sprach sie wie das Urteil über ihr restliches Leben aus, das nun zwangsläufig im Siechtum enden musste.
»Und wenn schon«, warf Naara tröstend ein, »der Fleck ist doch winzig?«
Dafür erhielt sie von Sihena einen höchst gehässigen Blick, ähnlich einem Fuchs, der bereits von der Hundemeute gestellt war und dem Tod ins Augen blicken musste, jedoch noch einen letzten, verbissenen und verbiesterten Kampf liefern wollte.
»Du dummes Huhn. Du Idiotin. Du Scheusal«, fuhr sie ihre junge Angestellte an, »scher dich weg, du Nichtsnutz, bevor ich dich anspucke.«
Naara rannte schluchzend hinaus auf den Flur und von dort die Treppe hinunter. Sie würde sich wie so oft in die Küche flüchten, auch wenn dort die stets tröstende Marta derzeit nicht anzutreffen war.
»Dämliche Kuh«, rief Sihena ihr noch nach, schaute dann Marta an.
»Gürtelrose«, wiederholte die chinesisch-stämmige Unternehmerin die erste Diagnose ihrer Köchin, »hoffentlich nur eine Gürtelrose.«
»Eine Tante von mir hatte auch einmal einen ähnlichen Flecken an der Nase. Allerdings auf der Außenseite«, begann Marta zu erzählen.
»Und?«
»Der Arzt meinte, sie solle ihn beobachten, ob er in den nächsten Wochen weiter anwächst oder gleich groß bleibt.«
»Was war denn das für ein Quacksalber?«, ereiferte sich Sihena sogleich, »völlig unverantwortlich einfach abzuwarten.«
»Dr. Sanchez genießt einen sehr guten Ruf im Quartier. Alle gehen zu ihm hin«, verteidigte die Köchin den Allgemeinpraktiker.
»Was kümmert mich die Meinung deines Kurpfuschers«, urteilte die Chinesisch-stämmige über den ihr gänzlich unbekannten Arzt, »mit Hautkrebs spielt man doch nicht? Da zählt jeder Tag. Glaub ich wenigstens. Ich ruf sofort die Klinik an. Die haben bestimmt Haut- und Krebsspezialisten. Hoffentlich bekomm ich noch für heute einen Termin?«
Die letzten beiden Sätze hatte die Frau bereits mehr zu sich selbst gesprochen, hatte sich auch von Marta weggedreht und zog nun den Telefonapparat zu sich her. Sie rief die Auskunft an, ließ sich die Nummer der Clinica Cristo Rei geben, schrieb sie auf und wählte danach den Anschluss. Nein, sie bekam an diesem Tag keinen Termin mehr, auch nicht für den nächsten. Erst am Donnerstag hatte jemand Zeit für sie.
»Eine Frechheit«, urteilte Sihena, nachdem sie aufgelegt hatte, schaute dabei Marta mit einer Miene an, als wäre die Köchin schuld an der Verzögerung.
»Meine Tante wartete sechs Monate auf einen Termin beim Spezialisten. Und sie musste im Voraus 400 Real bezahlen, nur für die Untersuchung.«
»Aber ich bin Privat-Patientin«, bemängelte die chinesisch-stämmige Brasilianerin sogleich den in ihren Augen völlig unzulänglichen Vergleich der Köchin mit einer ihrer armen Verwandten, »und sie kennen mich doch bestens im Cristo Rei. Immerhin habe ich alle meine Kinder dort geboren.«
Marta Gonzales-Vinerva ließ sich nicht beirren, im Gegenteil, sie wagte sogar Widerspruch: »Vor Gott, unserem Herrn, sind wir alle gleich.«
»Was faselst du da? Wieder diesen christlichen Unsinn? Religion ist doch bloß etwas für Rückständige und Minderbemittelte«, und sie drehte gleichzeitig ihren Zeigefinger um ihre rechte Schläfe, als müsste sie ein winzig kleines Spinnrad damit antreiben, »Opium fürs Volk, so hat Karl Marx die Religionen bezeichnet. Eine Droge für die geistig Schwachen. Ein Seelentröster für Naive.«
»Haben Sie sonst noch Wünsche an mich?«, fragte die Köchin äußerst reserviert zurück. Denn an ihrem Glauben ließ sie nicht rütteln. Der liebe Gott hatte sie in diese Welt gesetzt, hatte sie zu einer Dienstmagd gemacht, mit einem gewalttätigen Säufer als Lebenspartner. Das waren die ihr auferlegten Prüfungen in ihrem Leben, die sie gottgefällig zu meistern hatte, um dereinst Eingang ins Himmelsreich zu erhalten. Die chinesische Schlampe hingegen, die so überheblich auf ihrem Schemel vor dem Schminktisch saß, bekleidet nur mit einem leichten Morgenmantel aus kostbarer Seide und hoffentlich mit Krebs in der Nase, die würde auf jeden Fall in der Hölle schmoren müssen, für alle Ewigkeiten. Daran glaubte die Brasilianerin nicht nur, das war für sie längst beschlossene Sache. Sollten sich doch die Reichen dieser Welt ein kurzes Leben lang über alle Armen erheben, sie schinden und ausbeuten. Der endgültigen Schlussabrechnung konnte kein einziger von ihnen entgehen. Sie alle würden bei der großen Prüfung versagen und darum dem Teufel in der Hölle für alle Zeiten dienen müssen. Der würde sie für all ihre Sünden bis ans Ende der Tage quälen und peinigen. So hatte sie es bereits als kleines Mädchen gelernt, als sie mit ihren langen Zöpfen mit den schönen Schleifen in den Religionsunterricht ging, zu Pater Andreas, einem Franziskaner aus Brasilia, ein höchst intelligenter und kluger Mann, der weit mehr vom Leben und vom Tod wusste, als sämtliche Reichen Brasiliens zusammengenommen.
Sihena hatte ihre Köchin stumm und auch ein wenig erstaunt betrachtet, so als hätte sie ihre Gedanken gelesen. Der Ausdruck im Gesicht von Marta irritierte sie tatsächlich, zeigte er doch eine Zufriedenheit und eine Ruhe, auch eine Sicherheit, mit der die Hausherrin nichts anzufangen wusste.
»Nein, das ist alles«, meinte sie abschließend, »was gibt’s zum Mittagessen?«
»Ein Soufflé aus Süßkartoffeln und Mohrrüben. Dazu gegrillten Barsch«, antwortete sie pflichtbewusst.
»Lass aber diesmal den Fisch nicht wieder anbrennen«, schoss die Hausherrin einen weiteren, ungerechten Pfeil ab, denn noch nie hatte Marta in der Vergangenheit angekokelten Fisch serviert.
»Ich gebe mir jede Mühe«, bekannte die Köchin trotz der böswilligen Unterstellung gelassen, bevor sie sich in den Flur zurückzog und die Türe hinter sich leise schloss.
»Soll doch die dämliche Chinesen-Kuh vor Angst sterben«, dachte sie halblaut, während sie die Treppe hinunter ins Kellergeschoss mit ihrer Küche stieg, »und ich werde auch Naara entsprechend einweisen. Wäre doch gelacht, wenn wir dieser hochnäsigen Sklaventreiberin keinen gehörigen Schrecken einimpfen könnten, bevor sie in zwei Tagen von ihrem exklusiven Arzt in der Nobelklinik untersucht wird.«
Sie lächelte zu ihren bösen Gedanken, fast schon diabolisch, zumindest mit einer teuflischen Vorfreude.
»Ich werd gleich heute Abend in die Igreja Santa Ines gehen und dort zwei Kerzen anzünden«, nahm sich die brasilianische Köchin vor, »eine für mein Seelenheil und eine für den Krebs von Madama.«
*
Nordkorea
Kaum ein Tag war vergangen, an dem der Große Führer, Genosse Kim Jong-un, nicht die Einheit der Nation übers Fernsehen beschworen und seine Vorwürfe und Warnungen an die Klassenfeinde Nordkoreas erneuert hätte. In wenigen Tagen beging man gemeinsam den 64. Jahrestag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg. Auch das 3. Panzerregiment aus dem Goljjagi Gidae nahm an der Militärparade teil, würde vor dem Großen Führer und der Parteispitze mit den zehn verfügbaren modernen Panzern aus chinesischer Produktion defilieren und der Bevölkerung und der gesamten Welt die Kampf- und Opfer-Bereitschaft der nordkoreanischen Volksarmee einmal mehr vorführen.
Chungwi Seung-zin und Chungwi Chol-hwan würden jeweils mit ihren Mannschaften daran teilnehmen. Seit Tagen wurde dafür geprobt, um auch jede Kleinigkeit fehlerfrei auszuführen. So etwas wie Stolz hatte sich in den Herzen der beiden Leutnants und ihren Soldaten breit gemacht, Stolz auf das Manöver und dass sie aus Dutzenden von Bewerbern ausgewählt wurden, aber auch Stolz auf ihren Großen Führer, der das Land fest zusammenhielt und es vor all den Feinden rings herum heroisch verteidigte.
Längst hatten die beiden Leutnants auch ihre Mannschaften auf die Möglichkeit von Kollaborateuren mit dem feindlichen Ausland in den eigenen Reihen eingeschworen. Denn hatte nicht Genosse Kim Jong-un persönlich alle Bürger zur Wachsamkeit aufgerufen? Gemeinsam hatten die Soldaten begonnen, alle Vorgesetzten bis hoch zu Oberst Syng-man heimlich zu überwachen und jeden ihrer Schritte zu protokollieren. Mit wem sprachen sie, zu wem gingen sie, wie lange hielten sie sich wo auf. Je länger sie diese Leute belauerten, desto mehr Verdachtsmomente kamen zusammen.
Da war beispielsweise eine russische Delegation vor einer Woche eingetroffen, hatte sich im Gästehaus der Kaserne breit gemacht, sprachen mit allen hohen Militärs des Stützpunkts, schienen sich vor allem für die Ausrüstung und die Abläufe zu interessieren, erhielten wohl auch umfassende Informationen. Doch wie passten die Russen ins Bild des vorwiegend westlichen Feindes? Die Mannschaft spekulierte unter sich. Womöglich waren auch die Russen längst von den Amerikanern oder den Japanern gekauft worden, verrieten ihr eigenes Land und bauten unter den Militärs Nordkorea eine heimliche Allianz auf? Schmiedeten Pläne gegen den Großen Führer? Organisierten den Umsturz? Alles war diesen Barbaren im Westen zuzutrauen.
Immer noch patrouillierten die Amerikaner mit ihrer Fregatte und all den anderen Kriegsschiffen vor der Küste Nordkoreas, hielten eine unerträgliche Drohkulisse aufrecht. Sie wollten die redlichen Kräfte im Land verunsichern und ihre Moral untergraben. Die russische Delegation passte perfekt in dieses Bild. Von außen durch die USA in die Zange genommen. Von innen durch Russland weiter geschwächt. Womöglich spannten die beiden Weltmächte diesmal wirklich zusammen? Hatte sich dieser Trump nicht vor Kurzem mit Putin getroffen? Was hatten die beiden Machthaber hinter verschlossenen Türen verhandelt? Von Ergebnissen hatte niemand gesprochen. Doch wer redete schon stundenlang miteinander, ohne konkrete Pläne zu schmieden? Und hatte der Große Führer und Genosse Kim Jong-un nicht exakt auf diese Art von Verschwörung hingewiesen?
Auffallend oft waren die Russen mit Oberst Syng-man zusammen. Sie scherzten und lachten viel, als müssten sie ihre wahren Absichten verbergen. Doch die beiden Chungwis würden wachsam bleiben, zusammen mit ihrer Mannschaft. Man hatte sich auch mit anderen Leutnants und sogar ihren Oberleutnants abgesprochen. Die Führungskräfte der Garnison blieben so rund um die Uhr überwacht, jeder Schritt von ihnen minutiös registriert und aufgezeichnet. Noch lagen keine eindeutigen Beweise vor. Doch das konnte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein. Da waren sich Chang Seung-zin, Ri Chol-hwan und all die anderen Beteiligten längst sicher.
Und dann...?
Der Große Führer und Genosse Kim Jong-un würde Stolz auf sie und ihre Wachsamkeit sein.
Die Parade lief genauso ab, wie sie geplant und geprobt war. Man hatte die Panzer schon am Vortag zum Versammlungsplatz transportiert. Um fünf Uhr morgens reihte man sich in die unendlich scheinende Schlange an Truppenverbänden und Waffengattungen ein. Um sieben Uhr kam der Befehl zur jederzeitigen Bereitschaft. Sicherheitshalber wurden alle Motoren noch einmal gestartet und auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Danach kehrte wieder Ruhe ein in die lange Reihe von Männern, Frauen und Maschinen. Um elf Uhr vormittags schien es dann endgültig los zu gehen. Weit, weit vorne, kaum noch erkennbar, stiegen erste Rauchwolken in den Himmel, waren auch zwar ganz leise, aber doch unverkennbar Motorengeräusche zu vernehmen. Wenig später kam auch in der Umgebung des 3. Panzerregiments einige Bewegung und wenig später sogar Hektik auf. Oberstleutnants telefonierten mit den Organisatoren der Parade, gaben über ihre Hauptmänner Befehle weiter. Irgendwann erfolgte dann das Kommando an die Panzer-Mannschaften, die Motoren zu starten. Es war gegen zwölf Uhr. Und dann setzten sich die zehn wuchtigen Maschinen schwerfällig und trotzdem vor Kraft strotzend in Gang, folgten den Raketen-tragenden Fahrzeugen des 2. Flugabwehr-Regiments.
Chang Seung-zin und Ri Chol-hwan hatten diese Waffen am Vorabend noch bestaunt, diese riesigen Stahlkörper, die Atomsprengköpfe tragen konnten und den Feind im Ausland in Furcht und Schrecken versetzten. Allerdings erkannten auch die beiden Leutnants des Panzer-Regiments, dass diese mächtigen Raketen mit Sicherheit keinen Treibstoff enthielten, dass sie zudem mehr Hülle waren, als Gefahr. Ihre diesbezüglichen Fragen bei den Kameraden wurden allesamt unwirsch abgewiesen.
Was ihnen eigentlich einfiele und dass sie sich um ihren eigenen Kram kümmern sollten.
Etwas beleidigt waren die beiden Chungwis abgezogen, hatten ihre Mannschaften zusammengerufen und ihren Verdacht vorgebracht. Man war bald einmal der einhelligen Meinung, dass wohl gewisse Teile des Militärs ihrem Großen Führer etwas vorspiegelten, das gar nicht stimmte. Denn dass diese riesigen Raketen jemals ein Ziel punktgenau erreichen sollten, konnte man ihnen wirklich nicht ansehen.
So wirkten diese jungen Soldaten wie ein verlorener Haufen von Aufrechten in einer gänzlich maroden und korrupten Welt, diese vierzehn Männer und Frauen. Und doch waren sie eine eingeschworene und verschworene Gemeinschaft. Denn sie würden fest bleiben, gegen alle Widrigkeiten und zum Wohle von Volk und Nation, selbst wenn es gegen ihre eigenen Vorgesetzten ginge und den eigenen Tod bedeutete.
Das Volk ist die Basis des Staates und die Volksarmee seine Speerspitze.
So hatten sie es gelernt, schon als Kind in der Schule und später auf der Militär-Akademie. Daran gab es nichts zu rütteln, denn es war die Grundlage Nordkoreas. Irgendwie fühlten sie trotz ihrer Verunsicherung einen wachsenden Stolz, diese jungen Männer und die beiden Frauen. Ihre Ehre war unantastbar, ihre Gesinnung dauerhaft und gut. Genosse Kim Jong-un konnte sich auf sie verlassen, egal, was auch geschehen sollte.
Sobald sie zurück in ihrer Garnison waren, am nächsten oder übernächsten Tag, würden sie die Überwachung ihrer Vorgesetzten noch umfassender und lückenloser organisieren. Denn der Feind lauerte überall, konnte jederzeit losschlagen. Sie alle hatten sich auch sehr darüber gewundert, dass ihr Kommandant, Oberst Chung Syng-man, nicht mit ihnen zusammen nach Pjöngjang gereist war, warum er der Parade und ihren Vorbereitungen fern blieb. War das nicht ein zwingender Beweis für seine wahre Gesinnung? Oder zumindest ein wichtiges Indiz? Ein Zeichen seiner Dekadenz und seiner Korruption?
»Bleib wachsam.«
Das war zum geflügelten Wort unter ihnen geworden. Damit spornte sie sich gegenseitig an, zogen am selben Strick, würden sich bestimmt nicht übertölpeln oder gar missbrauchen lassen.
Selbstverständlich waren diese jungen Soldaten bestens darin angewiesen und ausgebildet, jeden Befehl, und mochte er auch noch so abstrus oder falsch erscheinen, bedingungs- und widerspruchslos auszuführen. Doch dem Feind direkt in die Hände spielen? Nicht mit ihnen, nicht mit den beiden Mannschaften des 3. Panzerregiments und ihren Verbündeten Chungwis, selbst wenn das im ersten Moment Meuterei bedeuten musste.
»Es gibt im Leben eines jeden aufrechten Mannes, eines jeden aufrechten Soldaten, der Punkt, an dem er nicht weichen darf, egal, was auch immer es ihn kostet.«
So hatten sie sich aufeinander eingeschworen und sich gegenseitig Mut gemacht.
Wie stolz sie sich doch alle fühlten, als sie langsam an der riesigen Tribüne mit all den wichtigen Männern und Frauen des Landes vorbeifuhren, die Hand steif und unbeweglich zum Gruß erhoben, die Augen geradeaus, den Körper gestählt und gestrafft. Sie waren das Rückgrat der Nation, unbeirrt und unbezwingbar.
Stunden später hatten sie sich glücklich in ihre Zelte zurückgezogen, im Wissen darüber, vom Großen Führer Kim Jong-un wahrgenommen worden zu sein. Denn hatte er sie nicht gemustert und bewertet? Spielte nicht ein anerkennendes Lächeln um seine Lippen, als er ihre große Kampfkraft und ihre völlige Bereitschaft spürte und erkannte? Ihren Wille, das eigene Leben für das Land und das Volk jederzeit hinzugeben?
Konnte man mehr lieben?
Und geliebt werden?
*
Schweiz
Was tun, wenn der Feind einem zu stark erschien? Die Antwort lautete, sich mit ihm verbünden. Und so lud Alina Lederer die unerträgliche Susanne und den idiotischen Stefan nebst ein paar anderen Rädelsführern aus ihrer Klasse zu einer Pool-Party zu sich nach Hause ein. Ihre Maman hatte dazu einen Catering-Service angestellt. Der würde die jungen Gäste mit frisch gebratenen Hamburgern und italienischem Eis verwöhnen. Und Alina hatte eigenständig alle Luftmatratzen und Wasserbälle herangeschafft, die sie nur finden konnte, hatte sie aufgeblasen und bereit gelegt. Auch waren genügend Liegen und Stühle für alle vorhanden. Nicht zuletzt stellte Alina auch eine Liste mit möglichen Spielen zusammen, so, wie zuvor im Internet recherchiert. Alles stand bereit für die große Feier und damit für die zukünftige Akzeptanz in ihrer neuen Schulklasse. Denn waren großzügige Menschen und gute Gastgeber nicht überall auf der Welt beliebt?
Alina hatte auf halb zwei Uhr eingeladen, wartete eine Stunde vorher schon ungeduldig auf die ersten Gäste, wanderte unruhig vom Haus zum Pool und zurück, las noch einmal die Liste der Spiele durch, stellte sich vor, wie sie sich köstlich amüsierten, rannte noch einmal hoch und auf ihr Zimmer und holte von dort das Federballspiel nach unten, legte es auf einem Tisch bereit, kontrollierte auch die Vorräte an kühl gestellten Getränken zum wiederholten Mal, beobachtete die Leute vom Catering-Service und ihre Vorbereitungen.
Es wurde halb zwei, dann viertel vor. Später schlug die Kirchturmuhr zwei. Immer noch war keiner ihrer acht geladenen Schulkameraden eingetroffen. Selbst die Leute vom Party-Service begannen sich zu wundern, warfen nun ihrerseits immer wieder schräge Blicke zu Alina hinüber, die längst an einem der Tische auf einem der Gartenstühle unter einem der Sonnenschirme saß, ihren Kopf traurig auf den Handballen aufgestützt hielt und am liebsten losgeheult hätte. Nur der Stolz und ihr Trotz hielten die Tränen noch zurück.
Maman war an diesem Nachmittag wie versprochen in die Stadt gefahren. Denn Alina wollte als alleinige und verantwortliche Gastgeberin auftreten und so auch allen Ruhm für sich allein einheimsen. Und ihr Vater war eh für ein paar Tage verreist, besuchte einen Bekannten oder früheren Geschäftspartner in Schweden oder Norwegen. So genau hatte sie ihm nicht zugehört.
Den ganzen Ruhm hatte sie für sich einheimsen wollen.
Stattdessen halste sie sich nun die gesamte Scham auf.
Irgendwann trat der Chef des Catering-Unternehmens zu ihr.
»Immer noch niemand eingetroffen?«, fragte er unnötigerweise nach. Alina blickte hoch, sah ihn an, kämpfte mit den Tränen.
»Non«, stieß sie hervor, wütend und gleichzeitig verzweifelt.
»Kommen noch welche? Willst du sie nicht anrufen? Womöglich hat sie etwas aufgehalten?«
Alina staunte den Mann wortlos an. Wie konnte man nur so dämlich sein?
»Vielleicht haben sich deine Gäste auch nur den falschen Termin notiert?«
Alina runzelte ihre Stirn, sah den Mann voller verzweifelter Not an, hätte sich am liebsten in ein Erdloch verkrochen. Der hob nun hilflos seine Schultern, ließ sie wieder sinken.
»Also gebucht wurden wir bis sechs Uhr abends«, stellte er ohne Sinn und Not fest, bevor er wieder zu den anderen hinüberging, dabei seinen Kopf verneinend schüttelte.
Alina blieb auf dem Stuhl sitzen, starrte vor sich auf die Tischplatte, hörte um sich herum die Geräusche der Natur, das Säuseln des Windes, das Plätschern des nahen See-Ufers, die allgegenwärtigen Vogelstimmen und den gedämpften Verkehrslärm der Hauptstraße, nahm nichts davon mehr bewusst wahr, auch nicht die Gespräche der Leute vom Party-Service. Sie war in ihren Gedanken und Empfindungen gefangen, verspürte das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl des Hasses. Unheimlich stark wirkte dieses Gift in ihr, legte sich schwer wie ein Stein in ihren Magen, ließ sie zwischendurch immer wieder erzittern. Die fast Zehnjährige kämpfte mit ihrem Stolz und mit ihrer Würde, wollte in einem Moment all die gemeinen Mitschüler am liebsten umbringen, im nächsten Augenblick dachte sie nur noch an Flucht, weg von hier, irgendwo hin, wo es keine gemeinen Schulkameraden gab, keine ironisch lächelnden Lehrerinnen.
Gegen halb sechs Uhr begannen die Catering-Leute zusammen zu packen, verschwanden wenig später mit ihrer Gerätschaft ohne Abschiedsgruß. Vielleicht hatten die Erwachsenen gemerkt, wie betroffen die kleine Alina war, wie unendlich enttäuscht und traurig. Womöglich war ihnen die Situation auch bloß zu peinlich gewesen.
Um sieben Uhr kam wie vereinbart ihre Maman aus Lausanne zurück. Gutgelaunt wie fast immer fuhr sie durch das Tor und auf den Parkplatz vor der Villa, kam mit ihren Einkäufen ums Haus herum, erwartete wohl ein Party-Schlachtfeld, war erstaunt über die Ordnung.
»War der Nachmittag schön, ma chère?«, fragte sie ahnungslos, wunderte sich aber mit Sicherheit über
das traurige Gesicht ihrer Tochter, »habt ihr schön gespielt und gefeiert?«
Alina kämpfte nicht mehr mit den Tränen. Schon lange nicht mehr. Nein, sie blickte ihre Mutter direkt an, verzog ihre Lippen sogar zu einer Art von Lächeln.
»Ja, Maman, es war wunderbar«, log sie, »schade, dass der Nachmittag so schnell verflogen ist.«
Alabima schien beruhigt, fuhr ihrer Tochter mit der Hand sanft über den Scheitel.
»Dann ist ja alles gut, wenn ihr euch so prächtig amüsiert habt.«
Mit diesen Worten ging sie mit ihren Tüten ins Haus. Alina erhob sich vom Stuhl, spürte das Kribbeln von Ameisen in ihren Füssen und Unterschenkeln, fühlte für einen Moment ganz weiche Knie. Doch das ging vorüber und sie begann, die Bälle und Luftmatratzen zusammen zu suchen, zu entleeren und zu falten. Sie trug alles zurück ins Pool-Haus, begann dann all die überzähligen Stühle und Liegen hinüber zu tragen und zu schieben. Die Tische und die Ständer für die Sonnenschirme waren allerdings zu schwer für sie. Die würde Maman am nächsten Morgen wegräumen.
»Hast du noch Hunger? Willst du was essen?«, fragte Alabima eine Stunde später in ihr Zimmer hinein, wohin sich Alina still zurückgezogen hatte.
»Nein, danke«, meinte die fast Zehnjährige, »ich hab drei Hamburger verdrückt und einen Berg Eiscreme.«
»Dann ist es ja gut, ma chère«, meinte Maman und ließ sie wieder allein.
*
Kenia
»So kann es nicht weitergehen.«
Fu Lingpo hatte das Abendessen beendet, saß noch vor seiner dritten Tasse Kaffee, den er stets schwarz und ohne Zucker trank, sah Sophie Shi mit einem Gesicht an, das zwischen Entschlossenheit und Zaudern hin und her zu pendeln schien. Sie lächelte, wirkte vorsichtig und melancholisch zugleich.
»Was meinst du damit? Mit uns?«
»Mit unserem Leben. Mit unserer finanziellen Lage und unserer Zukunft. Sophie, wir schlagen uns immer noch nur ganz knapp durch, haben einen Großteil unserer Ersparnisse in den letzten Jahren aufgebraucht und können kein neues Geld zurücklegen, leben von der Hand in den Mund.«
»Und wir werden zudem nicht jünger…«, ergänzte Sophie, »…willst du wohl sagen?«
Er nickte, schwer und bedrückt. Ja, Fu Lingpo fühlte sich als Versager, eigentlich seit sie mit Hilfe von Jules Lederer hierher nach Kenia gelangt waren. Denn nichts hatte in beruflicher Hinsicht bislang funktioniert. Gerade die ersten Monate mit all den Absagen an ihn waren äußerst hart gewesen. Für das eigene Ego, für seinen Stolz. Gerne wäre er den stets herablassenden Sachbearbeitern in den Personalabteilungen an die Gurgel gegangen, hätte ihnen kurzerhand das Genick gebrochen, diesen überheblichen, frechen Idioten, die in ihm bloß den alten, chinesischen Bittsteller sahen und zu dumm waren, um die Gefahr zu erkennen, die von ihm ausgehen konnte. Druck und Gewalt auszuüben, das hatte er gelernt, darauf konnte er jederzeit zurückgreifen. Doch Sophie war strikte dagegen gewesen. Okay. Ein wenig Hehlerei akzeptierte sie mittlerweile, so lange kein Unbeteiligter durch ihn verletzt oder getötet wurde.
»Ich könnte einen Millionär entführen. Ein Lösegeld erpressen.«
Sophie Shi schüttelte ablehnend den Kopf, zeigte ein unwilliges Gesicht, sagte aber nichts.
»Oder einen Supermarkt überfallen. Die Tageskasse stehlen.«
Wiederum das stumme Schütteln.
»Aber irgendetwas muss ich doch unternehmen? In wenigen Jahren sind wir beide zu alt dazu. Bis dahin müssen wir mindestens zweihundert Millionen KES auf die Seite gelegt haben. Oder willst du im Armenhaus oder gar auf der Straße landen?«
Sophie sah ihn ruhig an, ließ Fu spüren, dass sie weiterhin an ihn glaubte, dass sie die Zukunft nicht derart Schwarz sah, solange sie beide nur fest zusammenhielten und am selben Strang zogen.
»Ich hätte Heri Njoroh erpressen sollen, statt ihn und Chemal zu töten.«
»Du bist wegen Hughudu nach Garissa zurückgekehrt, nicht wegen irgendwelchem Geld«, erinnerte ihn die Chinesin an seinen Stolz und an seine Moral. Er nickte verdrossen.
»Und was schlägst du vor, Sophie?«, drehte er den Spieß um, »wie kommen wir beiden aus diesem Tal ohne jede Hoffnung heraus?«
Die Frau schwieg, wirkte nachdenklich und so kehrte auch der Mann in sich, dachte angestrengt nach, an ihre Möglichkeiten, an irgendeine Chance, mochte sie auch noch so vage sein.
»Vielleicht sollte ich wirklich hier ein Bordell eröffnen? Man würde mich bestimmt respektieren…«
Fu verstummte, hatte den schmerzlichen Gesichtsausdruck von Sophie erkannt. Sie hatte damals in Hongkong als Prostituierte gearbeitet. Und auch wenn sie nie mit einem ihrer Kunden ins Bett gestiegen war, sich nicht von all den geilen Arschlöchern hatte befummeln und bespringen lassen, so hatte sie doch nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihren Körper und ihre Würde für Geld verkauft.
»Nein«, sagte sie nun hart zu ihrem Mann, »niemals. Versprich es mir.«
Er nickte: »Ja, Sophie. Du hast mein Wort … ich liebe dich.«
Sie lächelten einander einen kurzen Moment lang glücklich zu, wurden aber rasch wieder ernst, fielen zurück in den Trübsinn ihrer Gedanken.
»Man o´war«, meinte Sophie Shi plötzlich und hatte ein Leuchten in ihren Augen.
»Man o´war?«, fragte Fu Lingpo irritiert zurück, »was meinst du damit?«
»Frigatebirds – Fregattvögel. Sind sie nicht die besten Segler der Welt und jagen anderen Raubvögeln die Beute ab?«
Der Chinese überlegte, dachte an seine vielen Kontakte mit der Halb- und der Unterwelt, an die Informationen, die er an Interessierte weiterreichte. Manchmal erhielt er als Hehler bereits im Voraus einen Tipp oder eine Anfrage, wie hoch beispielsweise sein Goldankaufspreis lag oder wie viel er für Diamanten bezahlte. Er könnte in solchen Fällen bestimmt der Sache auf den Grund gehen, vielleicht ab und zu die Diebe und Einbrecher während ihrer Taten ertappen, sie unschädlich machen und so an die Beute gelangen, ohne selbst und direkt zu stehlen.
»Sag mal«, wandte er sich an seine Frau, »dieser Fregattvogel. Wie gelangt er an die Beute der anderen Raubvögel? Die wehren sich doch bestimmt? Die haben doch auch scharfe Schnäbel und Krallen? Verletzen sich die Vögel nicht gegenseitig?«
»In der Regel nicht, soviel ich weiß. Der Man o´war ist einfach ein viel zu geschickter Flieger, stürzt sich auf die anderen Vögel aus großer Höhe hinab, erschreckt sie mit seiner plötzlichen Attacke, so dass sie ihre Beute fallen lassen und fliehen. Und er schnappt sie sich dann, bevor sie zurück ins Wasser fällt, segelt mit ihr davon.«
Fu sagte eine lange Zeit nichts dazu, grübelte und wägte ab.
»Und wenn ich jemanden dabei verletzen oder gar töten muss, um an seine Beute zu gelangen?«
Die Gesichtszüge der Chinesin verhärteten sich nun, zeigten ein erstes Mal, wie sehr sie über ihre schlingernde Apotheke und die finanzielle Situation besorgt war.
»Es sind doch bloß Verbrecher, oder?«
Fu nickte ohne Begeisterung, aber auch ohne jede Furcht.