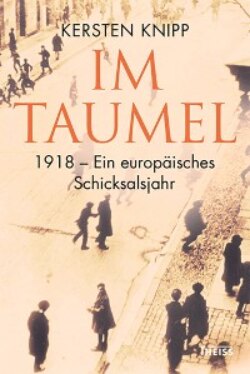Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Nicht mehr so sanft wie früher“
ОглавлениеDie Waffen schwiegen, zumindest im Westen des Kontinents. Doch in den Seelen tobte der Krieg weiter. Viele Soldaten hatten größte Schwierigkeiten, die Schrecken des Krieges psychisch zu bewältigen. Der Krieg war eine so einschneidende, so gewaltige Erfahrung, er hatte die Normen der Zivilisation auf derart erschütternde, gewalttätige Art untergraben, dass jene, die aus den Schlachten zurückkehrten, allergrößte Schwierigkeiten hatten, in die gewohnte, nunmehr wieder befriedete Welt zurückzukehren. Alles, was selbstverständlich schien, galt in diesem Krieg nicht mehr, die gewöhnlichen, bislang als normal geltenden Maßstäbe schienen außer Kraft gesetzt. Der tausendfache Tod, die eigene Ohnmacht, die Abhängigkeit von den Entscheidungen der Befehlshaber – all dies war für die Soldaten nur schwer verkraftbar, untergrub ihr Vertrauen in die Welt derart, dass sie nach Kriegsende an das frühere Leben nicht mehr anzuknüpfen vermochten. „Irgendwie“, erinnert sich ein deutscher Soldat, „waren wir, ohne dass uns dies bewusst wurde, verroht, nicht mehr so sanft wie früher. Ich kannte jemanden von ganz früher, der auch aus dem Krieg wieder zurückkam und in einer Schwarzwälder Gemeinde Lehrer geworden ist. Über ihn habe ich folgende Geschichte gehört: In der Nacht sind von Zeit zu Zeit Schaufenster eingeworfen und alle Uhren ausgeräumt worden. Nach einiger Zeit kam heraus, dass er es war. Auch er war durch den Krieg verroht.“61
Der tägliche Überlebenskampf, die dauernde Angst, das ständige Aufder-Hut-Sein – all dies, berichtet er weiter, habe einige seiner ehemaligen Kriegskameraden für immer aus der Bahn geworfen. „Ich kannte zum Beispiel einen hochintelligenten jungen Mann, der sogar schon Student der Philosophie gewesen war. Er war durch den Krieg seelisch vollständig zerbrochen. Er hatte allerhand Energie verloren. Ich will nicht sagen, dass er unter die Räder gekommen war, aber er konnte sich zu nichts mehr aufraffen. Er führte ein kümmerliches Dasein, fand dann aber noch eine Frau, die Geld verdiente und ihn mit Ach und Krach über Wasser hielt. Er selbst hatte genau genommen keinen Beruf. Man hat sich, wie ich gehört habe, mit ihm unterhalten können. Aber meist hat er halt dagesessen, zugehört und kaum ein Wort gesagt. Ein ausgesprochener Kriegsinvalide.“ Andere waren unfähig, sich von der Gewalt zu lösen. Die einzige ihnen real erscheinende Lebensform war der Kampf, zumindest aber die Auseinandersetzung auf wenig entwickelter zivilisatorischer Ebene. Einer seiner Kameraden, der Sohn eines Pastors, berichtet ein weiterer Soldat, war nach Ende des Kriegs als Mitglied des Freikorps nach Ostpreußen gegangen. „Er hat dort gegen die Bolschewisten gekämpft. Als die Kämpfe beendet wurden, ging er zur Polizei und zog dort wieder die Uniform an. Nach 1933 trat er dann in die Wehrmacht ein. Er war durch den Krieg zu einem Landsknecht geworden und wurde sein ganzes Leben lang nicht mehr Zivilist.“62
Der Krieg lastete aber nicht nur auf den ehemaligen Kombattanten, sondern auf vielen Menschen. Zahllose Menschen hatten Angehörige verloren, sei es, dass diese gestorben waren, sei es – für die meisten noch schwerer zu ertragen –, dass sie vermisst wurden. Ihre Angehörigen, wurde den Überlebenden klar, hatten in diesem Krieg als Individuen kaum gezählt, sie gehörten zu den namenlosen Vielen in einer ungeheuren Materialschlacht, hinweggerafft von den Waffen der neuen Zeit. Die Nachricht vom Tod des Mannes, Vaters, Sohnes oder Bruders verschaffte über dessen Schicksal und letzten Verbleib oft kaum befriedigende Gewissheit. Die Leichname, oft zerfetzt und entstellt, waren in rasch ausgehobenen Massengräbern verscharrt oder gleich in ihren Gräben zugeschüttet worden, die kurz zuvor die feindlichen Truppen genommen hatten. Der Schrecken solcher Vorstellungen und die mit ihnen verbundene Ungewissheit drängten die Hinterbliebenen, nach Ende des Kriegs bald zu umfassenden Trauerritualen. Vielerorts wurden sogenannte Kenotaphen errichtet – leere Gräber, die für all die Namenlosen standen, die ihr Leben irgendwo in den Schlachten gelassen hatten. Am 14. Juli 1919, dem Nationalfeiertag, wurde vor dem Arc de Triomphe in Paris ein solches Grab eingeweiht. „Zuerst, strauchelnd in ihrem Ruhm, kommen die Kriegsversehrten“, beschreibt die Tageszeitung Le Figaro die Szene jenes Tages. „Ihre Arme und Beine sind dort unten geblieben, überall: im Elsass, in der Champagne, in Lothringen, in Flandern. Sie haben keine Uniformen. Ihre Uniform besteht darin, dass sie keine vollständigen Körper mehr haben.“63
Hier deutete sie sich an, die neue Sicht auf die Kriegsteilnehmer: Sie waren keine Helden mehr, sondern vielmehr Opfer, hineingeworfen in einen Krieg, dessen Dimensionen jegliche Individualität verschlang. Siebeneinhalb Millionen Männer waren allein in Frankreich eingezogen worden – schon diese Zahl, die ja nicht einmal die größte ist, gibt eine Ahnung von den Dimensionen, denen jeder einzelne der Zwangsrekrutierten sich gegenübersah. Um ihrer, der namenlosen Vielen, dennoch gedenken zu können, wurden nun Grabmäler Unbekannter Soldaten errichtet. Der Schmerz, sich von den Gefallenen nicht persönlich verabschieden zu können, sollte durch den anonymen Ritus zumindest gelindert werden. Wenn sie ihre Angehörigen schon nicht bestatten konnten, sollten die Angehörigen wenigstens einen Ort des Gedenkens haben und ihrer Trauer angemessen Ausdruck geben können.
Überall in Europa entstanden darum solche Grabmäler. 1923 etwa wurde in Warschau vor dem Sächsischen Palais ein Gedenkstein für die unbekannten polnischen Soldaten des Ersten Weltkriegs und des auf ihn folgenden polnisch-sowjetischen Krieges gesetzt. Im Frühjahr 1925 wählten Vertreter des polnischen Kriegsministeriums aus über 40 Schlachten die Schlacht von Lemberg aus. Von dort wurde die Asche eines unbekannten Soldaten nach Warschau gebracht. Im Herbst des gleichen Jahres folgten drei dort exhumierte Särge mit den Überresten dreier unbekannter Toten. Dem Akt wohnten auch zwei Frauen bei, Bronisława Wildt und Jadwiga Zarugiewicz. Beide hatten ihre Söhne im Ersten Weltkrieg verloren, ohne dass sich für sie ein Grab gefunden hätte. Beide Mütter standen stellvertretend für die vielen anderen Frauen, die Tote im nächsten Umfeld zu beklagen hatten. Von den drei exhumierten Leichnamen wählte Jadwiga Zarugiewicz einen aus, der dann nach Warschau gebracht und in dem soeben eingerichteten Grab bestattet wurde. Beigesetzt wurde dieser Sarg zusammen mit 14 Urnen, die Erde von ebenso vielen Schlachtfeldern enthielten. In den USA wurde zum Gedenken der anonymen Gefallenen 1932 auf dem Nationalfriedhof von Arlington das „Grabmal der Unbekannten“ errichtet. In ihm ruht nicht nur ein unbekannter Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, sondern auch solche, die in späteren Kriegen ums Leben kamen. In das bulgarische Grab des unbekannten Soldaten, in der Nähe der Alexander-Newski-Kathedrale gelegen, sind die ersten drei Zeilen des Gedichtes Das neue Grab bei Slwinitza des Dichters Iwan Wasow eingemeißelt: „Oh Bulgarien, für dich starben sie, du einzig warst würdig für sie und sie waren, oh Mutter, es für dich.“
Der pathetische Ton des Gedichtes deutet es an: Das Gedenken an die Toten war von patriotischen, teils auch nationalistischen Empfindungen nicht frei. Das zeigte sich auch auf zahlreichen Soldatenfriedhöfen, wo die Gefallenen des ehemaligen Gegners jeweils weniger Raum erhielten als die eigenen oder die der Verbündeten. Auch in den Schulen wurde der Toten gedacht – vorzugsweise auch hier der eigenen. „Pazifistische Konnotationen suchte man in dieser Gedenkkultur vergeblich.“64
Der Schmerz in den Seelen, der unerlöste, oft weiterwuchernde Hass auf den ehemaligen Kriegsgegner, das Sicherheitsbedürfnis gegenüber dem als Hauptverantwortlichen gebrandmarkten Deutschland, dazu die Rivalitäten um Territorien und, vielleicht mehr noch, das Ringen um die nationale Identität und die Frage nach dem Umgang mit Minderheiten: All dies beschäftigte den Kontinent auch nach dem 11. November. Vielleicht mehr noch: Das millionenfache Sterben auf den Schlachtfeldern war zumindest im Westen vorüber. Die nationalen Rivalitäten hingegen waren längst nicht beigelegt.
Freude in Frankreich, verbunden mit größtem Misstrauen auf den nördlichen Nachbarn, Deutschland. Dort wiederum erste Anzeichen eines Ringens um die Zukunft der Republik, zusammengefasst im bösen Wort von den „Novemberverbrechern“; mörderischer Klassenkampf in Russland; und Grenzauseinandersetzung rund um Polen: Das sind, verbunden mit der von Präsident Wilson angestoßenen Minderheitenproblematik, einige der Zutaten, aus denen die Konflikte nach Ende des Krieges bestanden. Die waren teils von einer Gewalt, die derjenigen der Jahre von 1914–1918 kaum nachstand. Für viele Menschen war der Erste Weltkrieg darum nur nominell, nicht aber de facto vorüber. Und die weitsichtigsten Beobachter ahnten, dass das Schlimmste womöglich noch bevorstand. Der Krieg, deutete etwa Joseph Wittlin an, ist mitnichten vorbei – er macht nur eine Pause. Im Jahr 1936 berichtete er nach einer Reise durch Österreich und die Schweiz in einer Skizze mit dem hellsichtigen Titel Vor dem Ende der Welt von düsteren Visionen. „Ich habe“, notierte er dort, „in meiner Vorstellung bereits die Vernichtung der großen Hauptstädte Europas gesehen, ich habe die schönsten Plätze der Erde zerstört, zerbombt und vergast gesehen. Denn alles, was in den letzten Jahren in der Welt unternommen wurde, diente mehr oder weniger dem geplanten Ausbau der Vernichtung.“65