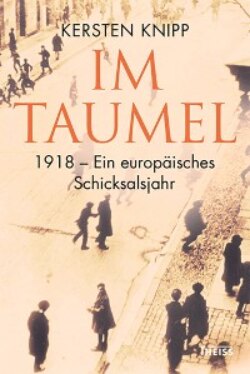Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„… aber Ordnung soll sein“
ОглавлениеSo waren Millionen Menschen erleichtert, als sich im Spätsommer und im Herbst 1918 das Ende der Kämpfe andeutete. Auflösungserscheinungen in den Reihen der Mittelmächte hatten sich bereits lange vorher gezeigt. Es sei „nichts Ungewöhnliches mehr“, notierte der Heerführer Prinz Rupprecht von Bayern im Mai 1918, dass „bis zu 20 v. H. der Mannschaften sich unerlaubterweise entfernen, wofür sie, wenn wieder aufgegriffen, meist mit zwei bis vier Monaten Gefängnis bestraft werden. Dies ist aber gerade, was manche wollen, da sie so der einen oder anderen Schlacht entgehen.“12 In den folgenden Monaten wurde die Front aufseiten der Mittelmächte immer brüchiger: Zahllose Soldaten verweigerten den Kampf, andere machten sich auf eigene Faust auf den Weg nach Hause. „Du liegst im Bett und bist eine Krankheit. Du bist ein Schädelbruch, ein Bauchschuss, eine Beckenfraktur“, beschrieb Alfred Döblin in seinem Roman November 1918. Eine deutsche Revolution das Lebensgefühl der Rekruten.13
Bereits am 14. September unterbreitete Österreich-Ungarn den Alliierten ein Friedensangebot und drängte Deutschland, das Gleiche zu tun. Tatsächlich forderte Erich Ludendorff als Vertreter der Obersten Heeresleitung die Reichsregierung am 29. September auf, Verhandlungen mit den Alliierten über einen Waffenstillstand aufzunehmen. Die Oberste Heeresleitung, erklärte Generalmajor Erich Freiherr von dem Bussche am 2. Oktober im Deutschen Reichstag, sei der Ansicht, „dass nach menschlichem Ermessen keine Aussicht mehr besteht, dem Feinde den Frieden aufzuzwingen.“14 Den massiv eingesetzten Panzern hätten die eigenen Truppen nichts mehr entgegensetzen können. Vor allem aber ließen sich die eigenen Truppen nicht mehr aufstocken. „Der laufende Ersatz, Wiedergenesende, Ausgekämmte, wird nicht einmal die Verluste eines ruhigen Winterfeldzuges decken. Nur die Einstellung des Jahrgangs 1900 wird die Bataillonsstärken einmalig um 100 Köpfe erhöhen. Dann ist unsere letzte Menschenreserve verbraucht.“15 Auf ein so deutliches Geständnis, den Krieg verloren zu haben, waren die wenigsten Parlamentarier vorbereitet. „Die Abgeordneten waren ganz gebrochen“, berichtet ein Zeitzeuge. „Ebert (MSPD, WK) wurde totenblass und konnte kein Wort herausbringen, Stresemann (Nationalliberale, WK) sah aus, als ob ihm etwas zustoßen würde, einzig und allein Graf Westarp (Konservative, WK) begehrte auf gegen die vorbehaltlose Annahme der Vierzehn Punkte. Der Minister von Waldow (Leiter des Kriegsernährungsamtes) soll den Saal mit den Worten verlassen haben: Jetzt bleibt ja nur übrig, sich eine Kugel durch den Kopf zu schießen.“16
Den Revolver ließ Wilhelm von Waldow in der Tasche. Stattdessen erhoben sich die Matrosen der Kieler Kriegswerft: So kurz vor Ende des Krieges wollten sie nicht noch in eine Schlacht geschickt werden, nicht „alles kurz und klein schießen“, wie die Heeresführung verlangte. Doch solche Parolen hatten ihre Zeit hinter sich. Jetzt ging es nur noch darum, die Tage bis zum Friedensvertrag heil zu überleben. „Der Friede muss bald kommen“, schrieb ein Matrose nach Hause. „Sonst machen wir ihn uns selber. Die Marine macht nicht mehr mit – wenn nur die Armee und das Volk bald folgt.“17 Sowohl die Armee als auch das Volk folgten. Der Protest weitete sich aus. Immer mehr Menschen gingen auf die Straße, vereint im Wunsch nach einem Waffenstillstand. Müde nach vier Jahren Krieg wollten die Menschen vor allem eines: ein Ende der Kämpfe. Ein politisch zurückhaltender Wunsch, der das Reich dennoch am Ende zusammenbrechen ließ. „Nicht würde eine Kette gesprengt durch das Schwellen eines Geistes und Willen“, notierte ein Beobachter, „sondern ein Schloss ist durchgerostet.“18
Am 9. November gab das verrottende Eisen endgültig nach: An jenem Tag floh Wilhelm II. ins niederländische Exil. Nur wenige Monate war es her, da hatte der Kaiser sich in der ihm eigenen ignoranten Überheblichkeit noch ausgemalt, wie er nach einem deutschen Sieg den Briten gegenüber auftreten würde. Am 26. März – wenige Tage zuvor hatte das deutsche Heer in der „Operation Michael“ an der Westfront das gegnerische Stellungssystem durchbrochen und war über 60 Kilometer weiter vorgerückt – war Wilhelm II. in Hochstimmung. „Die Schlacht ist gewonnen, die Engländer total geschlagen“. Wenn nun „ein englischer Parlamentär komme, um den Frieden zu erbitten, so müsse er erst vor der Kaiserstandarte knien, denn es handele sich um einen Sieg der Monarchie über die Demokratie“.19 Doch schon bald kam der Vorstoß ins Stocken, wenig später brach er zusammen. Immer deutlicher zeichnete sich weitsichtigen Beobachtern fortan die Niederlage ab. Und immer mehr folgte die Bevölkerung der Einschätzung des US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, dass der Kaiser ein Hindernis auf dem Weg zu Waffenstillstandsverhandlungen war. Der Druck wuchs, doch Wilhelm, so schien es, ließ sich nicht beeindrucken. Noch am 3. November drohte er den Revolutionären, „die Antwort mit Maschinengewehren auf das Pflaster zu schreiben, und wenn ich mir mein Schloss zerschieße, aber Ordnung soll sein.“20 „Ich denke nicht daran“, erklärte er weiter, „wegen der paar 100 Juden und der 1000 Arbeiter den Thron zu verlassen.“ Allerdings hatte der Kaiser die Pläne ohne seine Gegner gemacht. Ebenfalls am 3. November brach der Kieler Matrosenaufstand los, dem sich weitere Erhebungen in anderen deutschen Städten anschlossen. Die Aufstände gewannen an Fahrt.
Vor allem aber, musste der Kaiser im Hauptquartier in Spa erfahren, standen auch die Soldaten nicht mehr hinter ihm. Die Stimmung unter den Soldaten umriss Oberst Wilhelm Heye in ebenso deutlichen wie ernüchternden Worten: „Allgemein kam zum Ausdruck, dass die Truppe nichts gegen den Kaiser habe, dass er ihr eigentlich ganz gleichgültig sei, dass sie nur noch einen Wunsch habe, sobald wie möglich nach Hause zu kommen, zu Ruhe und Ordnung.“21 Dennoch zögerte Wilhelm, seine Abdankung zu erklären. Derweil wuchs der Druck auf der Straße – sodass Prinz Max von Baden, der letzte Kanzler des Kaiserreichs, ein unklar formuliertes Telegramm des in Spa nicht zu erreichenden Kaisers zum Anlass nahm, dessen Abdankung selbst zu verkünden. „Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen“, ließ er über das Wolffsche Telegraphenbureau verkünden.
Für Deutschland begann eine neue Ära, die schon in den ersten Stunden ihren ersten ideologischen Machtkampf erlebte. Der Linkssozialist Karl Liebknecht, hieß es, wolle eine Sozialistische Republik ausrufen – ein Unterfangen, das in den aufgewühlten Tagen kaum kalkulierbare Folgen haben könnte. Um das zu verhindern, entschloss sich Philipp Scheidemann, ihm zuvorzukommen und seinerseits die Republik auszurufen. Scheidemann, Mitglied der Mehrheitssozialdemokratischen Partei (MSDP), gehörte zu den Führern der Januarrevolution im selben Jahr. Sein Ziel: die Anliegen der Bewegung im gemäßigten Rahmen zu halten. Eben das hatte er nun auch mit der Ausrufung der Republik im Sinn. „Jetzt heißt es, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, sonst gibt es doch anarchistische Zustände im Reich“, hatte er drei Tage zuvor erklärt.22
So trat er am 9. November, einem Samstag, gegen 14 Uhr auf einen Balkon des Berliner Reichstags. Tausende Zuhörer schoben sich bereits über den Platz vor dem Gebäude. Die teils aus einer höheren Position aufgenommenen Fotos zeigen vor allem Männer, weitestgehend dem bürgerlichen Publikum zugehörig. Zahllose Hüte präsentieren sich dem Fotografen: in Weiß, Beige oder Grau, ihre Träger allesamt dem Redner auf dem Balkon zugewandt. Von ihm erwarten sie Erhebliches: einen baldigen Waffenstillstand und einen geordneten Übergang von der Monarchie zur Republik. Entschlossen steht Scheidemann auf dem Balkon, mit energischer Armbewegung die eigenen Worte begleitend. Der Kaiser habe abgedankt, ruft er der Menge zu. „Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das deutsche Volk auf der ganzen Linie gesiegt“, wendet er sich an die Versammelten. „Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt. Die Hohenzollern haben abgedankt!“23 Das Kanzleramt habe Friedrich Ebert übernommen. „Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den Frieden und der Sorge um Arbeit und Brot.“
Scheidemanns Rede war ein rhetorisches Meisterstück. Sie war im Duktus wie auch in der Körpersprache teils radikal, wie es der aufgebrachten Stimmung eines solchen Tages entsprach. Vier Jahre lang hatten die Deutschen gekämpft, entsprechend ungestüm erwarteten sie den Wandel. „Die Monarchie ist zusammengebrochen“, rief Scheidemann in die Menge. „Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.“ Auch dieser Satz war radikal genug, um den Bruch mit dem Vergangenen zu dokumentieren. Durch den revolutionären Touch minderte er die Aufforderung zur Disziplin ab, zu der er seine Zuhörer vorher aufgerufen hatte. Um zu zeigen, wem die neue Republik zu Diensten sei, griff er zum Schluss noch einmal zu einer sozialrevolutionären Floskel: „Alles für das Volk, alles durch das Volk!“ Aber dieses Volk, habe nun auch zu zeigen, dass es den Herausforderungen besonnen gegenübertrete: „Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst!“ Für viele hatte Scheidemann den richtigen Ton getroffen. „Das Ungeheure ist zur Tatsache geworden“, befand Gerhart Hauptmann an jenem 9. November. „Die Bahn Wilhelms II., dieses eitlen, überheblichen und fleißigen Monarchen ist beendet.“24