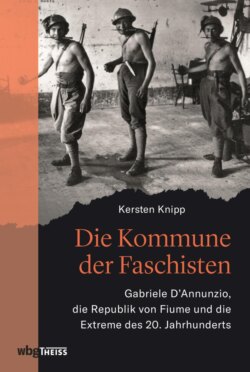Читать книгу Die Kommune der Faschisten - Kersten Knipp - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Oper des Lebens Arbeit am Selbst
ОглавлениеWir wollen die Wahrheit nicht mehr. Gebt uns den Traum!
Gabriele D’Annunzio, 1893
Dies ist eine aberwitzige, eine absurde Geschichte. Wenn sie nicht wahr wäre, würden man sie den Kinoträumen eines Werner Herzog entsprungen glauben. Es ist die Geschichte der Marionettenrepublik von Fiume, die einen Winter, einen Sommer und einen Winter lang – von September 1919 bis Dezember 1920 – ein bizarres, ein aus der Zeit gefallenes Fest in Fiume, dem eltehrwürdigen Rijeka, feierte.
Die Geschichte beginnt aber in einem adoleszenten, in einem zerrissenen Land, in Italien, das zwischen atavistischer Rückständigkeit und Aufbruch seinen Weg im Anschluss an das 20. Jahrhundert suchte. Und sie findet Ihre Fortsetzung im Faschismus und Totalitarismus wie in der counterculture und Populismus des europäischen 20. Jahrhunderts. Der Regisseur und Fädenzieher heißt: Gabriele Rapagnetta-D’Annunzio.
Alles ist möglich dem, der spricht. Wer spricht, verändert die Welt. Er greift ein in ihren Lauf, ordnet sie nach seinen Vorstellungen, lässt sie in neuem Licht erscheinen. Wie die Welt sich präsentiert, hängt ganz wesentlich davon ab, wie einer über sie redet, sie darstellt und beschreibt. Deswegen haben die Dichter und Demagogen so viel Macht über die Welt. Denn beide beherrschen die Kunst der Sprache, und gebrauchen sie die nur geschickt genug, fügt sie sich neu. Das macht die Magie von Dichtung und Demagogie gleichermaßen aus.
Gabriele D’Annunzio, ein Leben lang Dichter und für einige Jahre auch Demagoge, hatte diesen Anspruch: mit seiner Sprache die Welt und sich selbst zu verändern, natürlich, war er überzeugt, zum Besseren. Zeit seines Lebens arbeitete er an den notwendigen Instrumenten, schliff seine Sprache, feilte am Ausdruck, fand Sätze, Rhythmen, Bilder, die seine Zeitgenossen in höchste Erregung versetzten. D’Annunzio war ein Zaubermeister der Sprache, mit ihrer Hilfe ließ er gute und böse Geister aus der Flasche. Sie formte er mit dem geschriebenen ebenso wie mit dem gesprochenen Wort. Mit seinen Texten und seinen Reden, sehr früh auch bereits durch seine öffentlichen Auftritte, sein sorgsam ins Werk gesetztes Bild seiner selbst, faszinierte er zunächst seine Landsleute und später, nach den ersten Übersetzungen seiner Werke, mehr und mehr auch die Leser anderer europäischer Länder. Sie alle lasen oder lauschten einem Dichter, der die Gefühlsbewegungen seiner Zeit in kunstvoll verfasste Verse, Romane und Reden packte. Einem Dichter und Selbstdarsteller zudem, der bewusst gegen die Konventionen seiner Zeit verstieß, der vor allem deren Prüderie nicht achtete und – auch – dadurch zu einem der meistgelesenen Autoren der Epoche wurde.
Seinen Erfolg verdankte D’Annunzio ganz wesentlich seiner Fähigkeit, umgehend auf die großen Themen seiner Zeit einzugehen. Immer wieder lieferte er die entscheidenden Stichworte, fasste die Anliegen und Empfindungen seiner Zeitgenossen in anschaulichen Formen zusammen. Mit seinem feinen Gespür für kollektive Regungen, das zunächst latent Geahnte, aber noch nicht öffentlich Artikulierte, wurde er zum Geburtshelfer des noch Ungesagten, der vagen Eindrücke, die nach Ausdruck verlangten.
Welche Hoffnungen und Erwartungen die Italiener auch hegten, D’Annunzio warf ihnen die passenden Worte zu. Gedichte, Romane, politische Parolen: In allem lieferte er den passenden Ausdruck, durchgehend zum rechten Zeitpunkt und maßgeschneidert für das anvisierte Publikum. Das, was andere eher unbewusst empfanden, brachte er präzise und zugleich poetisch auf den Begriff. Indem er dies mit beiläufiger Eleganz ausformulierte, wurde er zu einem der größten, wenn nicht dem größten literarischen Zeremonienmeister der nationalen Regungen. Seine Sensibilität, die er zeitlebens kultivierte und zugleich zur Schau stellte, verwandelte ihn in ein regelrechtes Medium seiner Epoche, zumindest deren italienischer Spielart.
Die Bühne, die ganz große, die nationale Bühne hat D’Annunzio nie gescheut. Von Anfang an hatte es der 1863 zur Welt gekommene Dichter darauf angelegt, sich über die Mauern des Heimatstädtchens Pescara zu erheben, Adria und Abruzzen möglichst rasch hinter sich zu lassen. Nicht dass er sich mit seiner Heimat nicht identifiziert hätte. „Ich trage die Erde der Abruzzen, ich trage den Schlamm der Flussmündung an den Sohlen, am Absatz meiner Stiefel“, bekennt er im Libro Segreto – ohne das Erbe der Heimat auf die Erinnerung zu beschränken.1 „Von meinen Großeltern aus den Abruzzen habe ich die blaugrauen, vielleicht braunen Augen, die eigenwillige Stirn, die typische Intonation der Stimme, die Präzision im Wurf eines Steines, den Sinn für das Mysterium des Alltags.“2
Heimat mag Identität stiften. Sie kann aber auch beklemmend eng werden. D’Annunzio suchte früh den Abschied, den Aufbruch in andere, verlockender anmutende Welten. „Ich weiß nicht warum“, schrieb er 1913 über die – durchaus intakte – Bindung an seine Familie, „aber ich wusste immer schon, dass mein Schicksal stärker war und ich von meinen Nächsten blinde Anerkennung und vollständige Hingabe fordern musste.“3 Bescheidenheit, auch vor sich selbst, zählte nicht zu seinen Stärken. Schon als Teenager war der junge Mann von sich überzeugt, und zwar in höchstem Maß. Eines seiner frühen Vorbilder war Giosuè Carducci, einer der großen und gefeierten Dichter seiner Zeit, Verfasser patriotischer Zeilen, zudem auch solcher, die den Aufstiegswillen des Einzelnen feierten. Der junge D’Annunzio war hingerissen von Carduccis Strophen, er las sie „mit fiebriger Erregung“,4 wie er später schrieb – und zögerte keine Sekunde, sich selbst die gleiche künstlerische Bedeutsamkeit zu attestieren. Im März 1879 – er war gerade 16 Jahre alt – schrieb er dem Verehrten einen Brief. „Ich will an Ihrer Seite kämpfen, mein Dichter“, ließ er diesen wissen. „Auch ich verspüre in meinem Geist einen Funken jenes kämpferischen Genies, der meine Nerven zittern lässt und mir ein quälendes Verlangen nach Ruhm und Kampf in die Seele setzt.“5 Der Angeschriebene verzichtete auf eine Antwort – um den Absender drei Jahre später in Rom, in den Redaktionsräumen der Kunst und Literatur gewidmeten Zeitschrift Cronaca bizantina, dann doch kennenzulernen. Sei es aus nicht vergessenem Groll über den ausgebliebenen Brief, sei es aus beiderseitiger spontaner Antipathie: Die Begegnung verlief verhalten. D’Annunzio erinnerte sich an – oder vielmehr lästerte über – „die schmächtigen Beine und den hervorstehenden Bauch“ des knapp drei Jahrzehnte älteren Dichters. Dessen Körperbau sei nicht römisch, sondern erinnere eher an die der Etrusker, wie man sie auf den „Deckeln von Urnen“ sehe.6
Die Bewunderung der frühen Jahre war nun mit einem teils giftigen Ehrgeiz gepaart, den D’Annunzio Zeit seines Lebens nicht mehr ablegen sollte, der ihn zugleich aber immer weiter nach oben, an die Spitze des italienischen Kulturbetriebs und Jahre später auch an die der außerparlamentarischen Opposition seiner Zeit tragen sollte. Dieser Aufstieg war gewollt und geplant, er entsprach dem überbordenden Selbstbewusstsein und dem Willen des Dichters, aus sich etwas zu machen. „Man muss sein Leben gestalten, wie man auch eine Oper gestaltet“, lässt er Andrea Spinelli, den Helden seines 1889 erschienenen Romans Il piacere, sagen. „Für einen Mann von Intellekt muss sein Leben sein eigenes Werk sein. Darin liegt die echte Überlegenheit.“7
Der Anspruch, sich selbst zu formen, das Leben in die eigenen Hände zu legen und es den eigenen Ansprüchen entsprechend voranzutreiben, zieht sich durch das gesamte Leben des jungen Mannes. „Arbeitet, arbeitet, arbeitet, ihr Jungen!“, schreibt der gerade 20 Jahre alte Dichter an einen Freund. „Es sind noch so viele Gipfel zu erklimmen! Du, dem eine so überlegene Künstlernatur eignet, du wirst viel tun, du wirst weit nach vorne gehen. Wirf deine Ängste über Bord, alle Furcht, alles Zögern: sei kühn, immerfort kühn. Höre nie auf zu forschen, zu versuchen, auszuprobieren. … Du hast eine feine Intelligenz und eine außergewöhnliche Bildung. … Du hast das Recht, deinen Weg in Richtung der Sonne zu gehen, erobere sie!“8 Formal richtet sich der Brief an jemand anderen, aber nicht zuletzt dürfte der Absender auch an sich selbst appelliert haben.
Und es ist ihm bitter ernst damit. „Entweder man erneuert sich oder man stirbt“, wird er in seinem Roman L’innocente aus dem Jahr 1892 schreiben,9 ein Satz, zu dem er sich von Friedrich Nietzsche hatte inspirieren lassen, den er auf dem Umweg über französische Übersetzungen entdeckt hatte. Die Überzeugung, etwas aus sich machen zu müssen, ist ihm nicht nur Pflicht, sondern auch Quelle seines Stolzes. „Seit meinen ersten Jahren wollte ich derjenige werden, der ich bin“, notierte er einmal. Das klang gut, war aber auch ein Anspruch aus zweiter Hand, abgeschaut Heinrich IV., seit 1589 König von Frankreich. „Gratia Dei sum id quod sum“, hatte der notiert: „Dank Gottes bin ich, der ich bin.“10 Gekürzt um seinen religiösen Gehalt, kürte sich der junge D’Annunzio den Satz zum Lebensmotto aus – und stellte somit eines gleich klar: Alles, was er ist, verdankt er sich selbst.
Freilich kommt der Begabung auch eine glückliche Fügung zur Hilfe. Ihr verdankte der junge Dichter seinen klangvollen Nachnamen. Den trug seine Familie noch nicht allzu lange. Sein Großvater war zunächst noch unter einem ganz anderen Namen registriert: Rapagnetta. Den hätte folglich auch sein Enkel geerbt. Gabriele Rapagnetta hätte er dann geheißen – ein nicht nur klanglich, sondern auch semantisch deutlich wenig gefälliger Name: Rapagnetta bedeutet „kleine Rübe“. Dass es anders kam, verdankt der Dichter dem Unglück einer Großtante. Die konnte keine Kinder empfangen und adoptierte darum einen Sohn ihrer kinderreichen Schwester – eben Gabrieles späteren Großvater, der dann auch den Namen der Adoptiveltern annahm. Aus Rapagnetta wurde D’Annunzio – auf Deutsch: „der Bote“. Ein in den Abruzzen zwar geläufiger Name, der mit seinen christlichen Untertönen in Italien aber mehr als respektabel ist. Im Deutschen schwingen sie in der Formel von der „Frohen Botschaft“ mit.
Damit dieser Bote aber auch vom Klang seiner Stimme her überzeugende Auftritte hinlegt, muss er, seinem späteren Bekenntnis zur Intonation seiner Heimat zum Trotz, sich deren phonetischen Erbes zunächst einmal entledigen. Denn allzu kräftig tönt in der Sprache des jungen Mannes der schwere Dialekt seiner Heimat mit. Vater Francesco Paolo ahnt es: Die als bäuerisch empfundene Sprache der Heimat könnte seinem begabten Sohn das Leben später schwermachen. So schickt er den Sohn auf ein Internat in Florenz, wo dieser den als elegant geltenden Zungenschlag der Toskana annehmen soll. Gabriele hört sich in die neue klangliche Umgebung ein, ahmt sie nach und schafft es schließlich, den Klang von Pescara hinter sich zu lassen. Auch in Sachen Aussprache ist er nun ein Mann von Welt. Die Heimat mag ihm seine Wurzeln beschert haben, wie er später schreiben wird. Aber die Zukunft verdankt er dem jungen italienischen Nationalstaat. Auf die dort geforderten Ansprüche bereitet er sich, unterstützt von seinem Vater, konsequent vor.
Italien selbst hatte sich in jenen Jahren gerade frisch formiert. Nur zwei Jahre bevor der Dichter zur Welt kam, hatte Italien sein Risorgimento durchlaufen, wodurch das in viele Fürstentümer zersplitterte Land endlich, nach mehreren gescheiterten Versuchen, zur politischen Einheit fand. Kaum war die erreicht, stand die nächste Aufgabe an. Es galt die über die gesamte Halbinsel verstreuten Menschen zu vereinen, sie zu animieren, sich als Angehörige nicht mehr einer Region oder eines Fürstentums, sondern der nun ins Leben gerufenen Nation zu verstehen. „Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani“, umriss der Schriftsteller und Politiker Massimo d’Azeglio, Jahrgang 1798, das Anliegen: „Nachdem Italien geschaffen ist, geht es nun darum, die Italiener zu schaffen“ – Menschen also, die ihren bislang gewohnten politischen und kulturellen Horizont hinter sich ließen, um zu den neuen Ufern des Gesamtstaats aufzubrechen.11 Selbstverständlich war das Unternehmen nicht, im Gegenteil: Es erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. Es durchlief viele Erfolge – und ebenso viele Misserfolge. Wer sind die Italiener, was hält sie zusammen, was macht sie aus? Die nationale Debatte kam in Gang, das Rätsel der italianità – die Frage also, was die Italiener zu Italienern macht – beschäftigte die sich formierende Nation in immer neuen Anläufen.
Dass die Einheit kulturell, politisch und wirtschaftlich so lange auf sich warten ließ, trug entscheidend dazu bei, dass D’Annunzio nicht nur literarisch, sondern eine Zeitlang auch politisch eine bedeutende Rolle spielen konnte. Daran hinderte ihn auch der Umstand nicht, dass er, anders als sein zeitweiliger Weggefährte Benedetto Mussolini, der spätere duce, kein politischer Kopf war. D’Annunzio war ein ästhetisch motivierter Mensch. Und wenn er zeitweilig in der Politik eine Rolle spielte, dann vor allem darum, weil er gründlicher und schneller als andere deren sinnliche Dimension erkannte und sich nicht scheute, Politik und Poesie zu einem gewaltigen Gesamtkunstwerk zu verbinden. Dieses brachte er zunächst in Form mehrerer Reden zugunsten des italienischen Eintritts in den ersten Weltkrieg und nach dessen Ende dann im großen Abenteuer von Fiume auf die Bühne.
Vorerst aber ließ der Dichter seinen künstlerischen Sinn da wirken, wo er hingehört: in der Literatur. D’Annunzio war Ästhet und Sprachvirtuose, ein Liebhaber der beaux gestes, der schönen Gesten, die er früh einübte, kultivierte und zur öffentlichen Aufführung brachte. Leben, darunter verstand bereits der junge D’Annunzio in erster Linie Hingabe an Eleganz und Raffinesse, das Spiel mit den anmutigen Formen, die Entwicklung des ästhetischen Sinns und die stete Verfeinerung der künstlerischen Wahrnehmung, in ihrem Duktus ganz dem Geist der Zeit, der verfeinerten Stimmung des fin de siècle entsprechend.
Zwei Dinge, schrieb der Dichter Hugo von Hofmannsthal in seinem 1893 in der Frankfurter Zeitung veröffentlichten Essay über D’Annunzio, hätten die Dichter des späten 19. Jahrhunderts von ihren Vorgängern geerbt: „hübsche Möbel und überfeine Nerven“.12 Die Möbel, war der Österreicher überzeugt, könne man als Relikt der Vergangenheit getrost beiseiteschieben. Die überfeinen Nerven hingegen sah er als Signatur der Zeit. Die Regungen des Herzens noch in ihren kleinen und kleinsten Impulsen zu registrieren, den zittrigen Bewegungen der eigenen Seele zuzuschauen, die Rätsel des eigenen Ich zu entschlüsseln: Das waren die Aufgaben, die von Hofmannsthal den Dichtern seiner Zeit als vornehmste Aufgabe stellte. Freilich wusste er um die Risiken dieser ins Extreme gesteigerten Sensibilität: Zu haben ist die manisch kultivierte Gewohnheit, sich selbst immer und überall über die Schulter zu schauen, nur um den Preis lähmender Untüchtigkeit im praktischen Leben. Die Dichter des fin de siècle, schrieb von Hofmannsthal darum sehr richtig, betrieben letztlich zweierlei: „die Analyse des Lebens und die Flucht aus dem Leben“.
Zumindest den ersten Teil dieses Satzes konnte sich D’Annunzio zu eigen machen. Die Analyse des Lebens war ihm nicht zuletzt aufgrund seiner ausgiebigen Lektüren zutiefst vertraut. Wenige Jahre bevor er zur Welt kam, war ein frühes, in seinem Einfluss kaum zu unterschätzendes Meisterwerk der literarischen Dekadenz erschienen: Les Fleurs du Mal von Charles Baudelaire, veröffentlicht 1857. Die Blumen des Bösen sind der literarische Versuch, Schönheit in einer Welt zu gewinnen, die Schönheit – so jedenfalls sah es Baudelaire – nicht mehr gewährt. „Du hast mir deinen Schmutz gegeben, und ich habe ihn in Gold verwandelt“, heißt es im Entwurf eines Epilogs für die zweite Ausgabe.13 Eine humoristische Variante dieses Gedankens formulierte D’Annunzio Jahrzehnte später, in seiner posthum erschienenen Autobiographie Il fastello della mirra („Das Bündel Myrrhe“). Er erinnere sich, schreibt der Dichter, dass er in einer Gegend geboren sei, in der es Wassersucher ohne Zahl gab. „Ich selbst verdanke meinem Flussgott die Kunst, eine reine Ader selbst noch in der ekelhaftesten Kloake zu finden.“14
Den Humor beiseite, sind D’Annunzios reine Wasserader oder Baudelaires Gold hochgradig artifizielle Produkte, zu finden allein in den Versen der Dichter, die sie einer widerspenstigen Wirklichkeit abgerungen haben. Die Verse bilden einen Raum eigenen Rechts, und nur in ihm, im literarischen Separé, vermögen die Dichter zu leben. Überall sonst sind sie linkisch und unbeholfen. „Der Dichter gleicht dem Fürsten der Wolken, der mit dem Sturm Gemeinschaft hat und des Bogenschützen spottet“, heißt es in einem der berühmtesten Gedichte der Fleurs du Mal, dem „Albatros“. Das Hohelied auf die Kraft des Dichters, seine weltschöpfende Energie, nimmt allerdings eine scharfe Wendung, sobald es den Dichter in der täglichen Wirklichkeit porträtiert. „Auf den Boden verbannt, von Hohngeschrei umgeben, hindern die Riesenflügel seinen Gang.“15
Mit seinem Gedicht hat Baudelaire dem Bild des scheuen, weniger höflich: leicht verschrobenen Dichters ein Denkmal gesetzt. Doch die Hilflosigkeit im Äußeren, so wollen es die poetischen Topoi jener Zeit, erlaubt erst jene Sensibilität, aus der die Dichter ihre betörenden Zeilen schöpfen. „Car nous voulons la Nuance encore,/Pas la Couleur, rien que la nuance!“, schrieb ein anderer großer Künstler des literarischen Feinsinns, Paul Verlaine, 1874, in seinem Gedicht „Art Poétique“16: „Denn wir wollen die Nuance noch einmal/nicht die Farbe, nichts als die Nuance!“
Den Nuancen, den feinen Schattierungen der Welt war auch D’Annunzio auf der Spur. Die Ästhetik der poètes maudits, der „verfluchten“, weil überspannten Dichterseelen war ihm nicht nur vertraut, ihr fühlte er sich Zeit seines Lebens verpflichtet. Die Launen des Verliebtseins, die Spielformen der Melancholie, die Empfindungen gegenüber großer Kunst: All dies lies er in seine Texte einfließen, machte er zum Gegenstand immer neuer poetischer Meditationen, abgerungen harter Arbeit am Text. „Ed ancora de l’arte amo i tormenti“ – „Und immer noch liebe ich der Künste Qual“.17
Ein erstes Denkmal setzte er dem Lebensgefühl der literarischen décadence in seinem Roman Il piacere. Dessen Hauptfigur Andrea Sperelli, Sproß einer wohlhabenden Familie, ist ein den Herausforderungen des Alltags kaum mehr gewachsener Schöngeist, feinfühlig und sensibel bis zum Äußersten, aber unfähig, es mit den Herausforderungen des Alltags aufzunehmen. Er registriert die Regungen der Welt in feinstem Maß, ist aber nicht in der Lage, die Welt jenseits des allerprivatesten Raums selbst zu beeinflussen. „Mir ist, als ob ich dazu verurteilt sei, die Bruchstücke eines Traums zusammenzusetzen, aneinanderzufügen, zu verbinden, eines Traums, von dem ein Teil sich außerhalb meiner selbst verwirklichen will und der andere sich wirr in der Tiefe meines Herzen regt. Ich mühe mich und mühe mich, ohne ihn jemals ganz zusammenfügen zu können.“18
Sperelli ist der Prototyp eines Feingeistes des fin de siècle, faszinierend in seinem Feinsinn, seiner Hingabe an das Schöne. „Mehr als den Gedanken liebte er den Ausdruck. Seine literarischen Proben waren Übungen, Spiele, Studien, Versuche, technische Experimente, Kuriositäten. Er dachte, … es sei schwerer, sechs schöne Verse zu schreiben als eine Schlacht zu gewinnen.“19 Il piacere ist ein Buch über die Zerbrechlichkeit bürgerlicher Tatkraft. Kaum hat sie sich – auch in Italien – etabliert, droht sie in der übersteigerten Hingabe an die Ästhetik schon wieder zu zerbrechen. Sperelli ist ein italienischer Verwandter des Hanno Buddenbrook: „Ich kann nichts, ich kann nur ein bisschen phantasieren, wenn ich allein bin.“20 Es ist das ewige Drama der Nachgeborenen, und wie in Lübeck führt es auch in Rom in den Untergang. Sperelli ist schließlich gezwungen, sein Appartement versteigern zu lassen. Zuvor versucht er sich der Aufgabe – für ihn ist es eine Zumutung –, eine kohärente, und das heißt in sozialer Hinsicht: bürgerliche, Existenz zu führen, durch Flucht in den Ästhetizismus zu entziehen.
Aller materiellen Sorgen zunächst ledig, lässt er sich zur Kunst treiben, in die Welt der schönen Dinge, des galanten, geistreichen Gesprächs und auf dessen Grundlage dann in die Erotik. „Mit unglaublicher Leichtigkeit ging er von einer Liebe zur anderen, umgarnte er zur gleichen Zeit verschiedene Frauen, webte er ohne Skrupel ein großes Netz von Betrug, Täuschung, Lüge, Hinterlist, um möglichst reiche Beute zu machen.“21 Es liegt auf der Hand: Andrea Sperelli ist auf der Flucht. Sein Leben verliert sich im Ästhetizismus, in kurzen, haltlosen Affären, die zu nichts anderem als bloß weiteren Affären führen – ein ewiger, unverbindlicher Zeitvertreib, aus dem nichts Ernsthaftes entstehen kann. Mit Mitte 20 schrieb D’Annunzio einen schillernd vieldeutigen Roman, ein Hohelied auf den Feinsinn des Helden ebenso wie ein Abgesang auf dessen Unfähigkeit, aus dem Leben etwas zu machen. D’Annunzio selbst kannte die Gefahren des Ästhetizismus, erlag ihnen aber nicht. Er nahm sein Leben entschlossen in die Hand, entfachte eine künstlerische und schließlich pseudopolitische Inszenierungskraft, mit der er sein Publikum über Jahrzehnte regelmäßig in Erstaunen versetzte.