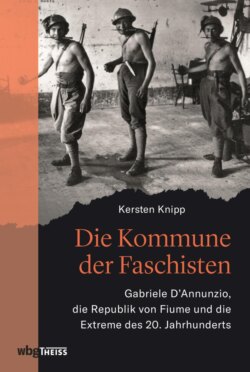Читать книгу Die Kommune der Faschisten - Kersten Knipp - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Jenseits der Wirklichkeit
ОглавлениеPrivates nach außen zu kehren heißt bei denen, die sich – über hundert Jahre vor der „Promi-Kultur“ des 21. Jahrhunderts – für ein solches Vorgehen entscheiden, vor allem eines: konsequent auf Außenwirkung zu setzen, mit ihrer Hilfe vorab kalkulierte Effekte zu erzeugen. Unentwegt an der Oper seines Lebens arbeitend, war D’Annunzio ein geschickter Regisseur seiner selbst, der genau wusste, wie seine Texte und öffentlichen Auftritte aufgenommen würden. Nicht weniger wusste er auch um die entgegengesetzte Strategie – nämlich gewisse Dinge gerade nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Wirkung, wusste D’Annunzio, erzielt auch derjenige, der bestimmte Handlungen konsequent verbirgt, der sich bei einigen seiner Entscheidungen nicht in die Karten schauen lässt. Eben dies tat er im Blick auf die Romane, Gedichte und Essays derjenigen Schriftsteller, von denen er sich inspiriert fühlte. Sehr früh hatte D’Annunzio begonnen, sein „wahnsinniges“ Bedürfnis nach sprachlicher Ausdruckskunst nicht nur für seine persönliche Entwicklung, sondern auch zur Beschleunigung seiner literarischen Karriere zu nutzen. Mit „alles verschlingendem“ Appetit40 nahm er seit jungen Jahren die jeweils jüngsten Strömungen nicht nur der italienischen, sondern auch der französischen, englischen, deutschen und russischen Literatur in sich auf. Durch sie versorgte er sich mit einem nie versiegenden Strom frischer Eindrücke und Anregungen, neuen Einfällen und Ideen, um sie dann – die Sprachschranke machte es zumindest eine Zeitlang möglich – als seine eigenen auszugeben. Weniger höflich gesagt: Ohne Bedenken kopierte und plagiierte D’Annunzio andere Schriftsteller, gab Passagen als eigene aus, die er tatsächlich irgendwo abgeschrieben hatte.
Aufmerksame Kritiker ließen ihm dieses Spiel nicht lange durchgehen. Schon 1882 wies der Kritiker Ugo Fleres auf die eigentümliche Nähe einiger Passagen von D’Annunzios Terra vergine zu Émile Zolas Roman La Faute de l’Abbé Mouret hin. Auch fiel ihm die Nähe einiger Passagen des Romans L’innocente zu den Contes von Guy de Maupassant auf. Seitdem rissen die Hinweise auf D’Annunzios unbefangenen Umgang mit den Werken seiner Vorbilder nicht mehr ab. Im Januar 1896 diskutierte der Literaturwissenschaftler Enrico Thovez in der Gazzetta letteraria unter Darbietung zahlreicher Beispiele in aller Schärfe D’Annunzios ausgeprägten Hang, sich bei anderen Schriftstellern zu bedienen: „Indem er sich die Seelen der anderen wie Hemden überstülpt, schafft der Dichter sich schließlich ein eigenes Hemd, so gut geschnitten und genäht, so reich geschmückt und passend in der Form, dass es dem Betrachter unmöglich scheint, dass darunter kein Herz schlägt und sich keine Seele regt. Zum Schluss bildet sich auch der Dichter selber ein, er besitze Herz und Seele. Über sie beginnt er in einem Anflug von Unverfrorenheit zu sprechen. Zu dieser Kategorie von Schriftstellern gehört Gabriele D’Annunzio.“41 In scharfem Ton, wenn auch nicht ohne heimliche Bewunderung zählte Thovez die verschiedenen Schreibstile auf, in denen D’Annunzio, immer mit Blick auf das jeweilige Vorbild, zu schreiben vermochte. Carducci, Maeterlinck, Shelly, Whitman, Byron, Leconte de Lisle, Flaubert, selbst Goethe und Dostojewski: Sie alle und noch eine ganze Reihe andere vermöge D’Annunzio in seinem „megalomanen Chamäleonwesen“ nachzuahmen. Dafür aber zahle er einen hohen Preis: D’Annunzio Werke, fand Thovez, seien eigentümlich leblos, ohne innere Spannung und Dramatik.42
D’Annunzio, war sich der Dichter Gian Pietro Lucini 1914 sicher, vermöge der Begegnung mit der äußeren Wirklichkeit nicht viel abzugewinnen. Er könne sich auf sie – geradezu im Wortsinn – keinen Reim machen. „Was ihm die Wirklichkeit anbietet, wird ihm nur zu einer Regung des Gefühls. Was er aber den Seiten eines Buchs entnimmt, ist eine ästhetische Regung, das heißt destillierte Emotion, in Schönheit verwandelt und in der Lage, nicht allein mit dem Verstand, sondern mit dem Geist zu kommunizieren.“43 Könnte D’Annunzio, fragt Lucini, die Schönheit eines Sonnenuntergangs an einem sanften Mai-Abend zur Kenntnis nehmen, ohne vorher über diese Schönheit gelesen zu haben? Lucini bezweifelt es. „Der Buchstaben macht auf ihn einen tieferen Eindruck als die unmittelbare Erfahrung.“44
Lucini wies D’Annunzio eine ganze Reihe von Plagiaten nach. Eines seiner Beispiele war das Gedicht „Immortalité“ des französischen Autors Armand Silvestre. Dessen erste Strophe liest sich so:
Où vont les étoiles en chœurs?
Elles vont où vont nos cœurs
Au-devant de l’aube éternelle.
Mélons notre âme à leurs rayons
Et, sur leurs ailes d’or, fuyons
A travers la nuit solennelle.45
(Wohin streben in Chören die Sterne?
Sie streben dorthin, wo unsere Herzen sind,
vor der ewigen Morgenröte.
Mischen wir unsere Seelen mit ihren Strahlen
und fliehen wir, auf ihren goldenen Flügeln,
durch die erhabene Nacht.)
So weit das Original. D’Annunzio griff es auf und ließ es in leicht abgewandelter Form in sein Gedicht „Tristezza di una notte di primavera“, veröffentlicht in dem Band La Chimera, einfließen. Seinen Lesern präsentierte es sich dann so:
Ove tendono gli astri in lento coro?
Tendono per la via de l’Ombre al Giorno.
Anima, ti congiugni ai raggi loro!
(Wohin streben die Himmelskörper
in langsamem Chor?
Sie streben auf dem Weg des Schattens
in Richtung Tag.
Seele, schließe dich ihren Strahlen an!)
Auch die folgenden Zeilen spannen das Original in stupender textlicher Nähe fort. Fortan entkam D’Annunzio seinen Kritikern nicht mehr. Ihm Plagiate oder allzu große textliche Nähe zu bereits publizierten Werken nachzuweisen, wurde für sie zu einer Art Sport.
Auch sonst kannte D’Annunzio, wenn es um die Vermehrung eigenen Ruhmes ging, wenige Skrupel. Den sehr wohlwollenden Essay von Hugo von Hofmannsthal, veröffentlicht 1893 in der Frankfurter Zeitung, dankte D’Annunzio ihm nicht – jedenfalls nicht in Form einer getreuen Übersetzung ins Italienische.46 „Traduttore, traditore“, das alte Wortspiel vom Übersetzer als (fast notwendigem) Verräter am Original, fand hier eine ganz neue Deutung – eine, in der der Übersetzer ganz wesentlich ein bewusst vorgehender Manipulator ist.
In seinem Text preist Hofmannsthal D’Annunzio, wie man es engagierter kaum tun könnte. Wohlwollend schildert er die Sensibilität seines italienischen Kollegen, seine Beobachtungsgabe, seine Hingabe an die Ästhetik sowie den Feinsinn, der aus dessen Büchern spreche. Und doch schienen von Hofmannsthals Ausführungen dem Italiener nicht durchweg passend. Also half D’Annunzio, als er den Essay für eine ausschließlich ihm selbst gewidmete Sonderausgabe der Zeitschrift Tavola Rotonda ins Italienische übersetzte – oder jedenfalls vorgab, dies zu tun –, ein wenig nach.47 So nannte von Hofmannsthal ihn einen „nervösen Romantiker“. Das behagte dem so Porträtierten wenig, und so übersetzte er den Begriff durch die Wendung „modernissimo artefice“, „ein höchst moderner Künstler“. Und aus den „schmalen weißen Händen“ wurden in der Übertragung „mani diafani“, „durchscheinende“ oder „transparente“ Hände. Auch dass Hofmannsthal in D’Annunzios Gedichtband Elegie romane einen „Katzenjammer der Neurose“ am Werke sieht, bereitete diesem kein Vergnügen – mit der Folge, dass er die Wendung kurzerhand unter den Tisch fallen ließ. Nicht anders ging es der Einschätzung des Wiener Autors, D’Annunzio schreibe im Grunde Novellen, und keine Romane – „keine, auch die längsten nicht, lassen sich eigentlich ‚Romane‘ nennen“: Auch diese Einschätzung ist in der Übertragung auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Und die Behauptung, dass die Romane eines Bourget oder Maupassant über die Schwierigkeiten des Ehelebens „höchst oberflächlich“ seien, wie in der italienischen Übersetzung zu lesen ist, hat Hofmannsthal im deutschen Original nie erhoben. Um das italienische Publikum nicht unnötig skeptisch werden zu lassen, zog D’Annunzio es vor, den Namen des Übersetzers von Hofmannsthals Essay – also seinen eigenen – unerwähnt zu lassen.
Kein Zweifel: D’Annunzio war zumindest in Teilen ein literarischer Hochstapler. Und doch kann man ihm eines nicht absprechen: dass er die Ideen der europäischen Moderne in Italien bekannt machte. D’Annunzio war auf der Apennin-Halbinsel einer der meistgelesenen Autoren. Nicht zuletzt über ihn nahmen seine Landsleute die literarischen Entwicklungen in Europa zur Kenntnis – ohne von ihm freilich darüber aufgeklärt zu werden, von wem die Gedanken und literarischen Formen tatsächlich stammten. Dennoch: D’Annunzio importierte die fiebrige fin de siècle-Stimmung nach Italien und gab den nicht minder fiebrigen Erregungen seiner Landsleute einen literarischen Ausdruck auf der Höhe der Zeit. Früher und entschlossener als jeder andere Dichter, früher auch als der 13 Jahre jüngere andere Beschleuniger der italienischen Kultur, Filippo Tommaso Marinetti, pflegte D’Annunzio jene hitzige Gefühlsbewegung, von der sich Italien in den kommenden Jahrzehnten nicht nur literarisch, sondern auch politisch ergreifen ließ.
In einem Land, das im Begriff war, seine landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft im Austausch gegen seine allmähliche Industrialisierung hinter sich zu lassen, zeigte D’Annunzio seinen Landsleuten, was an kultureller Raffinesse möglich ist, welche Umwege das Denken zu nehmen vermag – und zugleich, und zwar am Beispiel seiner eigenen, atemberaubenden Karriere, wie sich dieses Denken in Geld und Ansehen verwandeln lässt. Maßstäbe setzte D’Annunzio nicht nur durch seine Dichtung, sondern ebenso durch seinen raffinierten Umgang mit dem, was später einmal „Kulturindustrie“ heißen sollte. Mit ihren Gesetzen spielte er virtuos; früher und tiefer als andere verstand er, welche Chancen der sich professionalisierende, auf den Markt setzende Literaturbetrieb ihm bot.
Als D’Annunzio Anfang der 80er Jahre nach Rom kam, hatte die Stadt gerade zum großen Sprung in die Moderne angesetzt. Über Jahrhunderte war die Stadt Sitz des Papstes und des von ihm geleiteten Kirchenstaats gewesen. Weder die Invasion Napoleons 1808 noch die Revolutionen von 1848/49 hatten diesem Status dauerhaft etwas anhaben können. Auch Giuseppe Garibaldi versuchte 1867 mit seinen Truppen vergeblich, die Stadt dem kurz zuvor – 1861– ausgerufenen Königreich Italien hinzuzugewinnen. Erst drei Jahre später – Frankreich hatte seine im Vatikan stationierten Truppen abgezogen, um sie im Krieg gegen Preußen einzusetzen – bot sich Gelegenheit, die ewige Stadt einzunehmen. Rom wurde Teil Italiens. Der Papst und die dezidiert katholisch sich verstehenden Italiener brauchten Jahrzehnte, um ihre Empörung über die Unterwerfung der heiligen Stadt abkühlen zu lassen.
Als Sitz des Vatikans hatte Rom eine stille, abgeschiedene Existenz geführt. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts zählte die Stadt gerade 25.000 Einwohner, deren Zahl nach dem von Mazzini angeführten revolutionären Zwischenspiel allerdings rasch nach oben schnellte. Bis zu ihrer Eingliederung nach Italien unterstand die Stadt einem spröden, konservativen Katholizismus. Unter den Päpsten genügte sie sich selbst, war kulturell verschlossen und abgeschirmt gegen die Modernisierungsschübe, die Europa durchliefen. „Rom“, notierte im Mai 1870 der amerikanische Kunsthistoriker Charles Eliot Norton nicht ohne kulturkritische Untertöne, „hat seinen unbeweglichen Charakter in Teilen behalten. Die Stadt widersteht dem Vordringen der amerikanischen Barbarei und dem weltumspannenden Materialismus, der Europa so zusetzt. Die Stadt ist konservativ, nicht nur, was das Gute, sondern auch, was das Schlechte angeht. Sie klammert sich unterschiedslos an alles Vergangene, vorzugsweise – und nicht nur im physischen Sinn – an den Schmutz, den Verfall und an die Malaria.“48 Tatsächlich ist Rom eine über weite Teile unhygienische Stadt, in der in regelmäßigen Abständen die Cholera ausbricht. Auf ihre Besucher macht sie einen zwiespältigen Eindruck. „Diese Stadt ist ein Rätsel, das ich mir nicht erklären kann“, schreibt ein weiterer Besucher ungefähr um dieselbe Zeit. „Zweifellos ist Rom eine der dreckigsten Städte der Welt, voller Bettler, ein zerfallener Ort, geprägt von Aberglauben und Ignoranz. Doch trotz aller ihrer Schwächen sind wir von der Stadt so fasziniert, dass wir überlegen, die Reise zu unterbrechen und den ganzen Sommer hier zu bleiben.“
Es mag der latent dörfliche Charakter der Stadt gewesen sein, der die Besucher so faszinierte. Denn auch in seinem Zentrum war Rom ganz nach dem Geschmack derer, die im 19. Jahrhundert, als in Westeuropa die ersten Fabriken aus dem Boden wuchsen, in Richtung der Apennin-Halbinsel aufbrachen, um dort das andere, vermeintlich ursprüngliche Leben zu suchen. Ein morbider Charme geht von der zur „ewigen“ erklärten Stadt aus, eine Atmosphäre von Hinfälligkeit und Verfall, die als einer der Ersten der französische Romantiker François-René de Chateaubriand beschrieb.
1828 tritt der Dichter, Jahrgang 1768, seinen Dienst als französischer Botschafter in Rom an. Mit elegischem Blick nimmt er die Zeugen der Vergangenheit wahr – Bauten, die einst für Großes standen, die nun aber aus der Zeit gefallen scheinen, ja den Kontakt zu ihr vielleicht schon verloren haben. Das gilt, schreibt der bekennende Christ, zumindest in Rom für beide Traditionen: die der Antike wie jene, die ihr folgte, die christliche. „Der Tiber trennt diese beiden Ruhmesgeschichten: in denselben Staub gesetzt, sinkt das heidnische Rom immer tiefer in seine Gräber, und das christliche Rom steigt Schritt für Schritt in seine Katakomben zurück.“49 Chateaubriands Bemerkung ist mehr als nur topographische Beobachtung. Mit scharfem Blick erkennt der Dichter, dass hier mehr verfällt als nur eine antike Stadtlandschaft. Mit ihr, gibt er unterschwellig zu verstehen, kommt unmerklich auch die Idee selbst, die christliche Lehre, an ihr Ende. Und doch, aus all dem, hatte er bereits nach seinem ersten diplomatischen Aufenthalt im Jahr 1803/04 bemerkt, lassen sich auch morbide Wonnen ziehen: „Es ist schön, in Rom zu sein, um alles zu vergessen, alles geringzuschätzen und um zu sterben.“
1881, er ist gerade 18 Jahre alt, lässt sich D’Annunzio in der ewigen Stadt nieder. Nachdem zunächst Turin und dann Florenz zur Hauptstadt des jungen Königreichs erklärt worden waren, hatte 1871 Rom diesen Status übernommen. Die Stadt entwickelt sich, in den kommenden Jahren erlebt sie einen regelrechten Boom, ökonomisch wie kulturell. „Wer befindet sich nicht in Rom“, fragt – bereits rein rhetorisch – 1882 der Journalist und Schriftsteller Giovanni Faldella. „In seiner Qualität als nationale und katholische Hauptstadt, mit den monumentalen Zeugnissen dreier historischer Epochen, nämlich der in Marmor gehauenen römischen Antike, der noch warmen des Pontifikats und der frisch zusammengefügten italienischen, zieht Rom Menschen aus der ganzen Welt an, getreu dem Motto, dass alle Wege nach Rom führen.“50
Und auf diesen Wegen kommen ganz unterschiedliche Menschen in die Stadt. Der dem Königshaus verbundene Adel lässt sich in der Stadt nieder, dazu die politische und bürokratische Elite. Auch das Bürgertum ist vor Ort, beschäftigt nicht zuletzt mit Immobilien-Spekulation und Stadtentwicklung.
In jenen Jahren versprechen Grund und Boden lohnende Geschäfte: Ganze Viertel werden abgerissen, um Platz für große Straßen zu schaffen. Den Städteplanern kommt es auf urbane Repräsentanz an. Weiträumig, geordnet, übersichtlich, so stellen sie sich den Grundriss der neuen Hauptstadt vor. Rücksichtslos wälzen sie das Häusergewirr in der Altstadt platt, um Platz für den Corso Vittorio Emmanuele II. zu schaffen. Auch dem neuen, 130 Meter breiten und 80 Meter hohen Nationalmonument, ebenfalls dem König gewidmet, fallen bei Baubeginn im Jahr 1878 zahllose Unterkünfte zum Opfer. Auch sonst wissen die Stadtplaner um die Symbolik ihres Tuns. In jene Stätten, die bislang die Macht der Päpste repräsentierten, halten die Institutionen der Republik Einzug: Der päpstliche Gerichtspalast von Montecitorio wird zur neuen Abgeordnetenkammer, im Palazzo Madama, einst Sitz der die Geschäfte des Vatikans lenkenden Institutionen, sitzen fortan die Senatoren der jungen Republik. In großem Stil werden neue Ministerien hochgezogen, ihre repräsentative Architektur soll die Unbestechlichkeit der Bürokratie bezeugen. Allein das Finanzministerium bietet 2300 Beamten Platz.51 Zugleich bildet sich eine bürgerliche Mittelschicht heraus, aus deren Reihen jene Juristen, Professoren, Ärzte stammen, die der Stadt eine solide professionelle Basis beschert, ohne die moderne Kommunen nicht zu denken sind.
Feier im Oktober 1870 auf dem Kapitol aus Anlass des Plebiszits, nach welchem Rom die Neue Hauptstadt des Königreichs Italien werden soll.
Die neue Hauptstadt ist die ideale Bühne für einen ehrgeizigen jungen Mann wie Gabriele D’Annunzio, entschlossen, sich in ihr einen Namen zu machen. Zum Semesterbeginn schreibt er sich an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Rom ein, aber im Grunde ist das von Anfang an eine Formalie. Der akademische Werdegang reizt ihn nur mäßig, umso mehr locken Journalismus und Literatur. D’Annunzio interessiert sich vor allem für das kulturelle und soziale Leben der Stadt, die Hoffnungen und Träume, die die Bürger der Stadt hegen. Die hat inzwischen rund 300.000 Einwohner, ist bevölkert von vielen jungen Menschen, allesamt entschlossen, sich in ihr einen Platz zu erobern. Alle lockt sie der unfertige Charakter der Stadt, der gewaltige Umschwung, der das einst so ruhige Zentrum des Katholizismus in eine brodelnde Metropole verwandelt. Für findige und windige Geister tut sich hier ein Eldorado auf. Kaum eine Profession, die in der Stadt nicht gebraucht wird. „Geschäftsleute, Unternehmer und Spekulanten hatten sich in die Stadt begeben und ihr jenen Charakter einer unerschöpflichen Korruptionsquelle verliehen, die auch nach über einem Jahrhundert noch nicht erloschen ist.“52
D’Annunzio unterliegt umgehend der „sinnlichen Liebe Roms“,53 ist fasziniert vom gehobenen Bürgertum, der haute volée der Stadt. Aufmerksam beobachtet er das verschwenderische Leben der Oberklasse, ihre leichtfüßigen Sorgen, ihre oberflächliche Liebe zu Kultur und Lebensart: All dies entspricht zwar – noch – nicht seinem eigenen Lebensstil. Aber es zieht ihn an, und er will dabei sein. „Ich habe mich“, vertraut er 1882 einem Freund an, „mit derart dümmlicher Gier in die Wirbel der Kämpfe und der Lüste gestürzt, dass es, auch wenn ich mich mit warmem Herzen der fernen Freunde erinnere, mir nie gelungen ist, die träge Gleichgültigkeit zu durchbrechen und mich von den dunklen Fiebern der Sinnlichkeit zu befreien.“54
Dieser Sinnlichkeit setzt er sich fortan fast täglich aus. Nicht wenige Nachmittage und Abende des Jahres 1882 verbringt er im geräumigen Appartement seines Freundes, des Sängers und Komponisten Francesco Paolo Tosti – in einer Wohnung „voller dunkler Gänge und entlegener Seitenräume, aus denen man das kaum unterdrückte Lachen einer Frau hörte“.55 Im Herzstück, dem Salon, erlebt er wundervolle Nachmittage und Abende. „Wenn Tosti in der richtigen Stimmung war, spielte er Stunde um Stunde ohne Unterbrechung. Vor dem Klavier vergaß er sich selbst, improvisierte mit einzigartiger, wunderbar beseelter Leichtigkeit. Wir anderen lagen ausgestreckt auf dem Sofa oder auf dem Boden, übermannt von jenem spirituellen Rausch, den die Musik in dem abgeschiedenen und ruhigen Raum verströmt.“ Wieder und wieder trifft sich der Kreis, ganz der Musik und der eigentümlichen Atmosphäre der Wohnung hingegeben. „Nach zwei Monaten hatten sich unsere Sinne so verfeinert, dass jede Regung aus dem äußeren Leben uns störte und aufschreckte. Wir waren fast krank.“