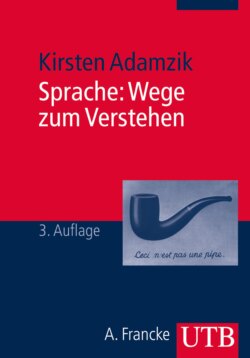Читать книгу Sprache: Wege zum Verstehen - Kirsten Adamzik - Страница 15
Оглавление|►49|
8 Sprachzeichen als psychische Größen
Das sprachliche Zeichen hat zwei Seiten
Die Wörter einer Sprache, die lexikalischen Einheiten, müssen wir lernen, das ist selbstverständlich. Es sind eben konventionelle Zeichen. Das Lernen eines Zeichens führt dazu, dass es Bestandteil der Kenntnisse eines Menschen ist, und dies bedeutet, dass es sich um eine psychische Größe handelt. Die Sprachkenntnis besteht also darin, dass ein Mensch in seinem Kopf über eine Menge von Einheiten verfügt, bei denen ein Zeichenkörper konventionell mit einer bestimmten Bedeutung verbunden ist. Es handelt sich daher um komplexe Einheiten, die aus der Verbindung von zwei Größen, Ausdruck und Inhalt, bestehen. Dass die Verbindung konventionell ist, heißt auch, dass weder eine
Die Verbindung ist arbiträr
bestimmte Bedeutung natürlicherweise mit einem bestimmten Zeichenkörper verbunden wird, noch dass ein bestimmter Zeichenkörper natürlicherweise auf eine bestimmte Bedeutung hinweist. Saussure nennt dies die Arbitrarität des Zeichens (l’arbitraire du signe). Tatsächlich gibt es in Sprachsystemen fast überhaupt keine ikonischen Elemente; nur einigen Randerscheinungen kann ein solcher Charakter
Lautmalerei: Onomatopoetika
zugesprochen werden. Dies sind vor allem lautnachahmende Ausdrücke wie kikeriki, cocorico oder cock-a-doodle-doo, die mehr oder weniger gut den Hahnenschrei imitieren und in dieser konventionellen Form in das Lexikon der deutschen, französischen bzw. englischen Sprache eingegangen sind. Solche Zeichen nennt man onomatopoetische (von griechisch onomatopoiein ›benennen‹ – die ursprüngliche Bedeutung enthält also nicht die Komponente ›lautmalerisch‹).
Die Inhaltsseite: signifié
Daran, dass die Bedeutung psychisch gespeichert ist, würde wohl niemand zweifeln. Denn gespeichert haben wir ja nicht etwa die konkrete Vorstellung des einen Telefons, das jemand meint, wenn er sagt Geh mal zum Telefon – und natürlich schon gar nicht das Telefon selbst, denn physische Objekte kann man gar nicht im Kopf speichern. Immerhin wäre es denkbar, dass das, was wir da gespeichert haben, visuelle Eindrücke der diversen Telefone sind, die wir im Laufe unseres Lebens gesehen haben. Dann würde allerdings jeder mit dem Ausdruck Telefon etwas anderes verbinden. Das ist ja wahrscheinlich auch der Fall, für jeden ergeben sich individuelle Assoziationen auf Grund der |49◄ ►50| jeweils besonderen Erfahrungen, die er mit diesem Gerät gemacht hat. Diese individuellen Assoziationen können aber nicht Bestandteil des Sprachsystems sein, denn sie sind eben nicht kollektiv verbindlich und konventionalisiert. Zum Sprachsystem gehört vielmehr nur eine sehr abstrakte Bedeutung, die im Duden Universalwörterbuch folgendermaßen (wohl nicht ganz glücklich) umschrieben wird: ›Apparat (mit Handapparat und Wählscheibe oder Drucktasten), der über eine Drahtleitung oder drahtlos Telefonate möglich macht‹. Diese Komponente des Zeichens nennt nun Saussure zunächst concept, und er führt dann dafür den Terminus signifié ein. Der signifié ist also die psychisch gespeicherte abstrakte Bedeutung eines Zeichens.
Die Ausdrucksseite: signifiant
Schwieriger zu verstehen ist schon, dass auch die lautlichen und grafischen Komponenten psychisch gespeichert und abstrakt sind, denn bei ihnen handelt es sich ja durchaus um reale, physikalische Phänomene. Dennoch – oder vielmehr gerade deswegen, weil die jeweils realen Lautfolgen oder grafischen Gebilde empirische Einzelphänomene sind – müssen wir von ihnen eine abstrakte Vorstellung haben, so abstrakt, dass man in verschiedenen konkreten Realisierungen immer dasselbe Element wiedererkennen kann. So erkennen wir in den folgenden Realisierungen immer denselben Zeichenträger wieder:
Auch wenn man dieses Wort akustisch realisiert, kann man das auf sehr verschiedene Weise tun. Psychisch gespeichert ist jedoch nur das abstrakte Laut- oder Schriftbild, das von diesen Verschiedenheiten absieht. Saussure nennt dies (unter Beschränkung auf die gesprochene Sprache) zunächst image acoustique und führt dann dafür den Terminus signifiant ein. Dieser soll von jetzt an auch bei uns den Ausdruck Zeichenträger ersetzen. Das Zeichen wird danach von Saussure wie in Abbildung 8 modelliert.
Die Konventionalität der Zeichen
Signifié und signifiant bilden zusammen das sprachliche Zeichen (signe linguistique). Sie sind, wie Saussure sagt, miteinander verbunden wie zwei Seiten eines Blattes Papier. Auf Grund der festen Zuordnungskonvention im Rahmen des einzelsprachlichen Systems ruft ein signifiant im Geiste unmittelbar den zugehörigen signifié hervor – und andersherum. Die Beziehung ist nicht auflösbar. Man spricht sprachlichen Zeichen deshalb die Eigenschaft der Konstanz zu. Wer also willkürliche Veränderungen in den Zuordnungen vornimmt (und nicht wenigstens sicherstellt, dass diese Sonderkonventionen auch von anderen übernommen werden), kann mit Hilfe des gegebenen Sprachsystems nicht mehr kommunizieren (vgl. dazu das Textbeispiel 10). Dies gilt, obwohl es ja im Prinzip gleichgültig (arbiträr) ist, welcher signifiant einem bestimmten signifié zugeordnet wird und die verschiedenen Einzelsprachen ganz unterschiedlich verfahren. Dies zeigt noch einmal die große Bedeutung der Konventionalität des sprachlichen Zeichens. Sprachzeichen funktionieren eben immer nur im Rahmen des Systems einer langue.
Abb. 8: Das sprachliche Zeichen nach Saussure
|50◄ ►51|
Textbeispiel 10: Sprachliche Langeweile
Ich will von einem alten Mann erzählen, von einem Mann, der kein Wort mehr sagt, ein müdes Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, um böse zu sein. […]
Der alte Mann machte morgens einen Spaziergang und nachmittags einen Spaziergang, sprach ein paar Worte mit seinem Nachbarn, und abends saß er an seinem Tisch.
Das änderte sich nie, auch sonntags war das so. Und wenn der Mann am Tisch saß, hörte er den Wecker ticken, immer den Wecker ticken.
Dann gab es einmal einen besonderen Tag, einen Tag mit Sonne, nicht zu heiß, nicht zu kalt, mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Leuten, mit Kindern, die spielten – und das Besondere war, daß das alles dem Mann plötzlich gefiel.
Er lächelte.
»Jetzt wird sich alles ändern«, dachte er […]
Aber im Zimmer war alles gleich, ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett. Und wie er sich hinsetzte, hörte er wieder das Ticken, und alle Freude war vorbei, denn nichts hatte sich geändert.
Und den Mann überkam eine große Wut. […]
»Immer derselbe Tisch«, sagte der Mann, »dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und dem Tisch sage ich Tisch, dem Bild sage ich Bild, das Bett heißt Bett, und den Stuhl nennt man Stuhl. Warum denn eigentlich?« Die Franzosen sagen dem Bett »li«, dem Tisch »tabl«, nennen das Bild »tablo« und den Stuhl »schäs«, und sie verstehen sich. Und die Chinesen verstehen sich auch.
»Weshalb heißt das Bett nicht Bild«, dachte der Mann und lächelte, dann lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und »Ruhe« riefen.
»Jetzt ändert es sich« rief er, und er sagte von nun an dem Bett »Bild«.
»Ich bin müde, ich will ins Bild«, sagte er, und morgens blieb er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl »Wecker«.
Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch, er hieß jetzt Teppich. Am Morgen verließ also der Mann das Bild, zog sich an, setzte sich an den Teppich auf den Wecker und überlegte, wem er wie sagen könnte.
Dem Bett sagte er Bild.
Dem Tisch sagte er Teppich.
Dem Stuhl sagte er Wecker.
Der Zeitung sagte er Bett.
Dem Spiegel sagte er Stuhl.
Dem Wecker sagte er Fotoalbum.
Dem Schrank sagte er Zeitung.
Dem Teppich sagte er Schrank.
Dem Bild sagte er Tisch.
Und dem Fotoalbum sagte er Spiegel.
Also:
Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen, um neun läutete das Fotoalbum, der Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an die Füße fror, dann nahm er seine Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, |51◄ ►52| setzte sich dann auf den Wecker an den Teppich und blätterte den Spiegel durch, bis er den Tisch seiner Mutter fand.
Der Mann fand das lustig, und er übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter ein. Jetzt wurde alles umbenannt: Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß, und der Fuß war ein Morgen und der Morgen ein Mann. […]
Der alte Mann kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den neuen Wörtern voll, und er hatte viel zu tun damit, und man sah ihn nur noch selten auf der Straße.
Dann lernte er für alle Dinge die neuen Bezeichnungen und vergaß dabei mehr und mehr die richtigen. Er hatte jetzt eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehörte. […]
Und es kam so weit, daß der Mann lachen mußte, wenn er hörte, wie jemand sagte:
»Gehen Sie morgen auch zum Fußballspiel?« Oder wenn jemand sagte: »Jetzt regnet es schon zwei Monate lang.« […]
Er mußte lachen, weil er all das nicht verstand.
Aber eine lustige Geschichte ist das nicht. Sie hat traurig angefangen und hört traurig auf. Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen, das war nicht so schlimm. Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen.
Und deshalb sagte er nichts mehr.
Er schwieg, sprach nur noch mit sich selbst, grüßte nicht einmal mehr.
Die relative Motiviertheit
Wenn die Beziehung zwischen signifiant und signifié – da sie ja arbiträr ist – für jedes Gesamtzeichen einzeln gelernt werden müsste, wäre die Aufgabe, eine Sprache zu lernen, unglaublich groß. In Wirklichkeit müssen wir jedoch nicht jedes Einzelzeichen mit seinen zwei Seiten neu lernen. Wenn man z.B. weiß, dass drei ›3‹ bedeutet und zehn ›10‹, ist es ja nicht besonders schwierig darauf zu kommen, dass dreizehn ›13‹ bedeutet; wenn man weiß, dass Hund ›chien‹, Katze ›chat‹ und Hündchen ›petit chien‹ bedeutet, wird man wohl nicht lange darüber nachzudenken brauchen, was Kätzchen bedeutet. Die vielen Einzelzeichen einer |52◄ ►53| Sprache erklären sich also großenteils gegenseitig. Saussure spricht hier von relativer Motiviertheit. Anders als bei den onomatopoetischen Zeichen beruht die selbsterklärende Kraft dabei nicht auf Ikonizität, sondern auf systeminternen Beziehungen. Das Prinzip der Konventionalität der Zeichen wird dadurch eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Es ist zweifellos leichter, sich den signifiant dreizehn für ›13‹ zu merken, als den signifiant treize aus trois und dix herzuleiten; dreizehn ist also stärker motiviert als treize, aber es könnte natürlich auch ›3 x 10‹, also ›30‹ bedeuten – und wie abwegig es Nicht-Deutschsprachigen erscheint, einunddreißig zu sagen statt dreißigundeins, ist wohl allgemein bekannt. Die Motiviertheit ist deswegen immer nur relativ.
|53◄|