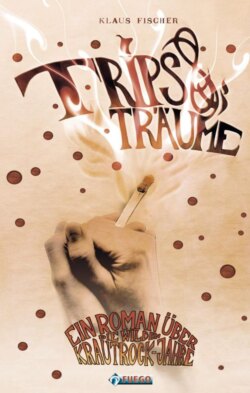Читать книгу Trips & Träume - Klaus Fischer - Страница 8
Оглавлениеvier Atom Heart Mother
In jeder Band sollte es jemanden geben, der das Sagen hat, der alles in die Hand nimmt und die Richtung vorgibt. Jede Band braucht einen Chef.
Bei Dreamlight war das Mark. Leider konnte Mark manchmal ein rechter Kotzbrocken sein.
»So werdet ihr nie Rockstars. Ihr müsst euch mehr anstrengen«, schimpfte er. »Gebt alles, was ihr draufhabt!«
Mit verächtlicher Miene warf er die Trommelstöcke in die Ecke. Sie probten seit zwei Stunden, und bislang war nur Mist herausgekommen.
Er legte ein Arbeitstempo vor, bei dem die anderen nicht mithalten konnten. Natürlich hatte er seine Hausaufgaben gemacht. Er kloppte den Beat in die Felle, dass es eine Freude war. Hi-Hat, Standtom, Bassdrum, Hängetom und Becken wurden vom Meister virtuos bearbeitet.
Skip war noch nicht so weit. Zum x-ten Mal verpatzte er seinen Einsatz. Paul hinkte ebenfalls hinterher, er schaffte es nicht, sein Gitarrenriff fehlerfrei über die Runden zu bringen. Gero orgelte entnervt vor sich hin.
Warum sie sich auch an einem Monstertrack wie »Atom Heart Mother« von Pink Floyd ausprobieren mussten, war mir ein Rätsel. Das Stück war mehrere Nummern zu groß für sie, es überstieg ihre Möglichkeiten. Bei ihnen klang es verschrobener als jede Art von Space-Rock, die ich kannte. Selbst Ash Ra Tempel hätten gekotzt.
Mark hatte recht, sie mussten alles geben, regelrecht über sich hinauswachsen, sonst würde der Auftritt auf dem Festival ein Desaster werden. Aber dass er seinem Frust freien Lauf ließ, war auch keine Lösung.
Es brachte nur schlechte Schwingungen ins Spiel. Wie nicht anders zu erwarten, war die Stimmung am Boden. Skip stierte stumm in eine Ecke, Paul kämpfte mit seiner Wut. Und Gero verdrehte entnervt die Augen.
Ein Motivationsschub musste her. »Dafür, dass es eure erste Probe ist, klang es gar nicht so schlecht«, sagte ich.
Mark winkte ab. »Du hast doch keine Ahnung.«
Ich verstand genau, wie er das meinte. Es ist meine Band. Und du hältst dich da gefälligst raus, sollte das heißen.
»Wir müssen uns nicht ans Original halten. Wir spielen unsere eigene Version. Das nennt man künstlerische Freiheit«, versuchte Skip abzuwiegeln.
Paul schickte böse Blicke in Richtung seines Drummers. »Ich habe dein Gemecker satt. Verdammt, nie passt dir etwas, an allem hast du was auszusetzen. Kannst ja mal bei Bill Bruford anfragen, vielleicht lässt er dich die Becken putzen.« Der Yes-Schlagzeuger war Marks Lieblingstrommler.
»Hör einfach auf, wie ein Neandertaler auf deiner Gitarre die Akkorde zu schrubben. Bereite dich besser vor, dann kannst du auch dein Zeugs richtig spielen«, konterte Mark, ohne Paul anzuschauen.
Dann knöpfte er sich Skip vor. »Ich sehe es an deinen Augen, du bist zugeknallt bis unter den Haaransatz. Wir hatten doch verabredet, dass wir auf der Probe ungedopt auftauchen?«
Skip hatte eine Anordnung des Chefs missachtet und begann sich um Kopf und Kragen zu reden. »Mann, das verstehst du nicht. Ich spüre dann die Musik intensiver. Ich entwickle irgendwie ein besseres Gefühl. Meine Finger flutschen wie von selbst über die Saiten.«
Seit Drogen in die Musik Einzug gehalten hatten, und das musste schon in der Steinzeit passiert sein, experimentierten Künstler damit, unter allerlei chemischen und natürlichen Rauschmitteln tolle Werke hinzubekommen. Über das Ergebnis wurde heftig gestritten, und eine abschließende Meinung gab es nicht. Für eine bestimmte Phase der künstlerischen Entwicklung konnte es gutgehen, neue Horizonte schienen sich zu eröffnen.
Charlie Parker, der frühverstorbene Bebop-Pionier, war die letzten Jahre seines Lebens auf Heroin. Ganz Schlaue meinten, da hätte er besonders gut gespielt. Aber war das nicht letztlich eine Beleidigung von Parkers Können, so etwas zu behaupten? Mit oder ohne Drogen, Parker blies das Altsax auf einem atemberaubend hohen Niveau.
Über Miles Davis, den Trompeter, hatte ich kürzlich gelesen, dass er seine Drogensucht überwunden habe. Mit oder ohne Drogen, Davis’ Werk gehörte zum Besten im Jazz.
Mal davon abgesehen, dass mein geliebter Krautrock durch und durch drogengeschwängert daherkam, gab es jede Menge Songs über Drogen: »White Rabbit« von Jefferson Airplane, »Purple Haze« von Jimi Hendrix, »Cold Turkey« von der Plastic Ono Band, »Heroin« von Velvet Underground, um nur die zu nennen, die mir spontan einfielen. Selbst die Small Faces hatten ihren Drogensong mit »Here Come the Nice«. Fats Waller, der dicke Jazz-Pianist, huldigte einst mit »The Reefer Song« dem guten alten Gras.
Mark und seine Jungs hatten ganz andere Sorgen. Sie mussten erst mal überhaupt einen Song hinbekommen.
Zum Glück hatten sie Gero. Er war jemand, der für Ausgleich sorgte.
Gero war bei Dreamlight der ruhende Pol. »Beruhigt euch. Lasst es uns einfach noch mal probieren. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.«
Ich klinkte mich aus, wollte ihren Streitereien nicht mehr folgen und schaute mich im Proberaum um. Die Wände des Kellers waren tatsächlich mit Eierkartons zugepappt, die nackte Glühbirne war verschwunden, dafür hing an der Decke eine Baulampe. Der Boden war mit Teppichen ausgelegt.
Irgendwie gemütlich.
Mark hatte sich mit seinem Schlagzeug an der Längsseite des Kellers, genau in der Mitte der Wand, aufgebaut. Trat man durch die schwere Eisentür, blickte man zuerst auf ihn.
An der Stirnseite stand ein Sofa vom Sperrmüll. Dort saß ich und machte mir Notizen. Jemand vom großen Regionalblatt, das auch ein Büro in unserem Kaff unterhielt, hatte meinen Artikel in Das Auge gelesen. Don stand im Impressum, also wurde er angerufen, und man erkundigte sich nach dem Autor von Rock Power gegen grauen Spießermief.
Jetzt sollte ich etwas »Seriöses« über die junge Musikszene in der Stadt schreiben. Mein erster Auftrag für eine richtige Zeitung. Zweihunderttausend verkaufte Exemplare. Dagegen konnte Das Auge mit seiner Fünfhunderter-Auflage nicht anstinken.
Ich war die Verhandlungen wie ein Profi angegangen.
Der Typ am Telefon stellte sich mit Schirmer vor und entpuppte sich als Leiter der Lokalausgabe. Klar, sagte er, Honorar würde es geben, er brauche sechzig Zeilen zu je dreiunddreißig Anschlägen, und zwar bis Montag, und weil ich mich anscheinend auskenne, würde er mir fünfzig Pfennig pro Zeile geben. Das mache dreißig Mäuse für den Artikel, mehr sei nicht drin. Für Anfänger gebe es sonst nur die Hälfte. Er käme mir da schon sehr entgegen.
»Fünfzig Mark«, sagte ich dem Honorarfuchs.
Ich merkte, wie Schirmer am anderen Ende der Leitung schluckte, doch dann willigte er ein. Anscheinend wollte er den Artikel wirklich. Jetzt habe ich mich an die bürgerliche Presse verkauft, dachte ich.
Ich guckte mich weiter im Proberaum um. Das Equipment von Dreamlight konnte sich wirklich sehen lassen.
Pauls Ausrüstung bestand aus zwei Boxen, die er übereinandergestellt hatte. Obendrauf thronte ein 100-Watt-Verstärker von Dynacord, dessen Mastervolumen er auf acht gedreht hatte. Sein Gitarrenturm überragte ihn um zwei Kopflängen. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um an die Regler zu kommen. Die Ibanez-Gitarre war eingestöpselt in Verzerrer, Wah-Wah-Pedal und Phaser. Die Effektgeräte lagen fein säuberlich aufgereiht vor ihm auf dem Boden. Es waren batteriebetriebene Dinger von der Größe eines Schuhkartons. In Musikerkreisen wurden sie Tretminen genannt. Und zwar deshalb, weil die Herren Gitarristen auf die Teile treten mussten, um die Effekte, die sie produzierten, mit einem Klack einzuschalten.
Das Wah-Wah war nur ein Pedal. Aber eines, das es in sich hatte. Wenn man den Fuß darauf stellte, es nach unten bewegte und gleichzeitig auch noch eine Saite anschlug, entstand tatsächlich ein Klang, der sich anhörte wie eine menschliche Stimme, die »wah-wah« macht. Alle großen Gitarristen benutzten es. Hendrix hatte damit »All Along the Watchtower« eingespielt. Dann der Verzerrer. Er erlaubte es, bereits bei niedriger Lautstärke die Gitarre kontrolliert zum Röhren zu bringen. Der Phaser schließlich brachte die Töne zum Schweben. Steve Howe von Yes, Pauls großes Vorbild, arbeitete mit diesem Effekt. Dass Paul diese Tretminen besaß, hieß nicht, dass er mit ihnen umzugehen verstand. Wenn er auf die Effekte drückte, dröhnte es zwar mächtig wie ein Düsenjäger, es fiepte und jaulte, aber nicht wie bei Hendrix oder Steve Howe, sondern es klang eher wie das Grunzen und Japsen von Schweinen, die gerade abgeschlachtet wurden.
Skip verwendete einen 70-Watt-Bassking-Verstärker, ebenfalls von Dynacord. Der stand auf einer Dynacord-D-50-Box, die ihm bis zur Hüfte ging. Die Teile blitzten und blinkten wie ein Neuwagen. Selbst die verchromten Stoßecken der Box hatte er spiegelblank gewienert. Sein ganzer Stolz war der Framus-Bass. Den putzte er mit einem Staubtuch. Angeblich würde das Jack Bruce, Skips große Inspiration, auch so machen. Nur dass Skip nicht annähernd so spielen konnte wie sein Idol. Dafür hatte er ein besonderes Posing drauf. Beim Bassspielen spitzte er die Lippen, als wolle er jemanden küssen, dann neigte er sich wie ein Tänzer an der Ballettstange leicht zur Seite und ließ die Finger über die Saiten gleiten, als liebkose er den Hals einer Frau.
Gero war der nüchterne Typ. Er rückte seine Brille zurecht und kramte irgendwelche Zettel aus einer alten Kladde, die er auf die Farfisa legte. Jene Orgel, die vor wenigen Tagen noch im Wohnzimmer seiner Eltern gestanden hatte. Es war ein feines Instrument, nicht ganz so imposant wie die berühmte Hammond, auf der sein Idol Keith Emerson brillierte. Gero spielte über einen Echolette-Koffer. Das Ding war Verstärker und Box in einem.
Gero war für Mark, der sich wieder hinter seine Schießbude begeben hatte, unerlässlich. Gero besaß die Ruhe, die Mark fehlte. Das Goldlöckchen hatte bei »Atom Heart Mother« in nächtelanger Arbeit die Bass- und Gitarrenläufe herausgehört. Ach ja, hätte ich beinahe vergessen. Und er setzte ein Leslie ein, natürlich nicht das teure Original, sondern einen Nachbau. Das war eine Box, in der sich ein kleiner Lautsprecher drehte. Wenn er die richtige Geschwindigkeit erreicht hatte, kam dieses Wummern zustande, das die Orgel rocken und rollen ließ.
Wimmernde Gitarrenklänge rissen mich aus meinen Gedanken. Die Probe ging weiter. Mark und die Jungs rauften sich noch einmal zusammen.
Neben mir auf dem Sofa hockte Don und bohrte mit sturem Blick Löcher in die Decke. Er hatte die ganze Zeit über noch kein Wort gesagt. Müde sah er aus, tiefe Ränder unter den Augen. Seine Haare waren zersaust, als sei er gerade aus dem Bett gefallen. Außerdem waren sie längere Zeit nicht geschnitten worden, sie reichten schon über die Ohren. Der Flaum eines Fünftagebartes machte sich auf seinem Gesicht breit.
Das passte nicht zu ihm. Ich brachte es nicht zusammen. Don war der typische Musterknabe, der seinen Eltern alle Ehre machte. Er war darauf bedacht, ein vollwertiges Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, also der Spießerwelt, zu sein. Während seiner Zeit als Schulsprecher hatte er der Jungen Union angehört. Seine Jeans hatte Bügelfalten und war farblich auf das hellblaue Hemd abgestimmt. Dazu trug er ein Kaufhof-Jackett und schicke braune Lederschuhe. Seine Eltern besaßen einen Schreibwarenladen, gingen sonntags zum Hochamt, sein Vater saß im Vorstand der örtlichen CDU.
Unter all den Freaks, Kiffern und Szenefiguren war Don der Angepasste geblieben, ein Vertreter des Establishments. Damit gab er oft genug den Buhmann ab, auf den die Freaks wunderbar ihren Hass aufs Schweinesystem abladen konnten. Seit dem Auftritt im Rats aber, als er die Flugblätter anbrachte, die ich ihm unabsichtlich aus der Hand geschlagen hatte, hatte sich die Wahrnehmung gewandelt. Er wurde in der Szene plötzlich respektiert. Und nun sah er selbst fast wie ein Freak aus.
»Du wirkst so verändert, was ist los?«, fragte ich.
Er ging hoch wie eine Rakete. »Ich bin total angepisst! Ich habe mir den Arsch aufgerissen! Und wofür das alles? Noch nicht mal ein Danke habe ich bekommen!«
Was war denn mit dem passiert?
Der Impresariojob musste ihn ja ganz schön mitnehmen.
»Manager haben immer die Arschkarte«, sagte ich.
Er lief hochrot an. »Jetzt gib mal schön acht, Knallkopf. Plakate drucken, Anzeigen schalten und Flugzettel herstellen, du glaubst doch nicht, dass das alles kostenlos vom Himmel fällt. Und dann habe ich den Heinis da, die nichts auf die Reihe kriegen, auch noch eine anständige Anlage besorgt. Das habe ich aber nicht gemacht, damit die hier so einen Schrott abliefern.«
»Bis zum Festival hat Mark sie so weit, was erwartest du? Sie spielen heute das erste Mal zusammen. Sie fangen gerade erst an, vergiss das nicht«, warf ich ein. »Scheiße, bis dahin bin ich pleite. Ich kann seit Tagen nicht mehr richtig schlafen. Ich habe eine Firma gegründet, das Geschäft muss laufen, aber im Moment habe ich nur Ausgaben, nichts als Ausgaben, die Arbeit wächst mir über den Kopf«, sagte er. Es klang verzweifelt.
Ich schaute ihn verdutzt an.
Anscheinend setzte er sich selbst mächtig unter Druck. Er wollte es allen beweisen; seinen Eltern, den Freaks, ja der ganzen Welt wollte er zeigen, dass er es draufhatte.
Er hielt meinem Blick stand. »Hast du schon mal von einem Typen gehört, den sie Pop-Fürst nennen?«
»Und ob!«, entfuhr es mir.
Pop-Fürst – die Musikpresse hatte ihn so getauft – war der Chef von zwei Plattenfirmen. Es waren nicht irgendwelche, nein, es waren die wichtigsten Labels, die es derzeit im Rock-Underground gab. Darauf hatte er einige Bands groß rausgebracht. Fürst war das, was Don gern sein wollte, ein echter Impresario. Fürst spielte in der Oberliga. Selbst im New Musical Express war sein Name in einem Bericht über Krautrock aufgetaucht.
»An den müssen wir rankommen«, sagte Don.
»Jetzt bist du es, der einen Knall hat«, antwortete ich.
»Ich prophezeie dir, wenn wir den für unsere Sache gewinnen, dann erhält das Festival eine Aufmerksamkeit, die kannst du dir nicht vorstellen. Die Presse wird hier einfallen. Das ist auch eine Chance für dich, einmal was für die großen Musikblätter zu schreiben, das wäre es doch, davon träumst du doch schon lange.«
Don spinnt total, dachte ich. »Fürst interessiert sich nicht die Bohne dafür, was in unserem Kaff abgeht. Unser kleines Musikfieber lässt den völlig kalt, der arbeitet in einer ganz anderen Liga. Für den sind wir kleine Fische. Mal davon abgesehen, dass wir nicht an ihn rankommen.«
»Mit deiner Hilfe könnte das gelingen. Du kennst dich aus in der Szene, weißt über all die neuen Bands Bescheid und kannst mitreden. Das wird ihm gefallen. Wir schreiben ihm, noch besser, wir rufen ihn an. Nein, du rufst ihn an. Ich wollte dich sowieso fragen, ob du nicht mein Assistent werden willst. Ich brauche Unterstützung, ich schaff das nicht allein«, sagte Don.
Übergeschnappt. Es gab keine andere Erklärung. Oder hatte er was von dem roten Libanesen geraucht, der in der Stadt kursierte? Ich konnte mir sein Verhalten nur durch den Schlafentzug erklären, von dem er gesprochen hatte. Hausgemachter Erfolgszwang vernebelte ihm den Blick für die Realität. Pop-Fürst fürs Festival gewinnen! Und ich sollte ihm den Assistenten machen? Ich hatte davon doch keine Ahnung.
Aber halt, dachte ich plötzlich, die Idee, Fürst zu kontaktieren, war vielleicht doch nicht so abwegig. Dons Engagement hatte es verdient, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen.
Sein Talent zum Manager war nicht von der Hand zu weisen. So schnell, wie er Mark davon überzeugt hatte, dass nur er Dreamlight zum Erfolg verhelfen könne, und dass der Erfolg sich nur unter ihm einstellen würde. Denn er glaube an die Truppe. Er plane übers Festival hinaus, Konzerte, Plattenproduktionen. Das waren seine Worte gewesen. Ich hatte Mark interessiert zugehört, als er mir die Geschichte schilderte. Und dann hatte Don einen richtigen Vertrag aufgesetzt, den alle in der Band unterschrieben.
Er war nun offiziell für die Belange von Dreamlight zuständig. Und das musste ich ihm lassen, für die erste Probe hatte er einiges auf die Beine gestellt. Don hatte mit Köfers Willi geredet, einem Typen um die fünfzig, mit blondem, angegrautem Haar und Buddy-Holly-Brille. Köfers Willi unterhielt direkt neben dem Rats einen Laden für Elektrobedarf. Vorn gab es Lampen, Fernseher und Kühlschränke. Doch weiter hinten, außer Sichtweite seiner Hausfrauenkundschaft, hatte er eine Ecke mit Instrumenten eingerichtet.
Köfers Willi verkaufte keine Gitarren von Fender oder Gibson. Das waren die Marken, die die großen Stars spielten. Auch hatte er keine namhaften Verstärker wie die von Marshall, Vox oder Orange vorzuweisen. Aber er konnte gut erhaltene, gebrauchte Teile besorgen. Gitarren und Bässe wie die von Framus und Ibanez eben, Verstärker wie die von Dynacord und Echolette. Auch wenn es nicht das Profi-Equipment war, handelte es sich dennoch um solide Ware, und was das Wichtigste war – sie war bezahlbar.
Seit dem Ausbruch des Musikfiebers liefen Wills Geschäfte bestens. Laut Don prahlte er damit, dass er kaum mit den Lieferungen hinterherkomme, da schon ein paar andere Bands bei ihm vorstellig geworden seien.
Don und Will hatten schließlich einen Deal getroffen. Und der ging so: Will stellte Dreamlight Instrumente und Verstärker zur Verfügung – auf Kommission. Als Gegenleistung verpflichtete sich die Band, für ihren Gönner Werbung zu betreiben und bei ihren Auftritten (welche Auftritte? Die Band hatte noch nicht mal ein Programm) zwanzig Prozent der Einnahmen an Will abzudrücken, als sogenannten Schuldenabtrag.
Dons Vorgehensweise faszinierte mich. Seine Methoden waren nichts Neues, er hatte sie sich bei den großen Bands abgeguckt. Aber dass er die Chuzpe besaß, diese Strategien in unserem Kaff anzuwenden, imponierte mir.
Led Zeppelin oder die Rolling Stones bekamen ihr Equipment auch kostenlos von den Herstellern. Jimmy Page hatte nie im Leben auch nur einen Dollar für seine Gibson und den Marshall-Turm hingelegt. Wenn Keith Richards eine neue Gitarre brauchte, ließ er bei Fender anrufen und bekam sie persönlich in die Garderobe geliefert. Danke, Herr Richards, es ist uns eine Ehre, dass Sie unsere Instrumente benutzen. So lief das.
Dreamlight waren aber nichts weiter als vier Typen mit Flausen im Kopf. Doch sie hatten Don, und der hatte alles clever eingefädelt.
Selbst Mark profitierte von der Vereinbarung. Er hatte einen Satz neuer Felle bekommen, dazu Trommelstöcke, einen komfortableren Hocker, zwei zusätzliche Becken und eine zweite Hängetom. Nicht zu vergessen die neue Fußmaschine.
Außerdem hatte Don sich verpflichtet, die Gesangsanlage für das Festival sowie das nötige Zubehör bei keinem anderen als Köfers Willi zu leihen.
Für den Anfang war das, was Don geleistet hatte, beachtlich. Er hatte was bewegt. In diesem Licht betrachtet, erschien mir mit einem Mal sein Plan, Pop-Fürst für das Festival zu begeistern, doch nicht so blöd.
»Ich denk darüber nach«, sagte ich. »Ich komm bei dir vorbei, wenn ich diesen Artikel fürs Lokalblatt fertig habe. Dann reden wir über alles, einverstanden?« Er kratzte sich grinsend die Fünftagestoppeln. »Dann muss ich mir also doch keine Matte wachsen lassen und Sartre lesen, damit du mich ernst nimmst.«
Er brummelte noch was von wichtigen Angelegenheiten, rief »Ciao« in die Runde und war durch die schwere Eisentür verschwunden.
»Hey, alle mal herhören«, meldete sich Mark zu Wort, »wenn die Managergespräche beendet sind, kann es weitergehen. Wir wollen das Stück noch einmal probieren. Ich hoffe, ihr seid so weit.«
Ach ja, die gab es ja auch noch. Die Herren Künstler wollten wieder zur Tat schreiten. Würden sie nun endlich die Kuh zum Fliegen bringen?
*
Ich hatte mit meiner Einschätzung gar nicht so falschgelegen.
Wenn Mark das rhythmische Herz von Dreamlight war, dann war Gero das musikalische Hirn der Gruppe.
Er beherrschte ein paar Sachen aus Béla Bartóks »Mikrokosmos«. Aber immer nur die ersten acht Takte, mehr hatte er aus dem Klavierunterricht nicht behalten. Da Skip und Paul in puncto Notierung schwach waren, hatte er ihnen eine Art Tabulatur aufgeschrieben, aus der genau ersichtlich war, wie viele Takte Paul sein Riff und welchen Lauf Skip spielen musste, wann ein Tonart- oder Tempowechsel anstanden.
Sie hatten sich mit ihren Instrumenten und Verstärkern kreisförmig um Marks Schlagzeug aufgebaut. Gero links, Skip und Paul rechts davon. Ich trat in ihre Mitte, sodass mich alle sehen konnten.
»Wollt ihr nur eine Coverband sein, oder was?«, rief ich, bevor sie erneut loslegten. Vorsichtig näherte ich mich Paul und seinem Gitarrenturm.
»Was soll das, seit wann sagst du, wo es langgeht«, knurrte er, »du bist doch hier nur der Tintenquäler!«
»Soll ich in meinen Artikel etwa schreiben, dass ihr nur eine lausige Nachspieltruppe seid?«, provozierte ich.
Mark schaute mich entgeistert an. »Wir spielen ›Atom Heart Mother‹ bloß deshalb, weil es uns allen gefällt.«
»Aber warum keine eigenen Stücke? Euer Krach, den ihr vorhin fabriziert habt, der war eigentlich gar nicht schlecht. Wenn es euch gelingt, den in die richtigen Bahnen zu lenken, dann seid ihr Avantgarde.«
»Mit der Zeit kommen eigene Stücke ganz von selbst«, erwiderte Mark.
Ich kapierte sofort. Der Boss hatte keinen Bock mehr auf Diskussionen. »Okay, ich wollte das nur mal klargestellt haben, dass ich dann auch nichts Falsches in die Zeitung setze«, sagte ich und zog mich aufs Sofa zurück.
Ich zündete mir eine Kippe an, kramte mein Schreibzeug hervor und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Bereit, die Sensation zu notieren. Dass Dreamlight das kommende große Ding des Musikfiebers seien.
Mark hielt die Stöcke in die Höhe. »Können wir weitermachen?«, fragte er in die Runde und zählte, ohne abzuwarten, die ersten vier Takte an.
Dieses Mal funktionierte es.
Da das Stück hauptsächlich auf Orgelharmonien basierte, übernahm Gero die Dirigentenrolle. Jetzt unterbrach er das Spiel, wenn er es für nötig hielt, korrigierte hier, veränderte dort, sprach Lob und immer weniger Tadel aus.
Skip war aus der Kiffergalaxie zurückgekehrt. Er konzentrierte sich, seine schlanken Finger flitzten plötzlich gekonnt über den Hals des Basses und fanden die richtigen Noten.
Paul übertraf sich selbst. Der Knoten hatte sich gelöst, fehlerfrei schlug er das Gitarrenriff auf seinem Brett an. Beim Solo, das noch ausbaufähig war (aber immerhin gelang ihm nun eines), hielt er sich sogar an die vorgegebenen sechzehn Takte.
Mark ließ kurze Wirbel und Paradiddles über die Toms rollen, die Einsätze kamen punktgenau auf die Eins, die Becken krachten im richtigen Moment, sein Kantenschlag war präzise und knackig.
Nach zwei weiteren Stunden und völliger Erschöpfung hatten sie eine Version von »Atom Heart Mother« drauf, die sich hören lassen konnte.
Als der letzte Ton verklungen war, platzte es aus mir heraus. »Wow, wenn ihr so weitermacht, spielt ihr alle an die Wand.«
*
Ich schob die Kreidler auf dem Heimweg und ging neben Mark her. Obwohl fast Mitternacht, war zu dieser fortgeschrittenen Stunde die Luft noch angenehm warm. Die Cordjacke hatte ich mir um die Hüfte gebunden. Auf der Straße keine Menschenseele, nicht ein einziges Auto war unterwegs. Die Spießer hatten sich in ihre Wohnungen zurückgezogen und taten, was Spießer so tun – ihre Kinder schlagen, Ehefrauen begatten und Drei mal Neun mit Wim Thoelke in der Glotze gucken. Der normale Kleinstadtwahnsinn.
»War das dein Ernst?«, fragte er.
»Was meinst du?«
»Na, dass wir alle an die Wand spielen werden?«
»Ihr müsst nur noch eure eigene musikalische Stimme finden«, sagte ich.
»Eigene musikalische Stimme ...«, wiederholte er versonnen.
Der Mond tauchte die Bäume und Sträucher in ein unwirkliches Zwielicht.
»Andi schreibt eigene Stücke«, sagte ich. In knappen Worten schilderte ich Karens und meinen Besuch bei ihm.
»Er hat also eine kleine Melodie?«, fragte Mark, als ich fertig war.
»Ja, aber als er sie uns vorspielen wollte, platzte Don herein«, antwortete ich.
»Wenn der eigene Songs hat, dann brauchen wir auch welche.«
Wie war das nun gemeint? Klar, wer ein Konzertpiano in seiner Bude stehen hatte und darauf komponieren konnte, der verstand was von seinem Fach. Plötzlich kapierte ich. Fra Mauro, Andis Band, war die große Konkurrenz auf Marks Weg, das Festival für sich zu entscheiden.
»Und wenn Karen dich erst mal am Schlagzeug sieht, wird es sie umhauen«, sagte ich.
Bei der Erwähnung ihres Namens ging ein Zucken durch sein Gesicht, kaum merklich, doch ich registrierte es genau.
Mark zeigte mir den Vogel. »Du spinnst.«
»Lad sie doch auf die nächste Probe ein«, schlug ich vor, »glaub mir, damit kannst du Eindruck schinden.«
»Irgendwie ist sie, na ja ... unnahbar.«
»Du bist doch sonst nicht so schüchtern«, sagte ich.
Marks Stimme überschlug sich fast: »Ist sie nicht mit Andi zusammen?«
Wir hatten die Hälfte des Parks hinter uns. Der Mond war verschwunden. Die Bäume hatten ihn verschluckt. Ich konnte Mark kaum noch erkennen, nahm sein Gesicht wie einen altertümlichen Scherenschnitt wahr.
Seit Andi über dem Rats eingezogen war, klebte Karen an seiner Seite. Andi war etwas älter als die anderen in der Korona, hatte den Führerschein, war belesen und konnte Adorno zitieren. Das schien ihr zu imponieren.
Warum war dieser Typ plötzlich so wichtig geworden? Wo kam er überhaupt her, und warum war er gerade in unserem Kaff hängengeblieben?
»Ich kenne seinen Onkel«, antwortete Kief etwas unwirsch, als ich ihn einmal über Andi ausquetschte. Ich ließ nicht locker, und schließlich begann er zu berichten. Andi stamme aus der Gegend von Köln. Sein Vater sei Musiklehrer am Gymnasium gewesen, von ihm habe er das musikalische Talent geerbt und ersten Unterricht erhalten. Mit siebzehn, achtzehn habe sich Andi politisiert und machte bei der trotzkistischen Gruppe Internationaler Marxisten mit. Dies führte über Jahre hinweg immer wieder zu Streitereien mit seinem Vater und dann zum Zerwürfnis mit der Familie. Einen kommunistischen Klavierspieler dulde er nicht, habe der Vater gesagt. Andi packt seine Klamotten und kam beim Onkel, der ein Kaff weiter von unserem wohnte, unter. Ein paar Wochen danach sei bei seinem Vater ein Krebsleiden diagnostiziert worden. Keine drei Monate später sei er gestorben.
»Dann hat mich Bernd angerufen« erzählte Kief. So hieß Andis Onkel. Und der habe ihn sein Leid geklagt. Der Junge habe nur das Konservatorium und seine Musik im Kopf. Er übe täglich bis zu sechs Stunden. Das ewige Klavierspielen halte er nicht mehr aus, er habe dem Jungen gesagt, er müsse sich was eigenes suchen, er habe ja jetzt Geld durch die Erbschaft, und ob er, Kief, nicht eine Unterkunft wüsste. Da das Apartment über dem Rats gerade frei geworden war, hätte sich so alles gefügt, meinte Kief.
Seit Andi aber in unserer Szene aufgetaucht war, fühlte ich mich in seiner Gegenwart, daran hatte auch der Besuch auf seiner Bude nichts geändert, ständig dazu aufgefordert, es ihm gleichzutun, mit Sartre und den Existenzialisten zu protzen. Insgeheim gefielen mir ja diese intellektuellen Reibereien. Wovon er lebte, das konnte ich mir noch immer nicht so richtig erklären, die Erbschaft konnte ja nicht ewig halten.
Egal, Andi wusste einfach verdammt viel über Musik. Ohne seine Plattensammlung, mit der er im Rats den Discjockey machte, wäre ich nicht auf Musiker wie Gato Barbieri und John Coltrane gestoßen. Er war der Korona Lichtjahre voraus. Verglichen mit ihm waren wir Anfänger.
»Die beiden sind Freunde, mehr ist da nicht. Aber wahrscheinlich bist du nur sauer, weil das hübscheste Mädchen der Stadt nicht mit dir, sondern mit dem Szeneguru abhängt«, sagte ich.
Er ging nicht darauf ein. »Weißt du eigentlich, wo die proben?«, fragte er.
Ich atmete schwer, nicht nur, weil die Kreidler zu schieben Kraft kostete, sondern auch wegen unseres Gesprächs.
Ich war ein bisschen gereizt. »Wer probt wo?«
»Na, all die anderen Bands?«
»Electric Junk, Storm und Pharos haben im Schulzentrum einen Raum gefunden. Inri und Alpha Centaurus proben unter der Tankstelle in der Hochstraße. Staffelbruch, Occulta, Oxygen Factory und Stiebel Eltron sind im katholischen Kindergarten untergekommen.«
»Im Kindergarten, wie soll denn das gehen?«
»Sie teilen sich alle einen Raum, ihre Verstärker und Boxen haben sie zu einer gemeinsamen Anlage zusammengestellt«, berichtete ich.
»Dann ist bei denen nicht mehr als einmal die Woche proben drin.«
»Kannst du mal sehen, wie gut du es getroffen hast. Dreamlight haben einen eigenen Proberaum, ganz für sich allein. Übrigens, Andi soll inzwischen einen Saxophonisten an Land gezogen haben. Der hat ein kleines Studio, und da proben Fra Mauro.«
Das schien Mark zu interessieren. »Weißt du, wer dieser Saxophonist ist?«
»Ich habe Kief gefragt, ob er ihn kennt. Er sagte, der sei wirklich gut, ein echter Jazzer mit Erfahrung, hätte sogar schon einige Platten gemacht.«
»Ein erfahrener Jazzer – dann ist der schon älter, oder wie?«
»Vielleicht Ende fünfzig. Je älter, desto besser, so ist das bei den Jazzern. Er heißt übrigens Reed Isberg«, antwortete ich.
»Ist das sein echter Name?«
»Für mich klingt das nach Pseudonym«, sagte ich.
Mark meckerte drauflos. »Andi ist ja richtig auf der Gewinnerstraße. Einen Top-Saxophonisten hat er aufgerissen, einen eigenen Song hat er, und Karen hat er auch. Ich kann den Typ nicht leiden.«
»Wenn du Karen näher kennenlernen willst, dann zeig ihr, wie du wirklich bist, und spiel nicht den Macker.«
Er hörte nicht zu. Über Karen zu reden war ihm zu viel.
»Was hältst du von Don, traust du ihm zu, dass er das hinkriegt mit dem Festival?«, fragte er.
»Er scheint es wirklich ernst zu meinen«, antwortete ich.
»Ich sag dir was. Scheiß auf Fra Mauro. Wir werden sie an die Wand spielen«, schnaubte er im Brustton der Überzeugung.
»Na endlich, so gefällst du mir.«
Wir hatten den Park verlassen und die Kirche nahe dem Bahnübergang erreicht. Mark wohnte in der Westallee; wenn ich ihn schon bis hierher begleitet hatte, konnte ich ihn auch an der Haustür abliefern.
Plötzlich schoss ein Wagen viel zu schnell in die leere Kreuzung. Das Auto steuerte direkt auf uns zu. Es war der mausgraue Käfer von Andi.
Im letzten Moment kam er vor Mark und mir zum Stehen.
Die Beifahrertür ging auf, und Karen schaute heraus. Hinterm Steuer saß Andi, der uns keines Blickes würdigte. Er starrte geradeaus.
»Habt ihr vergessen, heute steigt die Einweihungsparty im Müsli. Los, kommt schon, bevor wir das Beste verpassen«, rief Karen.
Sie stieg aus dem Wagen und klappte den Sitz zurück. Mark kletterte auf die Rückbank. Ich warf die Kreidler an und düste ihnen hinterher.