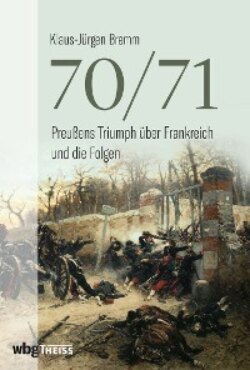Читать книгу 70/71 - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Preußisches Prävenire – Erzherzog Albrechts geheime Reise nach Paris und die spanische Thronkandidatur
Оглавление»Bismarck nahm die hohenzollernsche Kandidatur in die Hand, so wie wenn jemand mit brennendem Schwefelholz über einen Gashahn fährt, um zu sehen, ob derselbe auf oder zu ist.«
Friedrich von Holstein, Erinnerungen und Denkwürdigkeiten18
Am 4. Januar 1870 bestieg eine kleine Gruppe österreichischer Offiziere in Zivil unter Führung eines Grafen von Friedeck im Wiener Südbahnhof den Zug nach Verona, um zwischen Adda und Ticino die alten Kampfplätze der Kriege von 1848, 1859 und 1866 aufzusuchen. Die Herren nahmen sich dazu viel Zeit und überquerten erst vier Wochen später die französische Grenze bei Nizza, um zunächst ihr umfangreiches Besuchsprogramm in Frankreich fortzusetzen. Am 10. Februar erreichten die geheimnisvollen Reisenden schließlich die Hauptstadt Paris, wo sie nach dem Bezug eines komfortablen Quartiers von Kriegsminister Edmond Lebœuf persönlich durch dessen gesamtes Ministerium in der Rue St. Dominique geführt wurden. Auch das berüchtigte Deuxième Bureau, in dem der französische Nachrichtendienst seinen obskuren Geschäften nachging, sparte der Marschall dabei nicht aus.19 Spätestens der Empfang durch das französische Kaiserpaar am 18. Februar auf Schloss St. Cloud beendete das bis dahin sorgsam gehütete Inkognito der hohen Besucher. Der angebliche Graf von Friedeck war niemand anderes als der damals renommierteste Militär der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, Erzherzog Albrecht, der Onkel Kaiser Franz Josephs I. und Sieger von Custoza.
Den Franzosen erschien der Erzherzog in ihrer verfahrenen Lage wie ein Retter, und das Galadiner, das der Kriegsminister kurz darauf zu Ehren seiner österreichischen Gäste veranstaltete, verlief in sehr gehobener Stimmung. Unter dem Beifall der anwesenden Generale erklärte Lebœuf, dass er glücklich sei, nunmehr den Sieger von Custoza in einem zukünftigen Krieg an der Seite Frankreichs zu wissen.20 Auch wenn der Marschall in seiner Rede Preußen als Gegner gar nicht erwähnt hatte, läuteten in Berlin jetzt erstmals die Alarmglocken. Als sich schließlich Albrechts Aufenthalt in Paris Woche um Woche verlängerte und der Erzherzog Anfang März sogar den Flottenstützpunkt Cherbourg besuchte, erteilte ein inzwischen sehr beunruhigter Otto von Bismarck am 11. März seinem Pressebüro die Anweisung, zunächst in einem regierungsfernen Blatt über Albrechts Reise ausführlich berichten zu lassen und sie besonders den süddeutschen Höfen als bedenkliches Symptom einer französisch-österreichischen Annäherung darzustellen.21 Noch am selben Tag hatten die österreichischen Besucher über Reims und Frankfurt allerdings schon die Rückreise nach Wien angetreten, nicht ohne zuvor noch einem Schießen der französischen Artillerie auf dem Übungsplatz Chalons in der Champagne beizuwohnen. Dass Albrecht tatsächlich für die Franzosen nur wenig Sympathie aufbrachte und ihre militärischen Vorbereitungen nach seiner Reise eher kritisch bewertete,22 konnte der Kanzler des Norddeutschen Bundes vorerst nicht wissen.
Seit der Luxemburgkrise von 1867 hatten Wien und Paris unter Einbeziehung Italiens versucht, ein antipreußisches Bündnis zustande zu bringen. Beide Kaiser hatten sich noch im August desselben Jahres in Salzburg getroffen. Offiziell war Napoleon damals mit der delikaten Aufgabe angereist, Franz Joseph wegen des Todes seines Bruders, des Erzherzogs Ferdinand Maximilian, zu kondolieren. Insgeheim hatten sich beide Monarchen in Salzburg aber mit der Frage befasst, wie der scheinbar stetig wachsenden Macht des Hohenzollernstaates an der Mainlinie gemeinsam Einhalt geboten werden konnte.23 Vielleicht ließen sich sogar, so die von Napoleon genährten Hoffnungen Wiens, die Ergebnisse des verlorenen Krieges von 1866 durch einen erfolgreichen Waffengang noch revidieren. Bismarck hatten diese Bemühungen anfangs nicht übermäßig beunruhigt. Schienen doch die Interessen der beiden Mächte zu gegensätzlich, um jemals zu einer handlungsfähigen Allianz zu amalgamieren. Es war kein Geheimnis, dass das französische Zweite Kaiserreich nach seinem unrühmlichen Rückzug aus Mexiko unter wachsendem innenpolitischen Druck stand und seither mit wenig Geschick nach jedem noch so geringen außenpolitischen Vorteil zu greifen versuchte. Infrage kamen etwa territoriale Gewinne in Belgien oder im Rheinland, um die sich Kaiser Napoleon III. seit dem raschen Vorfrieden von Nikolsburg und dem diplomatischen Desaster um Luxemburg von Bismarck geprellt fühlte.
Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen in preußischer Marschall-Uniform, (Foto 1895).
Österreich wiederum, dessen Politik seit 1867 der Sachse Friedrich Ferdinand Graf von Beust leitete, konnte nicht ohne Gesichtsverlust seine Hand dazu reichen, Frankreich bei der Vereinnahmung deutschen Gebietes zu assistieren. Obwohl aus persönlichen Gründen ein erklärter Feind Bismarcks betrieb von Beust keinen revisionistischen Kurs um jeden Preis. Nur wenn es in Süddeutschland als Befreier wahrgenommen würde, so sein Kalkül, hatte Habsburg überhaupt eine Chance, in Deutschland wieder Fuß zu fassen. Auch die Wünsche Italiens als möglicher Dritter im Bunde schienen kaum mit den Interessen der beiden übrigen Mächte vereinbar. Seit Jahren stieß die Regierung in Florenz mit ihrer Forderung bei Napoleon auf taube Ohren, das französische Schutzkorps für Papst Pius IX. aus Rom abzuziehen, um endlich Italiens wahre Hauptstadt in Besitz nehmen zu können. Mochte der Kaiser auch mit dem Wunsch der Italiener insgeheim sympathisieren, so konnte er doch auf die Unterstützung der französischen Katholiken unmöglich verzichten, die ihm eine Preisgabe des Patrimonium Petri niemals verziehen hätten. Die kaum auflösbare Gemengelage, die noch von den Ansprüchen Italiens auf das österreichische Isonzotal und Triest verschärft wurde, hatte ein wirksames Zusammengehen der drei Mächte bisher verhindert und schien es auch in Zukunft zu tun.
Wenn aber nun der wohl einflussreichste Militär der Doppelmonarchie die Mühe auf sich nahm, auf großen Unwegen und in anfänglichem Inkognito nach Paris zu reisen, mussten die Sondierungen zwischen den beiden Kaiserreichen eine neue Qualität erreicht haben. Bismarck konnte kaum Zweifel daran hegen, dass in der französischen Hauptstadt bereits über konkrete militärische Operationen gegen Preußen verhandelt worden war.24
Selbst ohne diese Besorgnis erregenden Neuigkeiten hatte sich für den Kanzler des Norddeutschen Bundes der politische Horizont zu Beginn des Jahres 1870 erheblich verdunkelt. Bismarcks Pläne einer Einbeziehung der seit 1866 verwaisten süddeutschen Staaten in den neuen Norddeutschen Bund ließen sich kurzfristig kaum noch realisieren. Die Partikularisten südlich des Mains drohten inzwischen die Überhand zu gewinnen und selbst die alten Schutz- und Trutzbündnisse von 1866 schienen in Gefahr, nachdem Preußengegner in Württemberg in kürzester Frist mehr als 150.000 Unterschriften für die Einführung eines Milizsystems nach Schweizer Vorbild gesammelt hatten.25
Längst war die nationale Euphorie, die noch während der Luxemburgkrise von 1867 in München, Stuttgart und Karlsruhe dominiert hatte, einer antiborussischen Haltung gewichen. Die Wahlen zum neuen Zollparlament hatten Anfang 1868 in den drei süddeutschen Staaten unerwartet deutliche Gewinne für die Preußengegner gebracht.26 Im Februar 1870 war schließlich der bayerische Ministerpräsident, Chlodwig Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst, stets ein warmer Befürworter des Anschlusses an den Norddeutschen Bund, von seinem Amt zurückgetreten, da bei den Novemberwahlen die Patriotenpartei in der Zweiten Kammer mit 80 von 154 Sitzen die absolute Mehrheit errungen hatte.27 Hohenlohes Nachfolge trat am 8. März der bisherige Gesandte Bayerns am Wiener Hof, Otto Graf von Bray-Steinburg, an. Der neue Kabinettschef in München galt als warmer Befürworter einer großdeutschen revisionistischen Politik und war zudem ein enger Freund des Grafen von Beust. Die Gefahr eines verstärkten bayrisch-österreichischen Zusammengehens lag damit für Bismarck auf der Hand.
Der Kanzler hatte bisher keinen Grund gesehen, den Anschluss der Süddeutschen mit besonderer Eile zu betreiben. Die anschlusswillige Regierung in Karlsruhe hatte er sogar ermuntert, sich an den Beratungen über die Gründung eines unabhängigen Südbundes zu beteiligen.28 Anders als vielen Liberalen in ganz Deutschland war dem eingefleischten Preußen die nationale Einheit nie eine Herzensangelegenheit gewesen. Seit seinem Eintritt in die Politik hatte er mit allen Kräften die Vorherrschaft des Hohenzollernstaates in Norddeutschland angestrebt, und noch in seinen Vorschlägen zur Reform des Deutschen Bundes hatte er im Juni 1866 eine Eigenständigkeit der vereinigten süddeutschen Staaten befürwortet.29 Gelegentlich hatte Bismarck auch durchblicken lassen, dass die kleindeutsche Union unter Führung Preußens wohl erst der folgenden Generation vorbehalten sein würde, und sprach sogar warnend vom Abschlagen »unreifer Früchte«.30 Ohnehin erwies sich die Konsolidierung der preußischen Macht nördlich des Mains als schwierig genug und das bei jeder Gelegenheit von den Partikularisten in Württemberg und Bayern zelebrierte Antipreußentum verschaffte Bismarck eine beunruhigende Ahnung von den zukünftigen Schwierigkeiten, die sich aus dem Beitritt dieser beiden Staaten zum Norddeutschen Bund ergeben mussten. Als politischen Gewinn vermochte Bismarck jedenfalls die Zugehörigkeit Bayerns und Württembergs nicht zu verbuchen. Mit ihrem selbstgerechten Querulantentum, hinter dem sich oft nur platte Antimodernitätsreflexe oder spießige Anhänglichkeit an einen politischen Katholizismus verbargen, hatten sie ihm schon manche schlaflose Nacht bereitet. Die Geschlagenen des Krieges von 1866 allerdings auf Dauer außerhalb des Norddeutschen Bundes zu belassen, würde nur noch mehr Schaden anrichten. Nicht einmal fähig, sich zu einer kleinen süddeutschen Union zusammenzuschließen, drohten Bayern, Württemberg und auch das der Einheit mit Norddeutschland durchaus zuneigende Baden zur buchstäblich losen Kanone auf dem Deck des europäischen Staatensystems zu werden.
Bismarck hatte sich glaubhaft und wiederholt geäußert, dass er niemals einen Krieg führen würde, um den Anschluss der Süddeutschen zu erzwingen. Jetzt aber sah er sich durch die aktuelle Wendung der Dinge in die Enge gedrängt. Im Falle einer sich nunmehr ganz offenbar konkretisierenden antipreußischen Allianz zwischen Paris und Wien war durchaus nicht mehr auszuschließen, dass Süddeutschland zum Aufmarschgebiet der vereinigten feindlichen Armeen werden würde. Bayern und Württemberger könnten sich vielleicht sogar unter dem Druck der Partikularisten einer Offensive der Franzosen und Österreicher über den Main anschließen.31 Sämtliche Gewinne des siegreichen Jahres 1866 schienen auf dem Spiel zu stehen, wenn Bismarck die Dinge weiter treiben ließ. Allein dafür war der Kanzler bereit Krieg zu führen. Er konnte auch darauf setzen, dass das Heer des Norddeutschen Bundes diesen Konflikt siegreich bestehen würde. Noch im Juli des Vorjahres hatte ihm Generalstabschef Helmuth von Moltke anlässlich eines Frühstückes auf dessen schlesischem Gut Kreisau erneut versichert, dass man besser jetzt als später losschlagen solle.32
Unerwartete Hilfe kam in diesen von politischen Rückschlägen geprägten Wochen von der Madrider Militärjunta. Seit der Vertreibung der Königin Isabella II. aus dem Hause Bourbon im September 1868 suchten die neuen Machthaber um Marschall Juan Prim in ganz Europa nach einem geeigneten Thronkandidaten und konkretisierten nun ihr Angebot an den Hohenzollernprinzen Leopold aus der württembergischen Nebenlinie. Die Annahme lag nahe, dass die spanische Initiative von Bismarck selbst arrangiert worden sei. Dagegen sprach allerdings, dass der von den Spaniern bisher umworbene Herzog von Genua tatsächlich erst am 1. Februar 1870 seine Thronbewerbung endgültig zurückgezogen hatte. Das neuerlich geäußerte Interesse Madrids an einer Kandidatur des Hohenzollernprinzen könnte also durchaus ein passender Zufall gewesen. Am 26. Februar 1870 überreichte im Auftrag von Prim ein spanischer Sondergesandter in Berlin drei ausführliche Werbebriefe an Bismarck selbst, an König Wilhelm wie auch an den Fürsten Karl Anton, den Chef der Nebenlinie Hohenzollern-Sigmaringen und Vater des umworbenen Thronkandidaten. Der 34-jährige Hohenzollernprinz Leopold war mit der Tochter des portugiesischen Königs Luis I. verheiratet und überdies katholischer Konfession. Durch seine Regentschaft könnte vielleicht auch der alte spanische Traum einer iberischen Gesamtmonarchie in Erfüllung gehen. Paris sah dies jedoch vollkommen anders und fürchtete sogar eine Einkreisung Frankreichs wie zu Zeiten Karls V. Ein Hohenzollernprinz auf dem Madrider Thron war für Napoleon unter keinen Umständen akzeptabel, selbst wenn er nur aus einer preußischen Nebenlinie kam. Bereits im Mai 1869 hatte die französische Regierung durch ihren langjährigen Botschafter in Berlin, Vincent Graf von Benedetti, Bismarcks Außenstaatssekretär Karl Hermann von Thile unmissverständlich wissen lassen, dass sie sich mit allen Mitteln gegen eine Thronfolge des Sigmaringers wehren würde.33 Wenn nun Bismarck angesichts der bevorstehenden Eröffnung französisch-österreichischer Militärkonsultationen die spanische Karte noch einmal und jetzt mit aller Entschiedenheit aufgriff, schien es ihm vor allem darum zu tun, die Franzosen in Zugzwang zu versetzen und damit weitere Verhandlungen zwischen Paris und Wien zu torpedieren. Tatsächlich war in Paris im Anschluss an Albrechts Besuch beschlossen worden, General Barthélémy Lebrun unter Wahrung strengster Geheimhaltung zu weiteren militärischen Absprachen nach Wien zu schicken. Auch wenn Bismarck die Details dieser Mission nicht kannte, war ihm doch klar, dass er den sich offenbar vertiefenden Verhandlungen zwischen Wien und Paris keine Zeit zum Reifen lassen durfte. Insgeheim hoffte der Kanzler auf eine überzogene Aktion der Franzosen, vielleicht sogar eine überstürzte Kriegserklärung. Wenn schon eine militärische Konfrontation mit Paris unvermeidlich war, wollte er sie lieber sofort und mit Frankreich allein führen. Den sächsischen Staatsminister Richard Freiherr von Friesen stimmte er als engsten Verbündeten Anfang März 1870, anlässlich eines Besuches des Sachsen in Berlin, schon einmal auf einen baldigen Krieg gegen das Kaiserreich als »unabweisbare Notwendigkeit« ein.34
Bismarck begab sich freilich mit der Forcierung der spanischen Frage auf sehr dünnes Eis. Gelang es tatsächlich, den lebenslustigen Prinz Leopold zur Annahme der Thronkandidatur zu bewegen und sie bis zur Bestätigung durch die spanischen Cortes geheim zu halten, wäre Frankreich mit einem fait accompli konfrontiert, das ihm nach den herrschenden Ehrbegriffen nur den Ausweg der sofortigen Kriegserklärung an Preußen ließe.35 Paris stände damit allerdings gegenüber der deutschen und europäischen Öffentlichkeit als alleiniger Aggressor da, da die preußische Regierung offiziell gar nicht im Spiel war. Ganz anders lagen die Dinge bei dem zugleich zur Debatte stehenden sofortigen Beitritt Badens zum Norddeutschen Bund. In demonstrativer Schärfe hatte sich Bismarck noch am 24. Februar 1870 im Norddeutschen Bundestag gegen einen Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Eduard Lasker gewandt, der einem möglichst ungesäumten Beitritt des Großherzogtums den Weg ebnen sollte, und hatte dabei vor allem vor den vermeintlich ungünstigen Folgen für die Patrioten in Württemberg und Bayern gewarnt.36 Auch hätte dieser einseitige Schritt wohl Frankreich zu den Waffen gerufen. Daran hatte Émile Ollivier, der neue Mann in Paris, wenig Zweifel gelassen. Seit Januar 1870 war er der leitende Minister eines zunehmend bedrängten Kaisertums, das sich durch einige Konzessionen an das Corps législatif den Anstrich der Liberalität zu geben versuchte.37 Im Fall eines Beitritts Badens wäre Frankreich tatsächlich in der stärkeren Position einer europäischen Ordnungsmacht und einer Verteidigerin der Prager Friedensbedingungen von 1866 gewesen, die den Anschluss der Süddeutschen ausdrücklich ausgeschlossen hatten.38 Ein militärisches Zusammengehen Bayerns mit Frankreich und Österreich wäre dann keineswegs mehr auszuschließen. Kam es stattdessen aber allein über die Frage der spanischen Thronfolge zu einem Krieg mit Preußen, würde Paris in seinem anachronistischen Zorn über einen Hohenzollern auf dem Madrider Thron politisch völlig isoliert sein, zumal Napoleon selbst seit anderthalb Jahren sämtliche Versuche Prims, einen konstitutionellen Kandidaten zu finden, mit Erfolg hintertrieben hatte.
Kam die Bewerbung Leopolds aber vor der Abstimmung der Cortes heraus, würde, und daran konnte Bismarck nicht den geringsten Zweifel hegen, sein überängstlicher Monarch unter französischem Druck die schwäbische Verwandtschaft sofort zu einem Rückzieher drängen. Preußen liefe damit Gefahr, eine schwere diplomatische Niederlage, ja vielleicht sogar ein zweites Olmütz zu erleiden, und selbst der Einwand, dass es sich bei der Thronkandidatur lediglich um eine dynastische Frage gehandelt habe, würde im Triumphgeschrei der Pariser Zeitungen völlig untergehen. Sämtliche Klagen über den maßlosen Expansionsdrang des Hohenzollernstaates hätten mit einem Mal ihre Bestätigung gefunden und Bismarcks Rücktritt wäre dann ebenso unvermeidlich gewesen wie die schimpfliche Aufgabe der spanischen Kandidatur.
Von seinem halsbrecherischen »Alles oder Nichts« fand sich jedoch kein Wort in dem langen Memorandum, mit dem der Kanzler am 9. März 1870 seinem von Anfang an skeptischen Monarchen die Thronbesteigung Leopolds schmackhaft zu machen versuchte.39 Bismarck warnte darin vor einem Ersatzkandidaten aus Bayern, beschwor sogar die Gefahr einer spanischen Republik für die übrigen Throne Europas und behauptete schließlich, dass ein Hohenzoller in Madrid die Franzosen gewiss vorsichtiger stimmen würde, was den Frieden in Europa bewahren half. Dass auch ein Herrscher aus dem Hause Hohenzollern nur noch wenig Einfluss auf den Kurs der spanischen Politik haben würde, nachdem Marschall Prim mit seinen Reformen längst den Weg zu einer konstitutionellen Monarchie eingeschlagen hatte, erwähnte Bismarck nicht.
Es erstaunt, dass der Kanzler bei aller in den Vorgang investierten Mühe nur wenig Aufwand betrieb, die tödlichen Risiken eines vorzeitigen Bekanntwerdens der Kandidatur zu minimieren. Zum Kreis der Eingeweihten gehörten außer dem Monarchen immerhin auch Kronprinz Friedrich Wilhelm. Dessen politisch unbedarfte britische Ehefrau hatte tatsächlich nichts Eiligeres zu tun, als schon am 12. März, noch vor der Zusammenkunft im Familienkreis, ihre königliche Mutter in London in der Angelegenheit zu kontaktieren und deren Rat einzuholen. Dieses Mal hatte Bismarck freilich noch außergewöhnliches Glück, da Außenminister Lord Clarendon der Queen empfahl, sich zu der höchst delikaten Frage auf keinen Fall zu äußern.40
Die am 15. März im großen Kreis im Berliner Stadtschloss tagende Konferenz, zu der Bismarck außer Kanzleramtschef Rudolf Delbrück auch die Generale Helmuth von Moltke und Albrecht von Roon sowie seinen Außenstaatssekretär von Thile hinzugezogen hatte, endete zwar mit einer Mehrheit für die spanische Kandidatur, doch seinen Monarchen hatte der Kanzler auch jetzt nicht überzeugen können.41 Wilhelm blieb bei seiner klaren Ablehnung. Der 73-jährige König wird sich mit seinem nüchternen Sinn gefragt haben, weshalb sein leitender Minister einen derart großen Aufwand betrieb, um einen mittelmäßigen und sein privilegiertes Dasein ungeniert genießenden Hohenzollernprinzen auf einen längst bedeutungslosen Thron am Rande Europas zu bringen.42 Der Monarch dürfte gespürt haben, dass er wieder einmal die Rolle des Bauern in Bismarcks undurchschaubaren Schachzügen abgeben sollte. Gleichwohl war er schließlich bereit, als Chef des Hauses Hohenzollern keine Einwände zu erheben, falls Leopold aus freien Stücken das spanische Angebot annehmen wolle.
Damit schien nun allerdings das Projekt so gut wie gestorben, denn der Hohenzollernprinz war alles andere als eine entschlussfreudige Persönlichkeit und fand, im Gegensatz zu seinem ehrgeizigen Vater Karl Anton, nur wenig Reiz an der durchaus nicht gefahrlosen Aufgabe. Der Thron in Madrid galt als Schleudersitz, die spanischen Staatsfinanzen standen vor dem Zusammenbruch, Prims antiklerikale Gesetzgebung würde gewiss dem neuen König angelastet werden und der drohende Verlust Kubas wäre ein denkbar schlechter Auftakt seiner Regentschaft. Die Erschießung des glücklosen Kaisers Maximilian in Mexiko musste zudem für jeden europäischen Aristokraten, der sich auf einen fernen, exotischen Thron bewarb, ein Menetekel sein. Trotz allem war Leopold, der immerhin als preußischer Offizier im Krieg von 1866 gekämpft hatte, bereit, sich der ungeliebten Aufgabe zu stellen, wenn sie tatsächlich dem Haus Hohenzollern diente und der König ihm die Annahme der Kandidatur ausdrücklich befahl. Das aber war für Wilhelm die rote Linie.
Spätestens jetzt hätte Bismarck bei nüchternder Bewertung aller Risiken das Projekt abbrechen müssen. Das erhoffte fait accompli in Madrid war kaum noch zu erreichen, wenn Kandidat und König, die entscheidenden Figuren in seinem Spiel, gar nicht mitspielen wollten. Doch Bismarck wäre nicht Bismarck gewesen, wenn er jetzt schon klein beigegeben hätte. Mit »unendlicher Zähigkeit« hielt er an seinem abenteuerlichen Plan fest.43 Noch ehe der Absagebrief von Leopold und Karl Anton am 20. April nach Madrid abging, hatte der Kanzler bereits seinen Vertrauten Lothar Bucher nach Spanien geschickt. Der ehemalige Revolutionär von 1848, vor den Preußen nach England geflohen und von König Wilhelm anlässlich seines Regierungsantritts 13 Jahre später amnestiert, sollte in Madrid beruhigende politische Zusagen einholen und Premierminister Prim zur Aufrechterhaltung seines Angebotes bewegen.44 Leopolds schriftliche Ablehnung, der Anfang Mai noch eine zweite folgte, solle der Spanier einfach ignorieren, so Bucher, der längst für Bismarck in vieler Hinsicht zu einer unverzichtbaren Stütze geworden war. In Berlin werde man alles tun, um die Frage offenzuhalten, versicherte er dem bereits ungeduldig gewordenen Spanier.
Der Kanzler selbst hatte sich am 14. April, wieder einmal eine Krankheit vortäuschend, für einige Wochen auf sein erst kürzlich erworbenes Gut im hinterpommerschen Varzin, etwa eine Tagesreise von Berlin, begeben. Damit hoffte er seiner Nichtbeteiligung an der ganzen Affäre halbwegs Glaubwürdigkeit verschaffen zu können, falls dies einmal nötig sein würde. Als der unermüdliche Bucher Anfang Mai mit den erhofften Zusicherungen aus Madrid zurückkehrte und auch der zeitgleich auf Empfehlung Moltkes nach Spanien entsandte Major Maximilian von Versen mit ermutigenden Einschätzungen zur Loyalität der spanischen Armee aufwarten konnte, sah Bismarck den Zeitpunkt für einen neuerlichen Überzeugungsversuch gekommen. Dabei wusste der Kanzler Karl Anton inzwischen auf seiner Seite. Der Chef des Sigmaringer Hohenzollernzweigs bedauerte längst seine Absage an Madrid und sprach in einem Brief an seinen dritten Sohn Karl, dem späteren König von Rumänien, von einem großen historischen Moment, der für das Haus Hohenzollern wohl niemals mehr wiederkehren würde.45 Zeitweilig hatte Karl Anton einer Kandidatur seines jüngsten Sohnes Friedrich den Vorzug gegeben, setzte nun aber wieder auf Leopold, der sich von den beiden zu ihm entsandten Bucher und Versen allmählich auf Bismarcks Linie bringen ließ.46 Zuletzt gelang es dem Kanzler sogar, den über das neuerliche Anrühren der Affäre erbosten König Wilhelm zu beruhigen, indem er auf die jetzt tatsächlich vorhandene Bereitschaft Leopolds zur Kandidatur verwies. Anfang Juni schien die Sache endlich in trockenen Tüchern. Wie wenig Bismarck auf sein scheinbar stärkstes Argument gab, ein Hohenzoller auf dem Madrider Thron könne zur Beruhigung der französischen Politik beitragen, zeigte sein Kommentar zur Ernennung des als hitzköpfig bekannten Herzogs von Gramont zum Außenminister Frankreichs. »Krieg« schrieb er Mitte Mai 1870 auf die Ränder gleich dreier Berichte über die Politik des neuen Chefs am Pariser Quai d’Orsay.47 Unglücklich schien er über den Wechsel nicht gewesen zu sein. Eiskalt ließ er nun die politische Lunte abbrennen. Doch die Flamme zischte nur quälend langsam an das Pariser Pulverfass heran. Einmal mehr verstrich wertvolle Zeit. Der junge Leopold wollte zunächst, man glaubt es kaum, seine Kur in den Reichenhaller Bergen beenden. Als er schließlich Wilhelm schriftlich um seine Einwilligung ersuchte, erteilte sie ihm der König mit erkennbarem Unwillen und etlichen Ermahnungen am 21. Juni. Noch am selben Tag ging das Telegramm mit der ersehnten Nachricht von Berlin nach Madrid. Demnach sollte die entscheidende Abstimmung der Cortes schon am 26. Juni stattfinden. Was nun geschah, ist bis heute in seinen Ursachen obskur geblieben. Eine falsche Dechiffrierung in der preußischen Gesandtschaft in Madrid machte aus dem 26. Juni den 9. Juli. Wer auch immer für den – vielleicht bewusst begangenen – Fehler verantwortlich war, niemand in der spanischen Regierung hinterfragte das ungewöhnlich späte Datum, das die ohnehin erregten und missmutig gewordenen Abgeordneten für weitere zwei Wochen in der glühenden Hitze der Hauptstadt festhalten würde. Konnte denn Leopold nicht sofort nach Spanien reisen? Sonderbarerweise schien selbst Premier Prim, bisher stets die treibende Kraft bei der Suche nach einem Thronnachfolger, plötzlich alle Zeit der Welt zu haben und vertagte die nächste Versammlung der Cortes gleich auf den 1. November. Als der Marschall, endlich über den tatsächlichen Sachverhalt orientiert, sich Anfang Juli entschloss, die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückzurufen, beging er den entscheidenden Fehler, zugleich auch den Anlass für seine außergewöhnliche Maßnahme bekannt zu geben. Damit war die spanische Bombe vorzeitig geplatzt und Bismarcks gewagtes Spiel schien auf der Zielgeraden gescheitert.
Über Paris lag in diesen Tagen immer noch der Rauch einer heftigen parlamentarischen Debatte über die Reduzierung des jährlichen Einberufungskontingentes. Zu keiner Zeit sei die Ruhe in Europa mehr gesichert gewesen als eben jetzt, hatte Ministerpräsident Ollivier am 30. Juni seinen umstrittenen Vorschlag einer Reduzierung des Kontingents um 10.000 Wehrpflichtige zu verteidigen versucht und resümiert: Wohin man auch blicken mag, nirgends sei eine Frage zu entdecken, die Gefahr in sich bergen könnte.48 Nun war die Frage doch gestellt. Nach Bekanntwerden der Hohenzollern-Kandidatur herrschte in der französischen Hauptstadt zunächst Schockstarre. Dann aber brach es wie ein Chor los. In seltener Einmütigkeit empörten sich die hauptstädtischen Zeitungen über die neuerliche preußische Intrige und sprachen sogleich von der verletzten Ehre Frankreichs. »Krieg oder Resignation« titelte Le Temps und Charles Delescluze vom Le Réveil bilanzierte süffisant: Die Preußen, die schon hinter dem Rhein und hinter den Alpen säßen, ständen nun auch hinter den Pyrenäen. Falls dies die Revanche für Sadowa (Königgrätz) sei, so wäre sie nun vollständig.49 Delescluze sollte am 25. Mai 1871 als einer der Führer der Pariser Kommune auf einer Barrikade am Place du Château d’Eau mit einer roten Schärpe um seine Taille den Tod finden.50
Für das neue Kabinett unter Émile Ollivier konnte es nicht besser laufen. Erst Anfang Mai hatte ein landesweites Plebiszit das sogenannte Liberale Kaisertum mit einer stattlichen Mehrheit von siebeneinhalb Mio. Stimmen bestätigt und damit Napoleons Regime noch einmal stabilisiert. Politisch gestärkt und vom öffentlichen Geschrei souffliert erhob die Regierung nun mit Nachdruck ihre Forderung nach Rücknahme der Thronkandidatur, und dies konnte nach ihrer Überzeugung tatsächlich allein durch die preußische Regierung selbst geschehen. Kaum jemand in Paris glaubte an den ausschließlich dynastischen Charakter der Angelegenheit und kaum jemand hätte es selbst dann geglaubt, wenn es der Wahrheit entsprochen hätte. Ollivier und Gramont wussten, dass eine derart brillante Gelegenheit, Berlin an den Pranger zu stellen, so rasch nicht wiederkehren würde, und griffen beherzt zu. Am 6. Juli beschloss das Pariser Kabinett, den Gegenschlag zu führen, und niemand schien geeigneter, noch am Nachmittag desselben Tages die anklagende Brandrede in der Gesetzgebenden Versammlung zu halten, als Antoine Alfred Agénor, Herzog von Gramont. Frankreichs neuer Außenminister hatte lange Jahre als Botschafter in Turin und Wien gedient und stand seither mit Minister Beust auf bestem Fuß. Anlässlich seiner Verabschiedung aus Wien hatte ihm der Sachse den bereits unterschriftsreifen Vertragstext zu einer gegen Preußen gerichteten Dreierallianz zwischen Frankreich, Österreich und Italien gezeigt, einschließlich dreier Schreiben, mit denen die beteiligten Monarchen unmissverständlich ihre Absicht zum Vertragsabschluss bekräftigt hatten.51 Nicht zuletzt deshalb auf die militärische Unterstützung wenigstens Österreichs vertrauend, ließ Gramont jede Mäßigung gegenüber Berlin fallen. Ohne einen konkreten Beweis zu haben, bezichtigte der Außenminister in seiner aufpeitschenden Rede die preußische Regierung die treibende Kraft hinter der Kandidatur des Hohenzollernprinzen zu sein. Damit aber habe sie das Gleichgewicht in Europa gefährdet und die Ehre Frankreichs verletzt. Er hoffe jedoch, so Gramont, auf die Klugheit des deutschen Volkes und die Freundschaft der Spanier, um die akute Gefahr abzuwenden. Der Franzose vermied zwar, vom Krieg zu sprechen, aber die Mehrheit der ihm begeistert applaudierenden Abgeordneten konnte keinen Zweifel haben, dass genau dies gemeint war, als Gramont zuletzt ihren Beistand und den der ganzen Nation einforderte, »um ohne zu Zögern und ohne Schwäche unsere Pflicht zu tun.«52
Nun hätte Frankreichs Regierung den starken Worten des Herzogs kaum Taten folgen lassen können, wenn auf preußischer Seite die Reihen geschlossen geblieben wären. Doch das schwächste Glied in Bismarcks Kette schien wieder einmal der Monarch, der sich in den ersten Julitagen weitab von Bismarcks Einfluss im rheinischen Bad Ems aufhielt. Mit sicherem Instinkt hatte Gramont König Wilhelm als Angriffsziel ausgewählt und dazu auch noch unerwartete Hilfe durch den neuen preußischen Botschafter in Paris, Karl Freiherr von Werther, erhalten. Der ehrwürdige alte Herr war von Bismarck, ein kaum glaubliches Versäumnis, nicht über die Kandidatur instruiert worden und hatte sich am 4. Juli nach einem Gespräch mit Gramont über die spanische Thronaffäre, auf das er sich nie hätte einlassen dürfen, bereit erklärt, nach Bad Ems zu reisen, um dem König die Beschwerden der französischen Regierung persönlich vorzutragen. Hatte Wilhelm zunächst noch an der Kandidatur Leopolds festgehalten, so schien er kalte Füße zu bekommen, als ihm der soeben eingetroffene Botschafter Werther über die fanatische Stimmung in Paris berichtete und ausdrücklich vor einem Krieg warnte. Gramonts Brandrede vom 6. Juli gab dem König den Rest. Als auch Botschafter Graf von Benedetti am 9. Juli, von seinem Außenminister aus seiner Wildbader Sommerfrische geholt, in Bad Ems eintraf, gestand ihm der biedere Monarch in einer noch am selben Tag gewährten Audienz, dass er die Kandidatur nicht nur gebilligt habe, sondern dass auch Bismarck über alle Vorgänge informiert sei. Als Wilhelm zudem noch durchblicken ließ, dass er bereits bei den Sigmaringer Verwandten angefragt habe, ob man die Kandidatur tatsächlich aufrechterhalten wolle, war Preußens diplomatisches Desaster perfekt. Gramont hatte den gewünschten Beweis, dass die preußische Regierung hinter der spanischen Affäre stand.53 Bismarck, der am 12. Juli viel zu spät aus seinem Varziner Exil nach Berlin zurückgekehrt war, fand auf seinem Schreibtisch bereits die Nachricht, dass Karl Anton die Kandidatur seines Sohnes zurückgezogen habe.54 Zornig und verzweifelt bemühte sich der Kanzler um Begrenzung des Schadens, den der König durch seine Offenherzigkeit angerichtet hatte. In seinen Memoiren sprach er davon, sogar an Rücktritt gedacht zu haben. Dies war vielleicht eine rückblickende Übertreibung, aber die ganze von ihm initiierte Angelegenheit schien ihm jetzt tatsächlich entglitten zu sein. In Paris triumphierte vorerst Gramont. Der Außenminister hatte die Preußen zum Zurückweichen gezwungen und sogar Bismarck als Drahtzieher der antifranzösischen Intrige gedemütigt. Selbst die dem Zweiten Kaiserreich wenig gewogene Londoner Times sprach in ihrer Ausgabe vom 8. Juli von einem unklugen und plumpen Vorgehen Preußens, das allen diplomatischen Gepflogenheit völlig zuwiderlaufe.55
Mit der Öffentlichkeit beinahe des gesamten Landes hinter sich glaubte Gramont nach einer mehrstündigen Unterredung mit Napoleon III. am Nachmittag des 12. Juli, seinen diplomatischen Erfolg sogar noch ausweiten zu können. Sein Optimismus schien nicht unberechtigt. Man müsse nur resolut genug auftreten, um Preußen endgültig zu Boden zu bringen. Schließlich hatte Berlin bisher auf seine Angriffe wie ein verschreckter Hühnerhaufen reagiert und Wilhelms ungeschicktes Agieren ließ hoffen, dass er seinen bisherigen Fehlern weitere hinzufügen würde. Frankreich brauche, so Gramont, nach der noch rechtzeitig aufgedeckten preußischen Verschwörung nunmehr die sichere Gewähr, dass es niemals wieder zu einer Kandidatur eines Hohenzollernprinzen in Spanien kommen würde. Der um den Frieden besorgte Wilhelm, der schon so viel Entgegenkommen gezeigt hatte, sollte daher durch Botschafter von Benedetti aufgefordert werden, auch dies noch ausdrücklich zu garantieren. Außerdem müsste der Monarch in einem persönlichen und zur Veröffentlichung bestimmten Brief an Napoleon erklären, dass er mit seiner Zustimmung zur Kandidatur Leopolds nie die Absicht verfolgt habe, Frankreich zu beleidigen oder das aufrichtige Wohlwollen des Kaisers zu beeinträchtigen.56 Die entsprechenden Instruktionen gingen ohne das Wissen des leitenden französischen Ministers Émile Ollivier nach Bad Ems. Der hatte einen Wutausbruch, als er am nächsten Morgen von Gramont ins Bild gesetzt wurde. Hatte sein Außenminister den Verstand verloren? Kein gekröntes Haupt in Europa konnte einer derart demütigenden Forderung zustimmen, ohne seinen Thron zu riskieren. Derweil musste in Bad Ems Benedetti mit einem flauen Gefühl an den bisher so treuherzig agierenden Wilhelm herantreten, mit dem er noch am Vorabend in bester Stimmung diniert hatte, um ihm die neuesten Forderungen aus Paris zu präsentieren. Im Kurgarten an der Lahn vom Erscheinen des Franzosen überrascht, lehnte der König, über die neuerliche Belästigung sichtlich irritiert, die ihm vorgetragenen Ansprüche nach kurzer Anhörung ab, grüßte knapp und beschied dabei dem Botschafter Frankreichs, dass er ihm sonst weiter nichts mitzuteilen habe.57 Als der bald wieder versöhnlich gestimmte König die Morgenzeitung mit der Meldung vom Thronverzicht der Sigmaringer mit dem Ausdruck seiner vollsten Billigung sofort zu Benedetti bringen ließ, glaubte er die leidige Affäre nunmehr endgültig erledigt. Eine Verzichtserklärung à tout jamais, könne er jedoch, wie er seiner Frau noch am selben Tag schrieb, niemals geben. Nun war der Thronverzicht der Sigmaringer zwar offiziell, aber in Paris konnte Gramont mit dem vorhersehbaren Ergebnis der Begegnung nicht zufrieden sein. Er erteilte daher dem unglückseligen Benedetti den energischen Befehl, nochmals bei Wilhelm vorstellig zu werden. Der König, inzwischen wieder ganz auf Bismarcks Linie, verweigerte nunmehr jede weitere Zusammenkunft und erteilte am Nachmittag dem Vortragenden Rat im Außenministerium, Heinrich Abeken, den Auftrag, eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages zu verfassen und sie mit der Genehmigung zur Veröffentlichung nach Berlin weiterzuleiten. Auch die preußischen Botschafter im Ausland könne der Kanzler über die französischen Forderungen informieren, falls ihm dies notwendig erschien. Der Kanzler hatte nach dem Stimmungstief des Vortages im Verlauf des 13. Juli aus vielen Richtungen ermutigende Nachrichten erhalten. Die Stimmung in den süddeutschen Staaten war inzwischen eindeutig gegen Frankreich gerichtet. Aus München hatte ihm Graf von Bray-Steinburg versichert, dass sich Bayern an einem Krieg gegen Frankreich beteiligen werde, und aus Stuttgart kam die Meldung, der leitende Minister, Friedrich Freiherr von Varnbüler, habe erklärt, dass die letzten Gramont’schen Forderungen trotz Wilhelms Konzilianz das nationale Gefühl in Württemberg tief verletzt hätten.58 Auch Großbritannien und Russland fanden, dass der preußische König richtig gehandelt habe, und äußerten Verständnis für seine Festigkeit gegenüber allen weitergehenden französischen Forderungen. Das diplomatische Desaster schien abgewendet. Überraschenderweise war es doch zum Vorteil umgeschlagen, dass Bismarck seinen Monarchen in Bad Ems allein den Franzosen überlassen hatte, denn niemand hätte als Opfer französischer Impertinenz besser getaugt als der biedere Wilhelm. An der aufrichtigen Friedfertigkeit des Königs konnten selbst die Preußenhasser in den süddeutschen Staaten kaum Zweifel hegen. Nun konnte jeder sehen, dass die Franzosen mit Benedettis Auftritt in Bad Ems eine rote Linie überschritten hatten. Das Blatt hatte sich erneut gewendet. Wilhelms konziliante Festigkeit hatte Preußen überall in den süddeutschen Staaten unerwartete Sympathien eingebracht. Bismarck hätte nun ohne Gesichtsverlust die Sache auf sich beruhen lassen können, doch um Frieden war es ihm in der spanischen Affäre nie gegangen. Jetzt sah er den Augenblick zum entscheidenden Gegenschlag gekommen. Der ihm aus Bad Ems telegrafisch zugegangene Text wies bereits etliche Schärfen auf. Abeken hatte darin den Unmut des Königs über das wiederholte Vorsprechen des französischen Gesandten nicht verschwiegen und sogar von einer brüsken Zurückweisung Benedettis gesprochen. Seine Schilderung des vormittäglichen Hin und Her gipfelte in der Feststellung, dass Wilhelm nunmehr in dieser Sache nichts mehr mitzuteilen habe. Der Kanzler machte daraus in seiner gekürzten Version ein Absolutum. Nun hieß es plötzlich, der König habe Frankreich grundsätzlich nichts mehr zu sagen, was einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen ziemlich nahekam. Bismarcks Version der Emser Depesche erschien erst am nächsten Abend in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, einem Regierungsblatt, und schlug am 14. Juli in dem von stundenlangen Debatten aufgeheizten Paris wie eine Bombe ein. Viele Abgeordnete der Gesetzgebenden Kammer, darunter auch Adolphe Thiers, der ehemalige Ministerpräsident während der Rheinkrise von 1840, hatten bis dahin die von Kriegsminister Lebœuf bereits am Morgen eigenmächtig befohlene Teilmobilisierung entschieden abgelehnt. Der Marschall konnte jedoch dagegenhalten, dass unter den Bedingungen des modernen Krieges mit jedem verlorenen Tag Frankreich die Möglichkeit entglitte, eine Offensive über den Rhein zu führen, um den Österreichern in Süddeutschland die Hand zu reichen. Noch schien jedoch alles offen, als die Gruppe der Kriegsgegner im Parlament zuletzt sogar die Möglichkeit einer europäischen Konferenz ins Spiel brachten.
Das Bekanntwerden der Emser Depesche in ihrer verschärften Fassung machte am Abend ihre Position mit einem Schlag unhaltbar. Der nach Paris gereiste Benedetti bemühte sich zwar redlich, Ollivier und Gramont zu überzeugen, dass von einer Beleidigung durch König Wilhelm tatsächlich keine Rede sein konnte. Man ließ ihn aber gar nicht mehr zum Ministerrat vor.59 Nationale Demütigung oder Krieg lautete jetzt die Alternative. Am nächsten Abend, dem 15. Juli, stimmte das Parlament nach einer elfstündigen ebenso leidenschaftlichen wie wirren Debatte mit den Stimmen der oppositionellen Republikaner für die Zeichnung eines Kriegskredits.60 Kriegsminister Lebœuf brüstete sich vor dem Ministerrat einmal mehr mit seiner »wunderbaren Armee« und erklärte, dass sich niemals wieder eine so prächtige Gelegenheit böte. Mit dem Stock in der Hand werde Frankreich die Preußen züchtigen und der Marsch nach Berlin wäre nicht mehr als ein Spaziergang.61
Von den Straßen war derweil unablässig der Ruf »À Berlin« in den Sitzungssaal gedrungen. Schon bei Jena hatte Frankreich diese Emporkömmlinge gedemütigt und würde es nun wieder tun, da Preußen, anders als 1814/15, allein kämpfte. Die wogende Menge war so groß, dass nicht einmal mehr Fuhrwerke die Straßen passieren konnten. Auch die bisher verbotene Marseillaise war nun überall zu hören.62 Vor Thiers’ Quartier am Platz Saint Georges skandierten wütende Pariser: »Schlagt ihn tot!« Trotz der tumultartigen Szenen darf nicht übersehen werden, dass die wenigen Tausend Demonstranten auf den Straßen und Plätzen gegenüber den zwei Mio. Parisern nur eine verschwindende Minderheit darstellten. Vergleichsweise geordnet verlief am 16. Juli abends die Ausweisung einiger Hundert preußischer Landwehrmänner, die in der Hauptstadt gearbeitet und gelebt hatten. Für sie wurde am Nordbahnhof ein Extrazug dritter Klasse bereitgestellt.63 Etwas komfortabler reiste vier Tage später der preußische Militärattaché Alfred Graf von Waldersee in einem ihm zugewiesenen besonderen Coupé aus Paris ab.64 Da befanden sich beide Großmächte schon im Kriegszustand.
Bismarck hatte doch noch gewonnen. Mit Glück, Geschick und Skrupellosigkeit hatte er das seltene Kunststück fertiggebracht, einen Präventivkrieg zu beginnen und dabei Frankreich den präventiven Schlag führen zu lassen. Von dieser politischen Meisterschaft waren seine Epigonen im Juli 1914 weit entfernt. Ob ein Krieg mit dem fragilen französischen Kaiserreich auf Dauer unvermeidlich war, bleibt eine theoretische Frage. Dass er aber im Juli 1870 ausbrach, ging ohne Abstriche auf Bismarcks Konto.