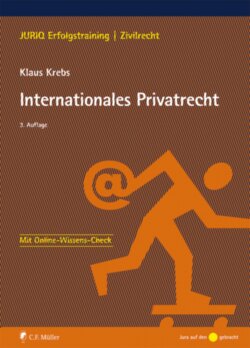Читать книгу Internationales Privatrecht - Klaus Krebs - Страница 70
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Teil Allgemeiner Teil des IPR › D. Vorfrage
D. Vorfrage
59
Wie der Begriff bereits nahe legt, geht es bei Vorfragen[1] darum, innerhalb eines Tatbestandes eine Frage zu klären, die der eigentlichen Hauptfrage (z.B.: „Welches Recht gilt für die Scheidung?“) vorgelagert ist. So setzt beispielsweise eine Scheidung denklogisch das Bestehen einer Ehe voraus. Ob eine Ehe wirksam eingegangen wurde, ist gerade bei Fällen mit Auslandsbezug nicht immer selbstverständlich.
Beispiel
Der Engländer M und die Deutsche F heiraten 2015 während eines Urlaubs in Rom in der dortigen anglikanischen Kirche. Nach vierjähriger Ehe, die M und F in Hannover verbracht haben, beantragt F beim zuständigen Amtsgericht in Hannover die Scheidung.
Die Scheidung setzt als Vorfrage eine wirksam eingegangene und noch bestehende Ehe voraus. Nach deutschem Sachrecht kann nur „vor dem Standesbeamten“ (§ 1310 Abs. 1 BGB) geheiratet werden („obligatorische Zivilehe“ in Deutschland); die kirchliche Trauung ist hierzulande rechtlich unerheblich (vgl. § 1588 BGB).
Im Unterschied dazu erkennt das italienische Eherecht auch die kirchliche Ehe an („fakultative Zivilehe“ in Italien). Der Vorfrage, nach welchem Recht sich die Eheschließung richtet, kommt damit im vorliegenden Fall entscheidende Bedeutung zu.
60
Manche Stimmen in der Literatur wollen Vorfragen unselbstständig nach der lex causae anknüpfen, also immer nach dem Sachrecht beurteilen, das für die Hauptfrage (hier: die Scheidung) gilt. Die ganz h.M. plädiert dagegen grundsätzlich für eine selbstständige Anknüpfung, d.h. sie sucht für die jeweilige Vorfrage die passende Kollisionsnorm und ermittelt auf dieser Grundlage – von der Hauptfrage unabhängig – das auf die Vorfrage anzuwendende Recht. Nur für das Internationale Namensrecht sowie für Vorfragen in völkerrechtlichen Verträgen und im Staatsangehörigkeitsrecht knüpft auch die h.M. unselbstständig an. Für letztere Ansicht spricht v.a. der interne Entscheidungseinklang.[2]
Beispiel
Konkret heißt das für das obige Beispiel (Rn. 59), dass nach der unselbstständigen Anknüpfung deutsches materielles Eheschließungsrecht anzuwenden wäre, da dieses für die Scheidung als Hauptfrage gem. Art. 8 lit. a Rom III-VO[3] berufen ist (die Vorfrage selbst wird vom Anwendungsbereich der Rom III-VO nicht erfasst, siehe Art. 1 Abs. 2 lit. b sowie Erwägungsgrund 10 der Rom III-VO). Da nach deutschem Eheschließungsrecht aber wie gesehen gar keine Ehe zwischen M und F besteht, wäre der Scheidungsantrag erfolglos (vgl. jetzt auch Art. 13 Var. 2 Rom III-VO, wonach das Gericht eine Entscheidung über den Scheidungsantrag sogar insgesamt verweigern dürfte[4]).
Aufgrund des internen Entscheidungseinklangs ist die Eheschließung jedoch richtiger Ansicht nach selbstständig anzuknüpfen. Es ist daher nach der für die Eheschließung passenden Kollisionsnorm zu suchen. Diese ist vorliegend nicht in Art. 11 oder Art. 13 zu erblicken, sondern im Haager Eheschließungsabkommen[5] zu finden. Dieser Staatsvertrag enthält im Verhältnis zu Italien dem EGBGB vorgehende Kollisionsnormen. Nach Art. 5 Abs. 1 des Abkommens bestimmt sich die Formwirksamkeit der Ehe nach dem Recht des Landes, in dem die Eheschließung erfolgt ist, hier also nach italienischem Recht. Danach ist die Ehe zwischen M und F wirksam. Für die Scheidung gilt nach Art. 8 lit. a Rom III-VO deutsches Recht. Die gültige Ehe kann danach unter den Voraussetzungen der §§ 1565, 1566 BGB geschieden werden.