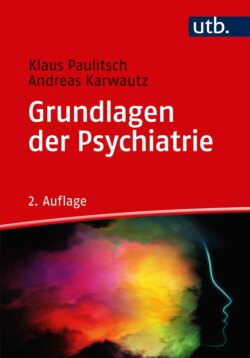Читать книгу Grundlagen der Psychiatrie - Klaus Paulitsch - Страница 31
1Psychopharmakotherapie 1.1Einleitung
ОглавлениеPsychopharmaka sind Substanzen, die auf cerebrale Strukturen einwirken (psychotrope Substanzen). Sie regulieren Hirnfunktionen und modifizieren psychische Abläufe. Die Wirkung entfaltet sich an den Synapsen (Kontaktstellen zwischen zwei Nervenzellen) durch Beeinflussung der Botenstoffe (Neurotransmitter). Diese Überträgersubstanzen regulieren die neuronale Erregung und elektrische Weiterleitung zwischen den einzelnen Nervenzellen. Die wichtigsten durch Psychopharmaka beeinflussbaren Neurotransmitter sind Noradrenalin, Serotonin, Dopamin, Acetylcholin und GABA (Gammaaminobuttersäure). Sie werden in kleinen Bläschen (Vesikeln) in den Nervenenden gespeichert und besetzen, nachdem sie durch einen elektrischen Impuls freigesetzt wurden, den nachgeschalteten Rezeptor einer benachbarten Nervenzelle. Im synaptischen Spalt erfolgt entweder der Abbau der Überträgersubstanzen oder sie werden wieder in die Bläschen der Nervenenden aufgenommen und inaktiviert.
Wirksame Psychopharmaka wurden erst in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckt. Den Durchbruch schaffte das 1952 entwickelte Chlorpromazin durch Jean Delay und Pierre Deniker, die zufällig die antipsychotische Wirkung der Substanz entdeckten. Bis dahin konnten Symptome psychisch kranker Menschen nur unspezifisch mit Opium, Alkohol oder Barbituraten gelindert werden. Bald nach Entwicklung des ersten Neuroleptikums (Antipsychotikums) Chlorpromazin wurde 1954 Meprobamat als erster Tranquilizer und 1957 von Roland Kühn das erste Antidepressivum (Imipramin) entwickelt. Die antimanische Wirkung von Lithium wurde bereits 1949 von John Cade entdeckt und 1967 seine phasenprophylaktische Wirkung.
Seither gehören Psychopharmaka zu den am häufigsten verordneten Medikamenten, obwohl in der Bevölkerung falsche Vorstellungen über deren Wirkungsweise bestehen. „Chemische Zwangsjacke“, „Pillenkeule“, „mit Medikamenten vollgestopft“ sind nur einige negative Attribute für die Pharmakotherapie. Die Vorurteile Medikamenten gegenüber führen allzu oft zur Stigmatisierung jener Personen, die diese zur Behandlung dringend benötigen. Nach Meinung aber fast aller psychiatrischer und psychiatriehistorischer Forscher hat die Entwicklung der Psychopharmaka in den 50er-Jahren wesentlich zu den Reformen in der Psychiatrie und zur „Öffnung“ der Anstalten beigetragen. Viele psychische Erkrankungen wie Psychosen, Depressionen, Angsterkrankungen, Schlafstörungen oder Erregungszustände können durch Medikamente effizient behandelt werden. Im klinischen Alltag sind daher Psychopharmaka unentbehrlich. Die Behandlungsstrategien sind in den letzten Jahren differenzierter geworden, aber man ist noch weit davon entfernt, über ein passendes Medikament für jede psychische Störung zu verfügen und die biochemischen Zusammenhänge im Einzelnen zu verstehen. Die Verordnung erfordert viel Erfahrung, setzt einen Gesamtbehandlungsplan voraus und soll nur bei bestehender Indikation erfolgen. Grundlage ist eine gute Arzt-Patient-Beziehung, in der psychosoziale Hintergründe und die Persönlichkeit des Patienten berücksichtigt werden. Der Arzt ist zwar der Experte, der Betroffene bringt aber das nicht minder wichtige individuelle Erfahrungswissen ein.
Spricht man von Psychopharmaka, sollte man generell zwischen zwei Gruppen differenzieren, die unterschiedlich zu bewerten sind: Die erste Gruppe umfasst jene Medikamente, die von PatientInnen nur vorübergehend eingenommen werden sollen, da sie ein Abhängigkeitspotenzial aufweisen und Langzeitschäden zu befürchten sind. Hierzu zählt man vorwiegend die Tranquilizer (v. a. Benzodiazepine). Zur zweiten Gruppe zählt man jene Medikamente, bei denen keine Suchtgefahr besteht und die wegen guter Verträglichkeit langfristig zur psychischen Stabilisierung verabreicht werden können. Dies sind vor allem Antidepressiva und Phasenprophylaktika, aber auch Antipsychotika und Antidementativa.