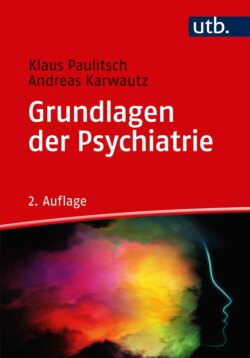Читать книгу Grundlagen der Psychiatrie - Klaus Paulitsch - Страница 47
1.5.3Substanzgruppen und Nebenwirkungen
ОглавлениеDie Einteilung von Antipsychotika ist nach verschieden Gesichtspunkten möglich, wie z. B. nach der chemischen Struktur oder der antipsychotischen Wirksamkeit. Letzteres Einteilungsprinzip („neuroleptische Potenz“) unterscheidet hochpotente Antipsychotika, die in mittlerer Dosierung eine gute antipsychotische Wirkung zeigen, von niedrigpotenten, die nur gering antipsychotisch eingestuft werden und vorwiegend eine sedierende Komponente aufweisen. Ebenso lassen sich Antipsychotika in konventionelle ältere und „atypische“ neuere unterteilen.
Konventionelle hochpotente Antipsychotika
Zu dieser Substanzgruppe zählt man vor allem Haloperidol (Haldol®), welches sich durch eine gute antipsychotische Wirksamkeit auszeichnet, aber langfristig zu Bewegungsstörungen (extrapyramidalmotorische Symptome), wie Schlundkrämpfe, starre Mimik, kleinschrittiger Gang und Muskelsteifheit führt. Diese auch als „Parkinsonsyndrom“ bezeichnete Symptomatik war als gefürchtete Nebenwirkung bei der ersten Generation der (konventionellen) Antipsychotika anzutreffen und führte nicht selten zum vorzeitigen Absetzen der Medikamente. Haloperidol ist dennoch ein notwendiges Medikament in der Psychiatrie, das sich bei deliranten Zustandsbildern und Erregungszuständen aufgrund seiner guten Kreislaufverträglichkeit bewährt hat. Zuclopenthixol (Cisordinol®) wird aufgrund des Nebenwirkungsprofils nur mehr sehr selten verabreicht.
Niedrigpotente Antipsychotika
Diese Gruppe von Psychopharmaka wirkt bei mittlerer Dosierung kaum antipsychotisch, jedoch stark sedierend. Diese Substanzen sollen wegen der Nebenwirkungen (Blutdruckabfall, Tachykardie, Atemnot) nur bei starker psychomotorischer Erregung als Zusatzmedikation oder als Schlafmittel verwendet werden. Zu den niedrigpotenten Antipsychotika zählt man Chlorprothixen (Truxal®), Levopromazin (Nozinan®) oder Prothipendyl (Dominal®).
Atypische Antipsychotika
Die Bezeichnung „atypisch“ bezieht sich auf die fehlende Nebenwirkung des Parkinsonsyndroms, das diese Gruppe von Antipsychotika mehr oder weniger auszeichnet. Das erste „Atypikum“, welches keine Bewegungsstörungen (Parkinsonsyndrom) auslöst, ist Clozapin (Leponex®). Es gilt als das wirksamste Medikament in der Behandlung der Schizophrenie, hat jedoch eine Reihe von Nachteilen, weswegen es nur bei therapieresistenten Fällen verwendet werden darf. Neben starker Müdigkeit und Gewichtszunahme ist eine Blutbildveränderung (Leukozytenabfall) als unerwünschte Wirkung möglich. Regelmäßige Blutbildkontrollen sind deswegen notwendig, und bei einem Abfall der Leukozytenzahl im Blut ist das Präparat abzusetzen.
In den letzten Jahren kamen ein Reihe von Weiterentwicklungen von atypischen Antipsychotika auf den Markt, die primär zur Schizophreniebehandlung entwickelt wurden, nun aber ebenso bei bipolaren Störungen, Persönlichkeitsstörungen und Demenzen zum Einsatz kommen sollen. Obwohl diese Medikamente statistisch gesehen weniger Bewegungsstörungen verursachen, sind sie nicht frei von anderen unangenehmen Nebenwirkungen. Bei manchen atypischen Antipsychotika kommt es zu Gewichtszunahme, Stoffwechselstörungen, Herzrhythmusstörungen, Blutbildveränderungen und bei Frauen zu Störungen der Menstruation sowie Brustvergrößerung mit Milchfluss. Zu den „Atypika“ zählt man neben Clozapin (Leponex®), Risperidon (Risperdal®), Olanzapin (Zyprexa®), Quetiapin (Seroquel®), Amisulprid (Solian®), Ziprasidon (Zeldox®) und Aripiprazol (Abilify®).