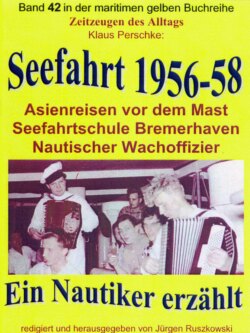Читать книгу Seefahrt 1956-58 – Asienreisen vor dem Mast – Nautischer Wachoffizier - Klaus Perschke - Страница 6
Erste Reise mit MS BAYERNSTEIN nach Ostasien
ОглавлениеMS BAYERNSTEIN
MS BAYERNSTEIN, U-Signal: DEFD. Gebaut auf der Bremer Vulkan-Werft in Bremen-Vegesack unter der BauNr. 839, Stapellauf am 12.10.1954, Indienststellung am 3.01.1955. Länge ü. a.: 158,81 m, Breite: 19,44 m, Tiefgang: 8,42 m – 9,55 m, Seitenhöhe Kiel – Hauptdeck: 12,0 m – BRT: 8.999, NRT: 5.269, 5 Laderäume und 1 Postluke auf dem Promenadendeck. 2 Hauptmaschinen, 2 Td. über 1 Getriebe auf einer Welle – Propeller, 17 kn Geschwindigkeit, GL-Klasse
Die Reisen auf der BAYERNSTEIN stellten während meiner seemännischen Laufbahn vor dem Mast den absoluten Gipfel dar. Natürlich war es auch ein Arbeitsschiff, aber das Betriebsklima unter dem damaligen, souveränen Bootsmann Kurt Tietjen aus Hamburg war einmalig während meiner Ostasien-Fahrzeit bis zum Besuch der Seefahrtsschule in Bremerhaven-Geestemünde.
Und hier die Eintragungen der An- und Abmusterung auf dem MS BAYERNSTEIN.
Am 18. Januar 1956 in Bremen an Bord und am 27. Januar 1957 in Hamburg von Bord.
Mein NDL- Ausweis für die BAYERNSTEIN, den ich im Ausland an Land immer bei mir führen sollte
Hier an dieser Stelle möchte ich einen weiteren Exkurs einfügen. Außer meinen Erinnerungen, die ich aus meiner damals nach Hause geschickten Post herausfiltern konnte, hatte ich wenig Anhaltsmaterial, nicht viele Fotos, die ich mit meinem einfachen Fotoapparat gemacht hatte. Daraus hätte ich niemals den Teil BAYERNSTEIN fortsetzen können. Aber, wie so oft im Leben, kam mir der Zufall zur Hilfe. Nach meinem Ausscheiden als statistischer Sachbearbeiter beim „Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie“ am 28. Februar 2000 hatte ich ein Angebot bekommen, beim Germanischen Lloyd, als Aushilfskraft im Sachgebiet „Port State Controll“ einzuspringen, denn da war Not am Mann. Der eigentliche Sachbearbeiter, Herr Böpple, hatte gerade eine schwere Herzoperation hinter sich und war ausgefallen. Ein junger Student der Hochschule für Seefahrt, Herr Thorsten Knull, der selbst noch in der Endphase der Prüfung - Abgabe der schriftlichen Hausarbeit - stand, war bis Oberkante Unterlippe mit Arbeit eingedeckt. Er war froh, dass ihm so ein „alter Rentner“ zur Seite gestellt wurde. Allerdings musste er mich erst einmal einarbeiten. Natürlich kam man auch miteinander ins Gespräch über frühere Zeiten. Ich erzählte ihm unter anderem, dass ich als Matrose 1956 auf der BAYERNSTEIN vom NDL gefahren hatte. Das verschlug dem jungen Mann die Sprache. Seine Reaktion war: „Dann müssen Sie meinen Vater kennen, denn der fuhr damals als Offiziersanwärter auf dem Schiff.“ Knull? An den Namen konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Jedenfalls kontaktete Knull Junior seinen Vater in Buxtehude und erzählte ihm von unserer Begegnung. Und es dauerte nicht lange, da besuchte Vater Knull seinen Sohn im Hause des Germanischen Lloyds, um diesen ominösen Rentner kennen zu lernen. Und es entstand eine Art Verhör: „Kennen Sie noch den Bootsmann von der BAYERNSTEIN?“ „Klar, Kurt Tietjen!“ Und den 1. Offizier? Natürlich, unseren unnahbaren Herrn Vetter, der nur mit dem Bootsmann sprach, es sei denn, er hatte einen auf dem Kieker. Und den Kapitän? Ja, doch der Name war mir entfallen. Und als er mir den sagte, wusste ich sofort wieder Bescheid. Kapitän Schott, der Herrscher aller Weltmeere, jedenfalls derer bis Japan. Er nannte noch Harald Beck, Erst Tesch, Martin Imbusch, den Namen des Oberkochs, des 1. Zahlmeisters, den des 1. Funkoffiziers, den des Bordarztes. Ich war erstaunt, dass er diese Namen noch alle zusammenbekam. Es waren noch etliche mehr. Aus diesem ersten sporadischen Treffen beim GL kamen weitere telefonische Kontakte hinzu. Ich grub auch noch andere ehemaligen Kollegen aus, telefonierte in der Zwischenzeit mit ihnen: Harald Hilmer in Cuxhaven, Fritz Almstedt, Ernst Tesch. Wir wollten uns irgendwann einmal in Hamburg treffen, zusammensetzen und Erinnerungen austauschen, die dann auch in diese „endlose Geschichte“ einfließen sollten. Fritz Almstedt, der als Rentner jetzt im Övelgönner Museumshafen einen alten 90jährigen Klütenewer namens „HANNA“ ehrenamtlich betreut, empfahl mir, dort an Bord ein Treff mit den Ehemaligen zu veranstalten. Ich hoffe, es kommt noch zustande. In der Zwischenzeit versuchte ich allein, auf Grund meiner Post von damals, den Anschluss der Zeit vor dem Mast auf der BAYERNSTEIN so gut wie möglich selbst zu meistern.
Kapitän Schott, ein absoluter Souverän, man sah ihn selten an Deck, der 1. Offizier war der schneidige Herr Paul Vetter, fast unnahbar, wechselte fast kein Wort mit dem niederen Volk, den Jan Maaten. Hin und wieder schiss er einen von uns zusammen, wenn ihm eine Laus über die Leber gelaufen war. Es fuhren auch fünf Chinesen an Bord, die achtern die Schiffswäscherei betrieben. Der Dienstälteste war der „Alte Fritz“, jedenfalls nannte jeder ihn nur Fritz. Die Wäschereigang musste für 91 Mann Besatzung die Bettwäsche, die Arbeitswäsche für die Decks- und Maschinengang, für die Herren der Teppichetagen die Uniformen, für die Stewards die Tischdecken, Servietten und alles Gedöns, womit die Passagiere beeindruckt wurden, waschen. Und wenn das Schiff „full house“ mit 88 Passagieren aufgefüllt war, dann war Hochbetrieb beim Alten Fritzen. Der Alte Fritz war ein „deutscher“ Chinese, hatte die deutsche Staatsangehörigkeit, kam aus Bremerhaven und hatte dort auch eine gut gehende Wäscherei, die von seiner zweiten Frau geleitet wurde. Der Alte Fritz hatte früher, noch vor dem 2. Weltkrieg, bei der Kriegsmarine als Wäscher auf einem der dicken Pötte gefahren, den die Siegermächte nicht versenkt hatten. Er hatte Glück gehabt. Jetzt fuhr er beim NDL, natürlich mit Absicht. Er hatte in Shanghai noch eine große Familie, zu der er Kontakt pflegte, also noch seine erste Frau und einen Sohn aus erster Ehe.
In so einem großen schwimmenden Betrieb kennt man natürlich nicht jeden. Aber jeder kannte Ernst Tesch aus Timmendorf und Martin Imbusch aus Bremen. Ernst war der Gängesteward. Er musste jeden Morgen die Betriebsgänge mittschiffs fegen und feudeln. Martin war der Kabelgattsteward und zuständig für die Ausgabe von Werkzeug und Farbe, weiterhin der Oberspleißer, wenn es um Tauwerk, Geien und Laderunner ging, die zu spleißen waren. Dann war da noch Leichtmatrose Harald Beck aus Würzburg, der Promenadendecksteward, der schönste Mann von der Decksgang. Er war zuständig für die Ausgabe von Liegestühlen an die Passagiere. Weiterhin war es seine Aufgabe, morgens ab 06:00 Uhr nach dem Deckwaschen auf dem Promenadendeck die Teakholzreling mit Frischwasser abzuschwabbeln. Und wenn die ersten jungen weiblichen Frühaufsteher erschienen, dann hatte Freund Harald viele Aufträge zu erfüllen: „Please move the deckchair in the sun“ usw., usw. Ladies always first!
Beinahe hätte ich eine sehr wichtige Person unserer 91köpfigen Besatzung vergessen, nämlich Frau Zausch. Frau Zausch war damals um die 50 Jahre alt und die Krankenschwester an Bord. Bei Bedarf, wenn wir auch etliche Kleinkinder unter den Passagieren hatten, musste sie auch als Kindergärtnerin einspringen, zur Entlastung der Eltern, damit die in Ruhe die Reise genießen konnten. In diesem Fall stand Frau Zausch ein nur für Kinder eingerichteter Raum zur Verfügung, der mit Spielzeug und Unterhaltungsspielen ausgestattet war. Und sie hatte dann auch allerhand mit den Blagen zu tun, denn die konnten sie ganz schön auf Trab halten. Wir hatten damals das Gefühl, als wenn Frau Zausch unseren Bootsmann heimlich anhimmelte. Wie gesagt, es war nur eine Vermutung. Frau Zausch war besonders gefragt, wenn das Schiff rollte und stampfte und die Eltern seekrank waren. Dann lagen die Kinder der seekranken Eltern ganz in der Obhut von Frau Zausch.
Nach dem Inhalt meines ersten Briefs vom 22.01.1956 an meine Eltern musste ich damals im Auftrage des „Recruting Office“ des NDL direkt von der REIFENSTEIN an Bord der BAYERNSTEIN übersteigen und wurde am 18.01.1956 in Bremen angemustert. Von Bremen aus ging die erste Fahrt der Rundreise nach Hamburg zum Laden. Danach ging es wieder zurück nach Bremen, um die Restladung aus deutschen Häfen an Bord zu nehmen. Es war Schlechterwetterzeit. Und da bei diesem Wetter kein Seelotse versetzt werden konnte, war der Weserlotse bereits aus Geestemünde nach Hamburg gekommen und fuhr mit uns als Gast bis zur Weseransteuerung. Diese kurze Strecke der Reise hatte es in sich. Draußen bei Feuerschiff ELBE 1 hatten wir einen Kuhsturm aus NW, Stärke 10. Das Schiff machte im noch nicht abgeladenen Zustand heftige Bocksprünge und kam mächtig ins Rollen, als es in die Weser einlief. Trotzdem lief die BAYERNSTEIN noch 15 kn bei dem Schietwetter. Ich hatte wieder einmal das Glück, die 4-8-Wache gehen zu dürfen. Insgesamt waren wir drei Mann, die sich die Wache teilten: 1 Stunde und 20 Minuten am Ruder stehen, weiter 1 Stunde und 20 Minuten Ausguck in der Brückennock gehen und 1 Stunde und 20 Minuten „stand-by“ unter Deck, das hieß, am Ende der Seewache die nächste Wache zu wecken und für sie Kaffee zu kochen.
Wie war ich untergebracht auf diesem Schiff? Also, meine Wenigkeit wurde midships in einer Zweimannkammer einquartiert. Der Rest der Decksbauern wohnte achtern. Ich war mit meiner Räumlichkeit vollauf zufrieden. Anfangs musste ich mich erst daran gewöhnen, statt der gewohnten Schraubengeräusche nun das Singen der Hauptmaschinen zu hören. Wahrscheinlich waren das die hohen Frequenzen der Turbolader. Meine Kammer hatte auch einen Nachteil: Bei schlechtem Wetter mussten die Bullaugen geschlossen bleiben, sonst wäre der Blanke Hans eingestiegen. Aber das wurde wettgemacht durch den Vorteil, dass die Kammer fließend warmes und kaltes Wasser hatte, ein Luxus, auf den die Decksbauern achtern verzichten mussten. Mit mir auf dem Betriebsgang wohnten etliche Stewards und das Maschinenpersonal. Weiterhin war mein Weg zur Mannschaftsmesse relativ kurz.
Der Aufenthalt im Hafen von Bremen war immer recht arbeitsintensiv: erste, zweite, dritte Schicht. Der Bootsmann und Martin Imbusch teilten sich die Decksaufsicht, wir, der Rest der Deckscrew, wurden auf die Schichten verteilt, immer stand-by, Stauholz in die Luken, wenn Not am Mann war. Anschließend, als es dem Ende zuging, eine Luke nach der anderen seeklar machen, Bäume niederlegen usw. Wir luden unter anderem als Deckslast, feuergefährliche Chemikalien oder Säuren und Laugen in Fässern und Demijohns. Und die wurden stets auf dem Vorschiff in den Seiten neben den Luken 2 und Luke 3 platziert, mit Stauholz eingeschalt und gelascht. Wir hatten also genug zu tun.
Bei dem Wetter ging es weiter von Bremen nach Rotterdam. Auch wieder Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Wieder zwei Tage „Maloche pure“, anschließend gingen wir noch nach Antwerpen. Dort auch der gleiche Wahnsinn wie in Rotterdam. Und von Antwerpen weiter in den Englischen Kanal nach Southhampton. Auf Southhampton Reede kamen per Bargen viele Tausende Postsäcke, die wir für die Häfen der damaligen britischen Kolonien in Ostasien in der Postluke, also Luke 4, luden. Außer den Postsäcken wurden viele Passagiere eingeschifft. Der Aufenthalt in Southhampton betrug ca. 6 bis 8 Stunden.
Danach hieß es, sobald der Pilot an Bord gekommen war und uns die Behörden ausklariert hatten: „Anker hieven!“, und schon dirigierte uns der Lotse ein Stück an „Isle of Wight“ vorbei in Richtung Ärmelkanal, wo ihn ein bereits auf ihn wartendes Pilot Boat in Empfang nahm und zurück nach Portsmouth brachte. Wir dagegen setzten unsere Reise gen Westen fort, vorbei an St. Catherine’s Point, St. Alban’s Head, Start Point und Lizard Point, Isles of Scilly und hinein in die Biscaya. Und der Kuhsturm aus Nordwest nahm uns in Empfang, die See wurde höher, das Schiff machte krumm. Die Biscayapassage war bei dieser Jahreszeit immer mit einer fürchterlichen Rollerei verbunden. Doch sobald wir den Kurs anfangs auf Südwest, später an der spanisch-portugiesischen Küste auf Süd änderten, fing die BAYERNSTEIN wie ein Rennpferd an zu laufen und brauste mit Wind und See von achtern mit glatten 18 kn Fahrt in Richtung Cabo de Sao Vicente. Und jetzt erst wurde die Seefahrt wieder angenehm, jedenfalls vorübergehend. Um den 28.01.1956 passierten wir Gibraltar.
Später ging es dann durch den Golf von Valencia, vorbei an den Balearischen Inseln an Steuerbord-Seite bis ins Ligurische Meer und in den Golf von Genova hinein. Am 2.02.1956 erreichten wir Genua, wo wir an einem Kai im Hafen festmachten. Die genuesischen Hafenarbeiter waren noch nicht ganz so durchgeknallt wie die Kollegen in Rotterdam, Antwerpen, Bremen und Hamburg. Hier ließ man alles piano, piano anlaufen. Erst kamen die Behörden an Bord zum Einklarieren, die Zöllner, um ihren Obolus nach getaner Arbeit in Empfang zu nehmen. Und dann kamen die Hafenarbeiter mit ihrem Gewerkschaftsfunktionär, der überall herumschnüffelte. Wenn etwas nicht koscher war, dann beriet man sich, ob man streiken sollte und diskutierte, Mama mia, Papa mio. Aaaah, da hatte der Bootsmann nicht rechtzeitig ein Sicherheitsnetz unter dem Fallreep anbringen lassen. Kein Mann durfte an Bord gehen. Natürlich lag das Netz oben bereits im Gang, nur, wir waren noch nicht dazu gekommen, es anzubringen. Manche von den Brüdern tauchten auch im Bereich der Mannschaftsunterkünfte auf, ganz bestimmt nicht zufällig. In diesem Falle wurden sie von uns sofort an Deck zurück verwiesen. Und auch oben auf dem Promenadendeck, wo sie die Postluke geöffnet haben wollten. Auch von dort wurden sie von uns verwiesen. Hier habt ihr nichts verloren ihr Halunken! Wir waren jetzt verdammt wachsam geworden.
Die Mannschaftspost war an Bord gebracht worden. Und es sah so aus, als ob ich dieses Mal leer ausgegangen wäre, dachte ich jedenfalls. Die Post wurde vom Zahlmeister-Assistenten, Herrn Clausen, vorsortiert und dann an die entsprechenden Abteilungschefs weitergegeben. Und die verteilten sie an ihre Leute. Am nächsten Tag, wir hatten Genua bereits verlassen und dampften schon durch das Tyrrhenische Meer an Napoli vorbei, kam ein Salonsteward nach midships in die Mannschaftsmesse und fragte nach einem Klaus Perschke. „Ja, das bin ich!“ rief ich ihm zu. Er stellte sich vor: „Ich bin Dieter Peschke, man hatte mir aus Versehen deine Post gegeben, und ich hatte nicht so genau auf das Couvert gesehen. Ich hatte sie einfach geöffnet. Das ist mir verdammt peinlich, ich habe aber nur die Anrede gelesen, da merkte ich erst, dass da noch einer an Bord ist, der so ähnlich heißt wie ich.“ Das hieß, der Zahlmeister-Assistent war der Auslöser der Verwechslung. Und der Obersteward hatte in der Eile des Gefechts auch nicht die Namensverwechslung mitbekommen. Wir klönten noch etwas länger. Dabei stellte sich heraus, dass auch er ein gebürtiger Breslauer war, und das haute mich fast um. Er hatte Ähnlichkeit mit meinem Cousin Eckard Perschke. Salonsteward Peschke hatte ein Hobby, und das war gar nicht billig, er fotografierte nämlich gerne. Er lud mich später im östlichen Mittelmeer mal zu sich in seine Kabine ein und zeigte mir seine Fotoausrüstung. Der totale Wahnsinn! Er hatte gleich mehrere Kameras mit entsprechend teuren Objektiven. Zusätzlich hatte er ein eigenes Entwicklungslabor an Bord. Das hatte ihm die Schiffsleitung genehmigt. In seiner Freizeit machte er Aufnahmen von allen Passagieren, zum Beispiel bei festlichen Anlässen. Die entwickelten Fotos verkaufte er dann an die Fahrgäste und die Besatzung, und dabei machte er einen sehr guten Umsatz. Für den Entwicklungslaborraum musste er aber eine Art Miete oder Pacht bezahlen. Sein ganzes Fotopapier kaufte er in der Regel hauptsächlich in Hongkong.
Meine ehemaliger Schulkollege Fritz Almstedt, Harald Beck und meine Wenigkeit im östlichen Mittelmeer, 1956
Im Tyrrhenischen Meer auf dem Wege zur „Stretto di Messina“ gingen die Temperaturen noch einmal kurzfristig in den Keller, nachts sanken sie sogar unter den Gefrierpunkt. Zwischendurch wurden wir von starken Schneeböen gebeutelt. Und das vor Sizilien. Damit hatte ich nicht gerechnet. An Deck war es verdammt ungemütlich. Mit „Zutörnen“ war nichts. Auch die blassen und sonnenhungrigen Passagiere wurden in ihre Schranken gewiesen. Die Liegestühle blieben vorübergehend noch fest gelascht in den Nischen auf dem Promenadendeck. Das Promenadendeck war total verwaist.
Das Promenadendeck mit der „Postluke“, also Luke 4 im seeklaren Zustand
Wo war das schöne Wetter von Bella Italia? Es sollte kommen, aber nicht unter der Küste von Bella Italia, sondern etwas östlicher in Reichweite der libysch-ägyptischen Küste. Erst da wurde unser Promenadendecksteward Harald Beck gefordert. „I would like to get a deck chair at a sunny place.“ Ab dem Moment war Harald Beck wieder voll beschäftigt.
Am 5.02.1956 erreichten wir Port Said. Wir mussten einige Stunden an den Wartetonnen im Kanal festmachen, und vorn auf der Back wurden auf Anordnung der Kanalsbehörde riesige Doppelscheinwerfer angebracht, die nachts die Breite des Kanals ausleuchteten, damit der Canel Pilot etwas sehen konnte. Während der Zeit, in der wir einklariert wurden, kam „Ferdinand, der Freund aller Seeleute und größte Gauner von Port Said“ mit seinen Mannen an Bord und breitete sich in der Mannschaftsmesse aus. Alle Mannschaftskammern mussten ab diesem Moment verschlossen werden. Ernst Tesch musste öfters die Betriebsgänge kontrollieren. Den Brüdern konnte man nicht weiter trauen, als man sie sehen konnte. Und das war auch schon ein Risiko. Nachdem ein Konvoi von ca. 10 Schiffen zusammengestellt und mit Lotsen besetzt war, war der Zeitpunkt des Abschieds für Ferdinand und seine Mafia gekommen. Sie mussten die Mannschaftsmesse räumen und das Schiff verlassen. Es hieß wieder „stand-by, klar vorn und achtern, Leinen los!“ Und als die letzte Leine eingeholt worden war, ging es laut Anweisung des britischen Canal Pilots erst einmal mit „Ganz langsam voraus“ hinter dem Vordermann her. „Port Said bye-bye!“
Erst herrschte noch eine frische kühle Brise, immerhin war es Anfang Februar, also auch für die Länder in diesen levantinischen Breiten noch Winterzeit.
Warten im Großen Bittersee
Der große Bittersee war unser erstes Ziel, denn dort musste der südfahrende Konvoy erst einmal ein paar Stunden ankern, um den nordfahrenden Konvoy vorbeifahren zu lassen. In Ismaelia, kurz vor Erreichen des Großen Bittersees, war Lotsenwechsel. Der nächste britische Pilot brachte uns dann weiter bis nach Suez. Während wir noch im Großen Bittersee ankerten, gab es einige Kadetten, die in ihrer Freiwache ihre Angelrute herausholten und auf Petris Gnade hofften. Doch es kam kein Fisch auf den Teller. Wahrscheinlich hatten sie uns durchschaut. Manche Kollegen wollten bei einer Kiste Bier wetten, dass es Haie im Großen Bittersee gebe. Aber auch sie hatten keinen Hai beziehungsweise eine Rückenflosse gesehen, die ihre Kreise um das Schiff gezogen hätten. Dagegen sahen wir den nordwärts fahrenden Konvoy vorbeikommen. Es dauerte nicht lange, da hieß es wieder „Anken hieven!“, und, als dieser an der Wasseroberfläche auftauchte, ließ der Pilot den Maschinentelegrafen wieder auf „Langsam voraus“ legen. Die BAYERNSTEIN setzte sich wieder langsam in Bewegung, immer in gebührendem Abstand vom Vordermann. Wieder vergingen etliche Stunden, bis aus dem Wüstensand Suez auftauchte. Jedes Schiff lief in die Bucht von Suez ein, stoppte die Fahrt und wartete, bis ein Schlepper der Kanalbehörde auftauchte und das Bedienungspersonal die Mietdoppelscheinwerfer von der Back auf das Deck des Schleppers herabgefiert hatte. Erst danach verabschiedete sich der Pilot und kletterte mit dem Bedienungspersonal auf das wartende Pilot Boat.
Freie Fahrt bis Aden, Maschine voll voraus. Zunächst stürmten wir durch den Golf von Suez, danach durch das Rote Meer, an Steuerbordseite an Port Sudan, an Backbordseite an Jiddah vorbei, bis wir die Durchfahrt von Bab el Mandeb passierten und voraus an Backbord Aden ansteuerten. Mit jeder Seemeile, die wir vom Suezkanal in Richtung Aden stürmten, wurde das Wetter auch immer freundlicher, und jetzt sah man auf dem Promenadendeck die hübschesten Bienen sich in den Liegestühlen rekeln. Diese Damen waren britische Militärangehörige oder die Ehefrauen britischer Militärs, die aus dem Urlaub in Great Britian zurück zu ihren Standorten fuhren. Und sie geizten nicht mit ihren Reizen. Harald Beck kam ganz schön ins Schwitzen, denn auf ihn hatten die meisten ein Auge geworfen. Doch auch unser Übervater Kurt Tietjen hatte eine Ahnung, und er trieb sich öfters in Haralds Nähe herum. Die rolligen Damen hatten keine Chance, sich mit Harald zu verabreden. Den Ladies blieb nur der Barsteward hinter seinem Tresen, aber der wollte hauptsächlich seinen Doornkaat als Gin an die britischen Maiden verkaufen. Auch hatte er schon etliche Jährchen auf dem Buckel, er konnte mit dem knackigen Harald nicht konkurrieren.
So sah das Panorama am 11.02.1956 beim Einlaufen von Aden aus
Am 11.02.1956, dem Tag, an dem ich 21 Jahre alt geworden war, steuerten wir Aden an. Nur Felsen, Felsen, Felsen empfingen uns. Dort in den Hintergrund des Bildes an der Küste brachte uns der britische Harbour Pilot. In Aden hatten wir einen Haufen Postsäcke zu löschen, und einige Militärangehörige wurden ausgeschifft. Hier brüllte noch der britische Löwe und überwachte den Eingang zum Golf von Aden und zum Indischen Ozean, - noch! Keiner ahnte damals, dass auch hier für die Royal Armee die Stunden gezählt waren und der Countdown bereits lief. Das Bunkern war hier für den NDL noch relativ billig. Ein Bunkerboot kam längsseits, und während die ersten Postsäcke an Land fuhren, floss das Fueloel durch einen Schlauch an Bord in die Bunkertanks. Aden war ein riesiger Hitzekessel. Ich habe mich gewundert und gefragt, wie die dort lebenden Europäer diese Hitze überhaupt vertragen konnten? Das war nun „Her Majesty own property“. Hier wollte ich wirklich nicht „tot über dem Zaun hängen“. Trotzdem, in Aden hatte ich ohne große Feierlichkeit meinen 21. Geburtstag begangen. Ich war jetzt volljährig und voll verantwortlich für meine Taten und Untaten, die ich mir in Zukunft noch abkneifen sollte. Auf jeden Fall waren wir froh, als wir Stunden später wieder „Anker-auf“ gehen und auslaufen konnten.
Der Übersegler von „Africa and the Middleeast“, worauf unsere Segelroute vom Golf of Aden durch den Idian Ocean nach Colombo zu ersehen ist.
Quelle: Lloyds Maritime Atlas of World ports and shipping places, Twenty-First-Edition, 2001
Wie bereits erwähnt, war das Wetter inzwischen fantastisch geworden. Da es im Indischen Ozean fast keine Rollbewegungen durch irgendwelche Dünung gab, das Schiff lag fast ruhig, war auch die Zeit gekommen, das Schwimmbad klar zu machen und zu fluten. Das war wieder Harald Becks Job. Und diesen führte er auch gewissenhaft aus. Uns’ Harald, jetzt nur mit Badehose bekleidet, schrubbte die Kacheln des Bodens und der vier Wände gründlich mit P3-Wasser und spülte es mit Seewasser anschließend genau so gründlich aus. Und bei seinem athletischen Körper, den er zur Schau stellte, hielten es die Ladies in den Liegestühlen nicht mehr aus. Sie drängelten sich – im Bikini natürlich – an der Promenadendecksbar herum, die jetzt zum Schwimmbad hin geöffnet war, und schlürften eiskalte Drinks in sich hinein. Dabei begutachteten sie Haralds Körper und sein Werk mit fachfraulichen Blicken. Aber Bootsmann Kurt Tietjen stand nie weit entfernt und verhinderte mit diversen dienstlichen Anweisungen das Zustandekommen irgendwelcher Konversationen zum anderen Geschlecht. Denn Kurt Tietjen, Haralds Schutzengel, wollte unter allen Umständen verhindern, dass der 1. Offizier auch noch auftauchte und Harald irgendwelche nichtigen Aufträge erteilte. Herr Vetter war der eigentliche Platzhirsch auf dem Promenadendeck. Das war sein Revier, das er energisch gegen jeden Eindringling verteidigte. Vermutlich sah er in Harald einen Eindringling in sein Revier, denn die Damen hatten mehr Interesse an Harald als an ihm in seiner gebügelten weißen Uniform.
Unsere Reise führte zunächst nach Colombo auf Ceylon, heute Sri Lanka. Der Anmarschweg von Aden nach Colombo führte zunächst vom Golf von Aden bis zu den Inseln Abd al Kuri und Socotra, die wir an unserer Steuerbordseite passierten, von dort südlich des Arabischen Meers auf fast ostsüdöstlichem Kurs bis zum Eight Degree Channel, also der Durchfahrt nördlich der Malediven bis zur Südspitze von Indien, in den Golf von Manar. Tja, und GPS, also das „Global Positioning System“, bzw. das heute, seit den 1980er Jahren am gängigsten benutzte Navigationsmittel ECDIS, eine Kombination aus elektronischer Seekarte, GPS und Radar mit seinen metergenauen absoluten Positionsbestimmungen, war damals noch ein Fremdwort an den Seefahrtsschulen der norddeutschen Küsten, und diese Navigationsgeräte waren in der Christlichen Seefahrt – wie bereits an anderer Stelle erwähnt - noch absolut unbekannt. Die wahre Kunst der Navigation war noch gefordert, auf offenem Meer die astronomische Ortsbestimmung, also der Umgang mit Sextant und den astronomischen Tabellen, und wenn man unter der Küste fuhr, waren die terrestrische Navigation, die Funkpeilerei und Radarpeilungen gefordert. Die heutigen Navigationsexperten würden die Nase rümpfen. Für die damaligen Kollegen auf der Brücke war schon die Ausrüstung mit einer Radaranlage ein enormer Fortschritt. Immerhin schrieben wir das Jahr 1956 und nicht 2007. Trotzdem, alle Nautiker der damaligen großen Fahrt, die sich weltweit mit ihren Schiffen bewegten, kannten die markanten Sterne ihrer Sternbilder, die sie morgens und abends in der Dämmerung zur Beobachtung benutzten, fast auswendig. Sie wussten auf Anhieb, wo welches Sternbild mit welchem Beobachtungsstern auftauchen würde. Ich frage mich, was machen die heutigen jungen Kollegen, wenn ihr heißgeliebtes ECDIS-Gerät an Bord für einen oder zwei Tage ausfallen würde. Wissen sie noch, wo die alte Kiste mit dem Sextanten auf der Brücke steht? Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil ich in den 1980er Jahren später als 1. Offizier in genau so eine Situation geraten war.
Auch Ceylon gehörte zur britischen Krone und wurde von einem ansehnlichen Beamtenapparat Ihrer Majestät aus London geführt. Das britische Militär sorgte dafür, dass aufkeimende Unruhen sofort im Keim erstickt wurden. Also, es war damals noch ruhig auf Ceylon und der reinste Erholungsjob für die dort stationierten „Her Majesty own servents“ und Militärangehörigen. Und davon hatten wir auch einige unter den Passagieren. Also, es stiegen dort auch wieder etliche britische Fahrgäste aus. Für sie hatte das Reisevergnügen dort nun ein Ende.
Nach der Ankunft in Colombo und nach der Einklarierung, dem Löschklarmachen und Öffnen der Luken, kamen mit den Hafenarbeitern auch die Souvenirhändler in Scharen an Bord und drängten sich unangenehm den Besatzungsmitgliedern auf. Der Bootsmann musste alle Eingänge zum Schiff bewachen lassen und die Typen an Deck komplimentieren. Dort durften sie ihre Auslagen ausbreiten und präsentieren. Natürlich war man in der Mittagspause neugierig. Und da man bei der kurzen Liegezeit keinen Landgang in Colombo bekam, warf man doch schon mal hier und dort einen Blick auf die Angebote der Händler. Es gab nichts Berauschendes, womit man die Lieben zu Hause hätte begeistern können. Ansichtskarten, viel Schnickschnack, wie in jedem Hafen, irgendwelche Püppchen und Figürchen, welche einen nicht vom Hocker rissen. Aber etliche hatten diese kleinen typischen Teekistchen, in denen man eben diesen Tee aus Ceylon nach Europa verschiffte. Und so eine kleine Teekiste aus Sperrholz mit den metallischen Kantenbeschlägen hatte ich mir gekauft. Das bekam man nicht jeden Tag zuhause zu sehen. Inhalt ungefähr ein Kilo Tee. Eine sooo große Besonderheit war es trotzdem auch wieder nicht, denn den gleichen Tee hätte ich auch in Cuxhaven kaufen können. Nur, es war eben ein Mitbringsel aus dem schönen Colombo auf Ceylon.
Nachdem wir unsere bis Colombo gebuchten britischen Passagiere mit ihren „personal effects“ an Land gesetzt hatten, weiterhin Herr Hanuschke etliche hundert Postsäcke aus der Postluke ordnungsgemäß der „Royal British Post“ nachgezählt übergeben hatte, war es wieder soweit, die BAYERNSTEIN langsam seeklar zu machen. Wie gesagt, Colombo hatten wir nur von Bord aus zu sehen bekommen.
Nachdem wir dem Hafen von Colombo den Rücken gekehrt und das südliche Cap Dondra Head umrundet hatten, setzte Kapitän Schott fast Ostkurs auf die Durchfahrt zwischen Sumatra und den Nicobar-Inseln nördlich der Durchfahrt ab. Die Strecke bis Singapore betrug 1.567 sm (oder für die Landratte: 2.902 km). Das heißt, wir brauchten für diese Distanz bei 17 kn Fahrt 92 Stunden oder 3 Tage 19 Stunden. Am 20.02.1956 hieß es wieder „Klar vorn und achtern!“ Beim Ein- und Auslaufen standen wir in „seemannsweiß“ vorn und achtern. Wir waren ja auch besondere Seeleute!
Hier unsere wilde Backgang beim Einlaufen in Singapore 1956. Ganz vorn im Bild Heini Winter, der schönste Mann auf der Back, ganz links steht der 2. Offizier, Herr Dopp. Fritz Almstedt versteckt sich gerade hinter dem Kollegen rechts neben dem Galgen. Von meiner Wenigkeit sieht man nur den Kopf, sieht so aus, als ob ich Fritz aus seinem Versteck ziehen will. Das Foto hatte der 1. Zimmermann Kuddel Ketschau geschossen. Das Foto ist reif für das „Ohn-Sorg-Theater“.
Was fällt mir über Singapore ein? Auf jeden Fall hatte ich keinen Landgang, sondern musste Raumwache gehen. Doch in Singapore wurde auch nur tagsüber im Hafen gearbeitet. Also mit dem „Überstundenmachen“ sah es bis dato mau aus. Der Bootsmann ließ nur seine Tagelöhner ranklotzen, aber auch nur in Grenzen. Er hatte bestimmt seine Anweisungen von oben bekommen. Die Seewachen – insgesamt 9 Mann – durften nur ihre Seewache gehen. Natürlich große Enttäuschung! Ich hoffte, dass sich das auf der Heimreise noch ändern würde. Singapore war damals auch noch eine Kronkolonie des „British Empire“. Auch hier stieg wieder ein Teil der Passagiere aus, die im Dienst der Krone standen.
Auf dieser Reise hatten wir auch ein britisches Ehepaar mit einem zweijährigen Kind an Bord, die in Singapore ausstiegen. Er war ein junger Polizeioffizier, und sie war auch eine Polizeiangehörige in einem höheren Rang. Sie war, nebenbei erwähnt, eine bildhübsche Malayin, bildhübsch sogar in ihrer Uniform, die sie trug, als sie mit dem Baby von Bord ging. Jeder von uns hatte sie schon auf der Reise im Stillen bewundert. Von den restlichen britischen Fahrgästen wurden sie höflich behandelt. Es war aber wohl nicht im Sinne der britischen Kolonialpolitik, dass sich britische Staatsbürger mit Einheimischen aus den Kolonien mischten, also heirateten und Familien gründeten. Jedenfalls schlossen wir das aus der Reserviertheit der restlichen Briten an Bord gegenüber diesem Paar.
Schwer beeindruckt von diesen süßen exotischen asiatischen Geschöpfen berichtete ich in meiner Post nach Hause darüber, schwärmte etwas von „Rassemädchen“, Heiraten und mit nach Deutschland nehmen. Willis Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Doch warum musste er immer zu so einem Blödsinn seinen Kommentar geben? Warum merkte der alte Herr nicht, dass ich ihn nur provozieren wollte? Wieder ein Fall für den Psychologen!
Übrigens, der Chef hatte ab diesem Jahr wieder Arbeit. Ein gewisser Herr Blank, seines Amtes erster deutscher Verteidigungsminister nach dem Kriege unter Konrad Adenauer, stellte eine Bundeswehr auf, im Auftrage der Nato, wohlgemerkt. Ein Herr Franz-Joseph Strauß hatte Monate vorher noch laut gedröhnt, kein deutscher Mann sollte je wieder eine Waffe in die Hand nehmen! Und plötzlich war das alles vergessen. Und einer unter den ersten Bewerbern im Cuxhavener Raum war auch uns’ Vatter. Natürlich war er vorher schon entnazifiziert worden. Und er wurde auch genommen. Zu seinem Bedauern durfte er leider keine Uniform mehr tragen, die mit dem kleinen Dolch an der Seite. Das hatte er später immer wieder beanstandet, obwohl er ab diesem Zeitpunkt einen krisensicheren Job hatte. „Willi, was willst du mit dem Dolche sprich? Die Bleistifte anspitzen, mehr hoffentlich nicht!“
Während die Hafenarbeiter in Singapore Malayen waren, bestand das Corps der Schiffsvorleute hier aus Briten. Die Stevedoring Company und die Hafenbehörde gaben den Ton an. Die Organisation und Zusammenarbeit lief hervorragend. Wenn „teatime“ war, war „teatime“. Very british of course!
Am 22. Februar 1956 hatten wir Singapore bereits wieder verlassen. Unser Ziel war jetzt Manila auf den Philippinen. Unser Kurs führte zunächst ONO von der Singapore-Straße durch die Natuna-See bis zur Passage zwischen Pulau Natuna Besar an Backbord und Pulau Subi Besar an Steuerbordseite.
Quelle: LLOYD’s MARITIME ATLAS of world ports and shipping places, twenty-first Edition
Von dort aus ging es durch das Südchinesische Meer, durch die Palawan-Passage fast NNO nach Manila. Die Distanz betrug 1.341 sm, also bei unserer Reisegeschwindigkeit von 18 kn sollten wir es in 74,5 Stunden oder drei Tagen und zwei Stunden schaffen. Also am 25. Februar würden wir in die Bay of Manila einlaufen. Und das packten wir leider nicht. Wahrscheinlich hatte die BAYERNSTEIN doch nur 17 kn gemacht, denn wir liefen erst am 27. Februar 1956 morgens zwischen 02:00 und 03:00 Uhr ein. Möglich, dass die Strömungsverhältnisse uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. Am Wetter hatte es nicht gelegen, denn das war fantastisch für die Tropen.
Am 26. Februar hatte Kurt Tietjen Geburtstag, und zu unserem Erstaunen ließ er sich nicht lumpen: Jeder Mann von seiner Deckscrew bekam vier Flaschen Bier. Und bei 32° C im Schatten zischte es dann auch richtig durch die Kehle, als wir es nach dem Mittagessen tranken. Aber lieber wäre es uns gewesen, wir hätten zutörnen dürfen. Jeder brauchte Geld, denn jeder von uns hatte Wünsche auf dem Zettel, wenn wir nach Japan kommen würden. Mein Vater wollte einen Koffer haben, weiterhin ein Fernglas. Ich wollte für mich ein Teeservice kaufen, und ich dachte an „heiß baden“, denn davon redeten die schon länger an Bord weilenden Kollegen, nein sie schwärmten davon. Man würde sonst etwas verpassen. Und wer will schon im glorreichen Alter von 21 Jahren etwas verpassen? Ganz bestimmt nicht in Japan. Wie ich aus einem Brief meines Bruders, den ich in Manila erhalten hatte, entnahm, lag er mit dem Klütenewer, auf dem er angemustert hatte, im dicken Eis in Grünendeich fest eingefroren auf der Lühe an den Pfählen. Es musste damals 1956 ein schlimmer Winter in Norddeutschland gewesen sein. Angeblich hatten sogar Schiffe mit 10.000 tw auf Elbe und Weser große Schwierigkeiten mit der Eisfahrt gehabt. Wenn er 1956 auf meine Bitte hin rechtzeitig hier mit als Moses eingestiegen wäre, dann hätte er sich die „koolen Feut“ ersparen können. Aber Vaters bester Sohn wusste ja alles besser. Nun, sollte er sich ruhig den Mors und die Nüsse abfrieren!
Jetzt, ab Manila, kam eine Zeitspanne, in der ich mich nicht mehr schriftlich zuhause gemeldet hatte. Die Rundreise ab Hongkong, mit meinen Erlebnissen in den Häfen von Japan, der Volksrepublik China und zurück gipfelte in meinen ersten persönlichen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht in Ostasien, also Erotik total. Da ich auf dieser Reise 21 Jahre alt geworden war, also voll verantwortlich für meine Erfahrungen im ostasiatischen Raum war, meinte ich, nicht unbedingt Rechenschaft gegenüber dem Familienclan ablegen zu müssen. Meine Eltern daheim waren große Operettenanhänger, und besonders Franz Lehar hatte es ihnen angetan. Madam Butterfly und so’n Gedöns. Auch ich kenne diese Melodien, hatte in den 1950gern sogar einen amerikanischen Film über Madam Butterfly gesehen. Mit anderen Worten, ich sah das kommende Japan ein bisschen durch die rosarote Brille von Franz Lehar. Naja, ich war immer ein hoffnungsloser Träumer in punkto Frauen.
Ich überspringe den Hafen von Hongkong, in dem wir auch nur zwei Tage lagen. Jetzt lag Japan voraus mit den Häfen Yokohama, Nagoya und Kobe. Und, wie gesagt, während der Reise dorthin, außen um Taiwan herum, wurde die Deckscrew bereits in zwei Hälften unterteilt. Die einen durften in Yokohama an Land gehen, und die andere Hälfte zog es vor, in Kobe Landgang zu haben. Die Spannung stieg an. Natürlich kann ich heute nicht mehr genau nachvollziehen, wann wir in Yokohama ankamen, doch Dank Reed’s Marine Distance Tables konnte ich herausfinden, dass die Distanz von Hongkong bis Yokohama 1.584 Seemeilen beträgt. Also, diese Distanz durch unsere Marschfahrt von 17 kn geteilt, wären demnach 93,2 Stunden oder 3 Tage und 21 Stunden und vielleicht sogar mehr, da wir damals um Taiwan herum fahren mussten. Sagen wir vier Tage Fahrt, bis wir in Yokohama festmachen konnten. Das wäre der 7. März 1956 gewesen. Das geheimnisvolle Japan empfing uns mit offenen Armen.
Die Heimat von Madame Butterfly
Quelle: LLOYD’S MARITIME ATLAS of world ports and shipping places, page 45
Und dann kam sie, aber nicht Madame Butterfly, nein, zuerst kam „Mama San“. Auch noch nicht einmal eine japanische Mama San, sondern eine deutsche. Ich nenne sie mal Rosamunde Pilschke aus Sachsen. In ihrem Schlepptau drei bildhübsche, knusprigjunge, um die 17 bis 18 Jahre alte Japanerinnen.
Und sie kamen das Fallreep empor an Bord. Rosamunde begrüßte uns auf Deutsch und verteilte Visitenkarten und Stadtplanauszüge mit Hinweisen, wo man ihre Kneipe finden konnte. Natürlich wurde sie von uns eingekreist, bestaunt, willkommen geheißen.
Der Bootsmann kannte sie anscheinend schon länger, denn sie begrüßten sich freundlich. „Willst wohl meine Jungens verführen?!“ Worauf sie antwortete: „Keiner soll verführt, sondern nur bewirtet werden! Ein bisschen deutsche Gemütlichkeit!“ „Kenn ich, kenn ich!“ konterte der Bootsmann lachend, „aber erst müssen sie den Dampfer noch löschklar machen, da geht kein Weg dran vorbei, Rosi!“ Rosi verschwand lachend mit den drei Mädchen in ihrem Taxi. Wir standen alle noch mit ihren Visitenkarten in der Hand an Deck und waren in Gedanken bereits an Land.
Wer war diese ominöse Rosamunde Pilschke? Sie war eine Ex-Nachrichtenhelferin, die über einen Verbindungsstab der Reichsmarine in Japan stationiert war, und die in Japan schifflosen Besatzungen der Reichskriegsmarine, deren schwimmende Untersätze von den Alliierten versenkt worden waren, betreute, Unterkünfte und Verpflegung organisierte, weiterhin für den Rücktransport mittels U-Booten nach Deutschland zu sorgen hatte, solange noch deutsche U-Boote nach Japan durchkamen. Nach der Kapitulation der Japaner wäre sie beinahe in amerikanische Gefangenschaft geraten. Sie heiratete ihren japanischen Verbindungsoffizier zur Reichskriegsmarine, und beide tauchten unter. Als sich die Lage nach 1945 beruhigt hatte, kauften sich beide eine Hafenkneipe und verpflichteten junge elternlose japanische Mädchen, bei ihnen als Animiermädchen zu arbeiten. Und als die ersten deutschen Schiffe nach dem Kriege wieder in Japan auftauchten, spezialisierte sie sich hauptsächlich auf das „liebevolle Einfangen“ deutscher Seeleute, die sie an Bord ihrer Schiffe besuchte und in ihre Kneipe – ihr „privates deutsches Seemannsheim“ - einlud. Deutsche Seeleute hatten in der Regel einen guten Ruf bei den japanischen Mädchen, also nett und freundlich zu den kleinen Damen zu sein. Falls man nicht nur zum Trinken in die Kneipe gekommen war, sondern auch die Chemie zwischen Hein Seemann und der kleinen Butterfly stimmte, dann konnte man die begehrte Auserwählte bereits vorher bei der schönen Rosamunde auslösen und mit ihr in ein empfohlenes Apartment entfleuchen. Und, wenn dann bei denen, die vorher monatelang nur in einer wilden Männergesellschaft gelebt hatten, die Hormone beim Landgang verrückt spielten und der Überdruck ein gewisses Organ anschwellen ließ, dann galt das Sprichwort: „Wenn die Nudel steht, ist der Verstand im Arsch!“ Aber auch das musste man wieder in den Griff bekommen. Und deshalb die Taxifahrt zu Rosamundes Kneipe „Zum rostigen Anker“ (auf Japanisch kann ich das nicht übersetzen). Und schon beim Eintritt in ihre Kneipe, wurden einem die Knie richtig weich. Welch eine Augenweide, viele Rehe in der Nähe, sogar ganz nah. Und was für Rehe! Seeleute mit Herzschrittmachern wären schon am ersten Tisch eingeknickt. Welch charmante Elfen einem da zulächelten, einen willkommen hießen! Unwillkürlich setzten bei mir Herzrhythmusstörungen ein. Bloß nicht schlappmachen! Erst einmal ein japanisches Bier trinken, abkühlen! „Be cool“ sagt man heute. Aber wer die Wahl hat, hat auch die Qual bei diesem Angebot von zirka 20 auserwählten Grazien, die uns so gerne Gesellschaft leisten, unsere trübseligen Gedanken wegpusten wollten, die uns so zärtlich in die Augen schauen konnten und so einen Liebesreiz ausstrahlten, dass man freiwillig eine Flasche Sekt schmiss, Madre mia. Alles in deutschen Händen, aber zittrigen Händen. Und beim Tanzen schmiegten sie sich so eng an einen, dass einem schwarz vor Augen wurde. Und küssen konnten die Mandelschnuten, das waren Voltladungen, die einem vom Kopf bis zu den Zehen durch den Körper zuckten. Irgendwann gegen 22:00 Uhr konnte ich nicht mehr, ich wollte mein Turteltäubchen nicht verlieren und zog die Notbremse. „Mama San, was kostet meine Perle für diese Nacht?“ Und Rosamunde kam gleich zum geschäftlichen Teil, als sie meine Lolliaugen sah. Nein, nicht mehr zum nächsten Bier, gleich zum „Heiß baden” wollte ich kommen. Okay, heute ist Zahltag. Und Rosamunde lächelte ihrem Mädchen zu. „Treibt es nicht zu dolle, ich brauch die Kleene noch!“ Und so entschwanden wir, die anderen später nach mir. Halb zog sie mich, halb sank ich hin, und sie tauchte mit mir in einem kleinen Hotel unter, wo wir uns für den Rest der Nacht ein Apartment mieteten.
Ich war überrascht, was für ein modern eingerichtetes Apartment es war. Es bestand aus einem einladenden Aufenthaltsraum, einem hübschen Schlafzimmer und einem wahnsinnig fantasievoll eingerichteten Bad. So eine sturmfreie Bude in Deutschland, vielleicht in Bremerhaven oder Bremen, also nicht in Cuxhaven unter den Augen meiner Eltern, und ich wäre der King gewesen! Aber dann hätte ich diese Kleine auch noch mit nach Deutschland gebracht.
Und hier eine Skizze vom Schlafzimmer des Apartements
Und so hatte der japanische Innenarchitekt das Badezimmer eingerichtet, die Badewanne versenkt in echtes schwarzes Lavagestein, die Wasserhähne versteckt in Lavabrocken, das Ganze sah wie ein geologisches Kunstwerk aus.
Und als der Sealord Klaus Perschke gleich zur Sache schreiten wollte, wehrte sich meine Madame Butterfly: „We do first old japanese tradition, first hot bath. You will be very fit afterwards.” Und schon ließ sie ziemlich warmes, ich möchte sogar sagen, ziemlich heißes Wasser in ein typisch japanisches Sitzbad einlaufen, bis es dreiviertel voll war. Irgendwelche Kräuteressenzen, die angenehm nach Sandelholz dufteten, weckten meine Geister. Und als ich wieder meinen Überdruck nicht bändigen konnte, drückte mich dieses kleine Persönchen in diesen japanischen Kochpott. Ich hatte echt das Gefühl, ich werde wie eine Weihnachtsgans gebrüht und fing an zu stöhnen. Das war ein Schock! Doch kein Pardon, denn jetzt erst fing die Schrubberei an. Das tat gut, nur mir wurde richtig schwarz vor den Augen. Sie war in ihrem Element. Sie war eine Meisterin in der Kunst, Männer zu betören, ich war besiegt. Warum bekommt man diese „Japanese-hot-bath“-Kuren nicht von der Seekasse in Deutschland bewilligt? Warum nicht? Die Seekasse weiß garantiert nicht, was wirklich gesund ist für ihre zur See fahrenden Mitglieder. Und warum war mein dummer Bruder nicht zum Norddeutschen Lloyd nach Bremen gefahren und hatte sich für die BAYERNSTEIN vormerken lassen? Er hätte garantiert anmustern können und hätte das alles auch erleben dürfen. Stattdessen saß er jetzt mit seinem kalten Arsch vorn unter der Back auf seinem ohne Kohlen an Bord eingefrorenen Klütenewer auf einem eiskalten Kanonenofen und klapperte sich einen ab. Für Gott und Willi! Das war seine Strafe!
Ja, ich hatte mein Herz in Yokohama verloren! Und jetzt möchten Sie, verehrter Leser, wissen, wie die Geschichte noch ausging? Ich muss Sie enttäuschen. Das ist mein kleines, persönliches Geheimnis, das ich nur für mich behalte. Dieses Rumprotzen mancher Kollegen, wie sie es mit wem getrieben haben, liegt mir nicht. Ich bin bei diesem Thema eher ein Romantiker. Diese Typen gibt es auch unter den Seeleuten. Und diese Stunden in Japan waren hochromantisch. Wie gesagt, ich hatte echt mein Herz in Yokohama verloren. Das soll tatsächlich noch vorkommen in der so genannten christlichen Seefahrt. Auch Seeleute sind nur Menschen.
Aber meine Eindrücke über das Apartment, wie es ausgestattet war, die hatte ich am nächsten Morgen, kurz bevor wir die Stätte Amors verließen, noch schnell in einem kleinen Skizzenblock verewigt. Und diese Skizzen kann ich dem verehrten Leser hier noch zeigen. Wie bereits erwähnt, so hätte ich mir meine Junggesellenbude in Deutschland eingerichtet, wenn ich die Goldstücke oder D-Märkerchen auf meinem Sparbuch gehabt hätte. Das Leben ist doch manchmal ungerecht. Die einen zünden sich aus lauter Langeweile mit einem Fünfziger eine Zigarre an, die anderen müssen ihre Märker zusammenkratzen und sparen, damit sie während der Schulzeit über die Runden kommen. Bafög gab es 1957 für Seefahrtsschüler noch nicht. Auf solche Ideen kamen die so genannten christlichen Finanzminister der Adenauer-Regierung nicht.
Keiko Fujinaka hieß also mein kleines Butterfly. Und offenbar empfand sie Sympathie für ihren Verehrer aus Deutschland, der so verschossen in sie war.
Am nächsten Morgen, nachdem ich ihr noch diskret ein kleines Extra-Dankeschön gegeben und sie mir ihre private Adresse gegen meine Schiffsanschrift ausgetauscht hatte, brachte sie mich zum nächsten Taxistand. Zum Abschied hatte ich sie mit meinem schlesischen Temperament noch einmal ganz doll gedrückt und geküsst, dann ging es solo zurück. Sogar ein bisschen traurig war ich. Seemann, wo ist deine Heimat, dachte ich. Mich hatte es arg erwischt damals.
Gerade noch rechtzeitig zum Umziehen und Auftauchen zum Frühstück in der Mannschaftsmesse, kam ich an Bord zurück. Und Bootsmann Tietjen zählte die Häupter seiner Lieben ganz genau an diesem Morgen, besonders derer mit den Lolliaugen. Und da saßen doch etliche mehr, als ich dachte. Yokohama war ein Rausch! Man schwebte immer noch wie auf Wolken über Deck. Damit wir etwas außer Sicht der Obrigkeit blieben, mussten wir in die Zwischendecks abtauchen und Stauholz zu Hieven zusammenstapeln. Ich war immer noch ein wenig durcheinander von dem Kulturschock, den ich erlebt hatte. Meine Gedanken eilten mir voraus. Was wäre, wenn sie mit nach Deutschland kommen würde? Hah, mein Vater, der Obermufti des Perschke-Clans, würde schon dafür sorgen, dass diese Art Halluzination ganz, ganz schnell geheilt werden würde, wenn ich wieder zuhause sein würde. Dafür verwette ich meinen Arm.
Ich glaube, drei Tage blieben wir noch in Yokohama. Unser Auslauftag war vermutlich der 9. März 1956. Ob wir bereits Ladung für die Heimreise mitgenommen hatten, daran kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Mit solchen Lolliaugen sind die Gedanken woanders. Aber ich weiß, dass Nagoya, die alte japanische Kaiserstadt, unser nächste Hafen war. Dort lagen wir allerdings auch nur einen Tag. Kein Landgang für die gesamte Besatzung, außer dem Arzt. Von Nagoya fuhren wir weiter nach Kobe. Und in Kobe marschierte dann die andere Hälfte der Deckscrew an Land zum „Heißbaden“! Ohne Krankenschein, alles privat bezahlt. Der Japanaufenthalt hatte etwas Heilendes für die entzugsgeschädigte Psyche der Besatzung. Alle waren sie wieder ausgeglichen, zufrieden, tolerant, nach dem Motto: „Seid nett zu einander, wir sind doch alle Brüder“. Und am meisten zufrieden war der Bootsmann mit seiner Sportgang, denn eine zufriedene Crew bedeutet immer: kein Zoff, kein Aufkeimen von Differenzen. Keine Diplom-Psychologin hätte das so gut hinbekommen wie unser Scheich. Der Laden von Kurt Tietjen lief gut. Natürlich war durch die unverhoffte Geldaufnahme für den Landgang bei jedem das persönliche Budget für den Rest der Rückreise ziemlich geschrumpft. Also keine kleinen Geschenke für die Lieben zu Hause, z. B. ein Kimono aus Seide für die Schwester oder das Teeservice für die Eltern. Nicht auf dieser Reise. Jetzt war sparen angesagt. Für alle. Besonders schmerzlich war es für die Kollegen, die im kommenden Jahr zur Seefahrtsschule gehen wollten, also auch für mich.
Nach unserer Hafenliegezeit in Kobe führte die kommende Heimreise zuerst ins chinesische Arbeiterparadies. Und das hieß und heißt heute noch: Volksrepublik China.