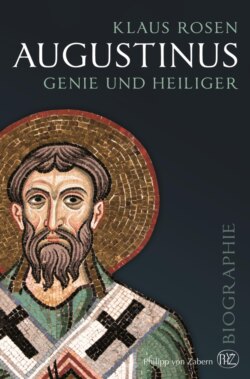Читать книгу Augustinus - Klaus Rosen - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. Der Professor in Mailand
ОглавлениеAm 23. Mai 376 regelte Kaiser Gratian in einem Gesetz die staatlichen Vergütungen, die Grammatik- und Rhetoriklehrer in den Städten Galliens erhalten sollten. Die Einkünfte wurden in annonae angegeben, eigentlich Getreiderationen, die nach einem bestimmten Schlüssel in Barzahlungen umgerechnet wurden. Griechische und lateinische Grammatiker erhielten demnach aus der Staatskasse jährlich zwölf annonae, Rhetoren vierundzwanzig annonae. Für ausgewählte Spitzenkräfte, die in der Residenzstadt Trier unterrichteten, gab es eine ‚Hauptstadtzulage‘: für die lateinischen Grammatiklehrer, nicht jedoch die griechischen, waren das acht annonae, für die Rhetoriklehrer sechs annonae. Dazu kamen die Gehälter aus dem Stadtsäckel, deren Höhe der Kaiser den einzelnen Städten ausdrücklich freistellte. Von den Studiengebühren schwieg der Gesetzgeber. Auch sie werden von Stadt zu Stadt unterschiedlich gewesen sein.1 Der Beruf des staatlichen Lehrers der Rhetorik war auch deswegen begehrt, weil er seit langem mit Steuerfreiheit und Befreiung von öffentlichen Lasten verbunden war. Konstantin der Große hatte diese Privilegien ausdrücklich in zwei Gesetzen bestätigt.2
Als Augustinus nach dem Ende der Sommerferien 384 in Mailand sein Amt antrat, war er mit einem Mal seine finanziellen Sorgen los. Er mietete ein geräumiges Haus, und da der Besitzer anderswo wohnte, durfte er auch den zugehörigen Garten benutzen.3 In den „Bekenntnissen“ eröffnete er den neuen Lebensabschnitt allerdings nicht mit diesen Alltäglichkeiten, sondern nannte sogleich die Persönlichkeit, die für seine geistige Zukunft wichtig wurde: „Und ich kam nach Mailand zu Bischof Ambrosius“.4 Das war ein Vorgriff, der für längere Zeit nur bedingt richtig war. Ambrosius, der aus dem römischen Senatsadel stammte und dessen verstorbener Vater Prätorianerpräfekt der gallischen Provinzen gewesen war, stand seit einem Jahrzehnt an der Spitze der katholischen Kirche der Residenzstadt.5 Als Statthalter der Provinz Aemilia-Liguria war er an seinem Amtssitz von den Mailänder Christen 374 zum Bischof gewählt worden, obwohl er nicht einmal die Priesterweihe empfangen hatte. Mittlerweile war er einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigste Kirchenfürst im Westen des Reiches. Mit dem 383 ermordeten Kaiser Gratian hatte er auf gutem Fuß gestanden und ihm auf seine Bitte hin mehrere theologische Werke verfasst. Als der zwölfjährige Valentinian II. nach dem Tod seines Halbbruders Gratian Alleinherrscher über den Westteil des Reiches wurde, empfahl ihn seine Mutter Justina sogar der Obhut des Bischofs.6 Die Hofbürokratie musste mit Ambrosius rechnen, sooft Verwaltungsmaßnahmen lokale oder allgemeine Belange der katholischen Kirche berührten. Allerdings klagte er gelegentlich selbst, er wisse nicht, was am Kaiserhof vorgehe.7
Auch die Bestallung des Rhetorikprofessors Augustinus ging an Ambrosius vorbei. Andernfalls hätte er sich im heimatlichen Rom gewiss nach der Religion des Kandidaten erkundigt und rasch Widerspruch gegen den in manichäischen Kreisen bestens bekannten Africaner eingelegt. Stand doch zu befürchten, dass er der Jugend in Mailand, um deren katholische Erziehung der Bischof bemüht war, nicht nur die Kunst der Rede beibringen, sondern sie in seinen Vorlesungen auch mit gefährlichen häretischen Äußerungen verderben werde. Ambrosius’ heidnischer Verwandter Symmachus, der in den folgenden Jahren mehrere Bitt- und Empfehlungsbriefe an ihn richtete, fühlte sich 384 ebenfalls nicht bemüßigt, ihn über die Kriterien zu benachrichtigen, nach denen er sich für Augustinus entschieden hatte.8
Augustinus mochte den Namen Ambrosius schon einmal gehört haben. Aber nicht der Bischof interessierte ihn, sondern der Redner, „der auf der ganzen Welt als einer der besten bekannt war“.9 Er würde sich in Zukunft selbst davon überzeugen, ob Ambrosius seinen Ruf verdiente. Diese Absicht, die er sich auf der Reise nach Norden vorsagte, war der nächstliegende Anlass für den obigen einleitenden Satz: „und ich kam nach Mailand zu Bischof Ambrosius.“ Einmal in der Stadt angekommen konnte es gar nicht ausbleiben, dass ihm immer wieder der Name des Bischofs begegnete, der nicht nur im kirchlichen, sondern auch im öffentlichen Leben fast schon die Rolle eines Stadtherrn spielte. Zunächst nahm den Neuling jedoch der Beruf in Anspruch.
Zu den Pflichten des Professors für Rhetorik gehörte, bei Feierlichkeiten des Hofes oder der Stadt die Festrede zu halten. Ein Anlass wurde Augustinus bald nach der Ankunft mitgeteilt: Am 1. Januar des folgenden Jahres werde der Heermeister Flavius Bauto Konsul werden. Sein Kollege im Ostteil des Reiches werde Arcadius in Konstantinopel sein, der Sohn und Mitregent des Kaisers Theodosius. Dass der neue Konsul an diesem Tag eine Dank- und Lobrede auf den Kaiser hielt, hatte eine lange Tradition. Der Panegyrikus des jüngeren Plinius vom Jahr 100 war nicht nur das bekannteste, sondern zugleich das stilbildende Beispiel. Aber Bauto war, wie sein ursprünglicher Name verriet, ein Franke, von dem man nicht erwarten konnte, er werde die Tradition fortsetzen. Also war der neue staatliche Rhetoriklehrer gefordert. Die Aufgabe war delikat, und das nicht nur wegen der Abstammung des zu Ehrenden. Trotz seines römischen Bürgerrechts, das sein Familienname Flavius dokumentierte, war er nach konservativer Auffassung immer noch ein barbarus. Am Kaiserhof und beim Adel hatte Bauto sich während seines Aufstiegs zum Heermeister viele zu Feinden gemacht, die ihm seine Macht neideten oder sie fürchteten. Die beiden Briefe, die ihm Symmachus während des Konsulats schrieb, waren ein beredtes Zeugnis.10 Den Bischof Ambrosius verärgerte er, weil er im Herbst 384 zu denen gehörte, die Valentinian II. aufforderten, er möge Symmachus und dem Senat erlauben, die Victoriastatue in der Kurie wieder aufzustellen.11 Ob Bauto mehr Christ oder mehr Heide war, wusste man nicht genau.
Augustinus begegnet vornehmen Mailändern.
Zu den Themen im rhetorischen Unterricht gehörten die Mittel und Wege, wie man in einer Lobrede gefährliche Klippen umschiffte und selbst dort schöne Worte machte, wo es eigentlich nichts zu sagen gab oder wo der Redner bei einem Teil des Publikums leicht Stirnrunzeln hervorrufen konnte. Zum Glück für Augustinus bot Bautos erfolgreiche militärische Laufbahn Stoff genug, um ihn als großen, mehr noch, als den größten römischen Feldherrn herauszustellen. 383 war er dem gallischen Usurpator Magnus Maximus, der in Italien einfallen wollte, an den Alpenpässen entgegengetreten, und 384 hatte er suebische Juthungen, die Rätien heimsuchten, mit hunnischen und alanischen Hilfstruppen vertrieben.12 Zahlreiche Hörer, unter ihnen sicher Kaiser Valentinian und die hohen Beamten am Hof, folgten den Ausführungen des Festredners.13 Alle waren von Augustinus’ Kunst beeindruckt, sodass der Wunsch laut wurde, er möge auch die Rede zum zehnjährigen Regierungsjubiläum des Kaisers am kommenden 22. November halten. Vielleicht gab Valentinian selbst den Anstoß.14
In den „Bekenntnissen“ überging Augustinus die Rede auf Bauto, nicht dagegen die Preisrede zu Ehren Valentinians, denn auf sie und auf das Lob, das sie ihm einbrachte, war er besonders stolz. Aber weil Stolz auf den Beifall der Menschen eine Sünde ist, wie er in einem eigenen späteren Kapitel der „Bekenntnisse“ ausführte, fühlte er sich bemüßigt, seinen damaligen Erfolg und die eigene Kunst nachträglich schlecht zu reden: Er habe in die Verherrlichung Valentinians zahlreiche Lügen gepackt, um sich die Gunst derer zu verschaffen, denen diese Lügen nicht entgingen.15 Andererseits: Welche großen Taten gab es denn von einem vierzehnjährigen unselbständigen Knaben auf dem Kaiserthron zu berichten, der von der Kaiserinmutter Justina gegängelt wurde? Man konnte eingangs die Leistungen seiner Vorfahren aufzählen und die guten Anlagen in den Himmel heben, die sie ihrem Nachkommen vererbt hatten. Danach dessen eigene Politik zu rühmen war ein Eiertanz. Die anwesenden hohen Beamten, die an den politischen Entscheidungen im Kaiserhaus beteiligt waren, wussten das, und sie zollten dem Redner ihre Anerkennung für das Geschick, mit dem er sich seiner Aufgabe entledigt hatte. Er war die geeignete Stimme, deren man sich bei ähnlichen Anlässen wieder bedienen würde. Augustinus konnte sich fortan einiger „hochgestellter Freunde“ rühmen. Wieviel diese Freundschaften wert waren, musste sich zeigen, wenn er sie zum Anlass für eine Bitte nehmen würde.16
Unter den Zuhörern, die sich zum kaiserlichen Thronjubiläum versammelten, befand sich gewiss Bischof Ambrosius, der sich als Diplomat um Valentinians Herrschaft große Verdienste erworben hatte: Zweimal war er in dessen Auftrag nach Trier gereist, um Friedensverhandlungen mit dem Usurpator Magnus Maximus zu führen.17 Hatte Augustinus erfahren, dass Ambrosius kommen werde, und war er deswegen vor seinem Auftritt so aufgeregt, dass sein Herz „wegen dieser Sorgen stöhnte und unter fiebrigen Ohnmachtsgedanken raste“? Denn inzwischen hatte er den Bischof predigen hören und wusste aus eigener Erfahrung, dass ihm ein Meister des Wortes gegenübersitzen werde. Auf dem Weg zur Festfeier war dem Festredner ein Bettler begegnet, den der Alkohol in fröhliche Stimmung versetzt hatte. Für einen Augenblick beneidete er ihn, und vor seinen Begleitern verfluchte er seinen Ehrgeiz, der ihn von den kleinen billigen Freuden des Lebens abhielt.18 Auch als ihm nach dem Vortrag ein Stein vom Herzen fiel, vergaß er die Episode nicht. Aber würde er jetzt noch mit dem Bettler tauschen wollen, nachdem er sich so gut geschlagen hatte und sich unter den Rednern der Residenzstadt als die Nummer Eins fühlen durfte?
Persönlich war Augustinus dem ‚Fürstbischof‘ Ambrosius inzwischen begegnet. Bald nachdem er in Mailand eingetroffen war, hatte er Gelegenheit, sich ihm vorzustellen. Ambrosius empfing ihn mit der väterlichen Freundlichkeit des volksnahen Bischofs. Aber mehr als die üblichen höflichen Worte, er freue sich über die Ankunft des Professors, sprach er nicht. Wenn Augustinus fortan Zeit hatte, Ambrosius’ Predigten oder öffentliche Reden zu verfolgen, analysierte er für sich dessen vielgerühmte rhetorische Kunst. Bisher hatte ihm als Muster eines einnehmenden Redners der manichäische Bischof Faustus gegolten, der mit Witzen und Schmeicheleien das Publikum auf seine Seite zog. Solche Mätzchen hatte der Aristokrat Ambrosius nicht nötig. Er schlug die Hörer mit der „Anziehungskraft“, der suavitas, seiner Rede in Bann.19 Cicero hatte in der Schrift „Die Redeteile“ aufgezählt, welche Themen ein Redner behandeln müsse, um „Anziehungskraft“ zu entfalten: „Erstaunliche und spannende Dinge, unvermutete Lösungen und eingestreute Gemütsbewegungen, direkte Reden und Gegenreden, Schmerzempfindungen und Zornesausbrüche, Ängste, Freuden und Leidenschaften.“20
Aufbau und Stil, Wortwahl und Satzbau, Haltung und Intonation des Redners – all diese Äußerlichkeiten studierte Augustinus an Ambrosius. Sie hatte er auch seinen Studenten beizubringen. Die Inhalte, die der Bischof vermitteln wollte, überhörte er zunächst. Von ihnen würde er in seinen Vorlesungen ja ebenfalls nicht handeln. Was kümmerte ihn, wenn Ambrosius auf die Unterschiede zwischen Katholiken und Arianern zu sprechen kam? War die Frage, ob Christus Gott gleich oder ungleich, ob er ihm ähnlich oder unähnlich war, nicht ein Streit um Worte über ein Problem der Metaphysik, das kein Mensch zu lösen vermochte? War Auxentius, der Vorgänger des Ambrosius, nicht Arianer wie die Kaiserin Justina? In Mailand gab es eben zwei christliche Konfessionen. So sehr den Skeptiker Augustinus die Form von Ambrosius’ Reden begeisterte – „ihrem Inhalt stand ich uninteressiert und voll Verachtung gegenüber“.21
Doch gehörten in einer guten Rede nicht Form und Inhalt zusammen? Hatte Augustinus sich dieses Credo Ciceros nicht schon als Student in Karthago zu eigen gemacht? Erst recht merkte er auf, wenn Ambrosius von der Wahrheit seines katholischen Glaubens sprach. Mit dem Anspruch auf Wahrheit hatten ihn ja einst die Manichäer geködert, und er war jahrelang überzeugt gewesen, dass ihre Wahrheit die wahre sei. Als kluger Professor konnte er zumindest einmal probehalber beide Wahrheiten miteinander vergleichen. Dazu aber musste er nicht nur für das Wie, sondern auch für das Was in den bischöflichen Verlautbarungen seine Ohren – in den „Bekenntnissen“ sagte er: sein Herz – öffnen.22
Ein weiterer Anstoß, das zu tun, kam von unerwarteter Seite: Eines Tages tauchte überraschend Monnica in Mailand auf. Noch immer tat dem Sohn leid, wie er sich im Hafen von Karthago mit Lug und Trug von ihrer Mutterliebe befreit hatte. Jetzt war die Gelegenheit gekommen, sein schlechtes Gewissen ein wenig zu entlasten. Er tat es mit dem Geständnis, er sei kein Manichäer mehr.Er befinde sich aber zurzeit auf der Suche nach der Wahrheit, weshalb er auch noch kein Katholik sei. Monnicas Begeisterung über ihren Wahrheitssucher hielt sich in Grenzen. Doch immerhin hatten ihre Tränen und Gebete einen Teilerfolg errungen. Noch vor ihrem Tod, so prophezeite sie, werde daraus ein voller Erfolg werden. Hatte sie auf dem Weg nach Italien mit ihrer Prophezeiung nicht ebenfalls Recht behalten? Ihr Schiff war in einen Sturm geraten, und sie ermutigte die ängstlichen Matrosen, ein Traumgesicht habe ihr versichert, sie würden sicher ihr Ziel erreichen. Bibelkundige erinnerte die mutige Reisende an den Paulus der Apostelgeschichte, dem nach einer Havarie zwischen Kreta und Malta nachts ein Engel erschien und der daraufhin der Besatzung und den Passagieren versprach, keinem werde ein Haar auf seinem Kopf verloren gehen.23
Als Monnica erfuhr, ihr Sohn höre regelmäßig die Predigten des Bischofs Ambrosius, wusste sie, welchem Helfer sie sich andienen müsse. Fortan versäumte sie kaum einen seiner Gottesdienste, und wenn er predigte, hing sie an seinen Lippen, „an der Quelle, deren Wasser sich in das ewige Leben ergießt“. Ambrosius erschien ihr „wie ein Engel Gottes“, der ihren Augustinus bestimmt auf den rechten Weg führen werde.24 Bald fiel dem Bischof die fromme Africanerin auf, die nun auch begann, die Märtyrergräber rings um die Stadt zu besuchen, um dort, wie in ihrer Heimat üblich, Brei, Brot und Wein als Totenopfer niederzulegen. Gern schloss sie sich einer Gruppe von Märtyrerverehrern an und teilte mit ihnen, was sie an Ess- und Trinkbarem mitbrachte. Sie selbst blieb beim Alkohol stets mäßig, was man nicht von allen Teilnehmern an solchen Gedenkfeiern sagen konnte. Die Auswüchse veranlassten Ambrosius, Speise- und Trankopfer an Gräbern überhaupt zu untersagen, und Monnica gehorchte ohne Murren.25 Stattdessen versorgte sie arme Gottesdienstbesucher, was dem Bischof, der selbst nach Kräften das soziale Elend der Großstadt Mailand bekämpfte, sehr viel besser gefiel. Offensichtlich hatte sie in Thagaste Besitz verkauft oder verpachtet, brauchte daher ihrem Sohn nicht auf der Tasche zu liegen und konnte Ambrosius durch gute Werke beeindrucken. Sooft der Kirchenmann daher in der Folgezeit Augustinus über den Weg lief, stimmte er ein Loblied auf Monnica an und beglückwünschte ihn, dass er diese Frau zur Mutter habe. Welcher Sohn hätte das aus solchem Mund nicht dankbar gehört?
Bei seinem Dank verschwieg Augustinus, dass Ambrosius ihm mit seinen Predigten zwar Stoff zum Nachdenken gab, er aber keineswegs der Meinung war, von ihm schon die reine Wahrheit gehört zu haben. Noch überwog beim Professor die Skepsis. Würde sich das je ändern? Er habe sich in einer Krise befunden, beschrieb er nachträglich seinen damaligen Zustand, und er sei sich nicht sicher gewesen, nach welcher Richtung sich die Krise entwickeln werde.26 Eine Rückkehr zum Manichäismus war für den staatlich angestellten Professor auch deswegen ausgeschlossen, weil zwei Jahre zuvor Kaiser Gratian noch einmal Bestrafung all denen angedroht hatte, „die es einst vorgezogen haben, den unsäglichen Geheimlehren und verbrecherischen Abspaltungen der Manichäer zu folgen“.27
Augustinus spricht mit dem Heiligen Ambrosius.
Vielleicht konnte Ambrosius dem Suchenden im persönlichen Gespräch weiterhelfen. Gern hätte Augustinus daneben erfahren, wie der gestandene Mann aus dem römischen Hochadel mit dem Zölibat fertig wurde. Einen verbiesterten Eindruck machte er nicht. Auch war seine asketische Lebensweise, von der man sich in der Stadt erzählte, der beste Beweis, dass ihm sein Ansehen und seine Macht nicht zu Kopf gestiegen waren. Stärker noch als von der Verehrung, die die Mailänder Katholiken ihrem Bischof entgegenbrachten, war Augustinus von der Aufwartung beeindruckt, die ihm Standesgenossen seiner Herkunft nach machten, die nach Mailand kamen oder am Kaiserhof arbeiteten. Mehrmals beschloss er, Ambrosius um eine Unterredung zu bitten, und machte sich auf den Weg zu seinem Haus, dessen Tür stets offen stand. Doch immer stieß er dort auf eine Schar von Bittstellern, die dem Seelsorger ihre Anliegen vortrugen. Gelegentlich hatte er Glück und war der Erste in der Schlange. Dann sah er Ambrosius im Empfangsraum sitzen und konzentriert in einem Buch lesen. Fasziniert beobachteten er und die nachfolgenden Besucher den stummen Leser, und keiner wagte, ihn zu stören. Still entfernten sich alle nach einer Weile.28 Dass jemand beim Lesen nicht wie üblich den Text halblaut mitsprach, hatte Augustinus noch nie erlebt. Auf dem Heimweg machte er sich Gedanken über die ungewohnte Methode: Wollte sich Ambrosius nicht ablenken lassen und vermeiden, dass ihn ein Zuhörer unterbrach und bat, eine Stelle zu erläutern? Oder wollte er bei der knappen ihm zur Verfügung stehenden Zeit möglichst viel lesen und zog daher die stumme, weil schnellere Lektüre vor? Oder wollte der Redner seine Stimme schonen, die ihm zuweilen den Dienst zu versagen drohte? Augustinus hätte noch hinzufügen können, dass es Ambrosius mehr auf den Inhalt des Gelesenen ankam als auf die Sprachkunst des Verfassers. Zu ihr gehörten nicht nur Wortwahl und Satzbau, sondern vor allem die Klauseln, die rhythmischen Satzschlüsse, die man beim lauten Lesen genoss. Schließlich grub sich ein Text, den man hörend las, auch leichter ins Gedächtnis ein.29
Die folgenden Begegnungen blieben ebenfalls flüchtig und unverbindlich. Wollte Augustinus daher doch einmal so weit kommen, dass er „alle Knoten trügerischer Verkehrtheiten“ zu lösen vermochte, blieb ihm nichts übrig, als Sonntag für Sonntag Ambrosius’ Gottesdienst zu besuchen und den Inhalt seiner Predigten zu studieren.
Eines Sonntags sprach Ambrosius über Genesis 1,25: „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild.“ In Karthago war Augustinus einst in Verlegenheit geraten, als Manichäer ihre Ablehnung des Alten Testaments mit diesem Vers begründeten und spotteten, ob man sich demnach Gott als Mensch mit Haaren und Nägeln vorzustellen habe. Schon damals war ihm das Argument reichlich primitiv vorgekommen. Jetzt erfuhr er von Ambrosius, dass er sich mit seinem Vorbehalt in völligem Einklang mit der Lehre der Kirche befand, die selbstverständlich ebenfalls nie eine anthropomorphe Gottesvorstellung vertreten hatte. Ein wenig rührte sich im Zuhörer das verschüttete christliche Erbe, das er als Kind mitbekommen hatte.30
Sollte er nicht wieder einmal die Heilige Schrift zur Hand nehmen, die er vor Jahren in jugendlicher Überheblichkeit verächtlich beiseite gelegt hatte? Ambrosius fordert ihn mit seiner exegetischen Methode heraus. Wieder und wieder zitierte der Prediger das Pauluswort aus dem Zweiten Korintherbrief: „Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig“. Wenn folglich der Text, beim Wort genommen, unverständlich sei oder die Bibel sich in Widersprüchen zu verheddern scheine, müsse man nach dem tieferen geistigen Sinn fragen, um so zur Glaubenswahrheit vorzudringen. Aber Glauben ist nicht Wissen, wandte Augustinus im Stillen ein, um sich dann zu korrigieren: Glaubt der Mensch nicht auf Schritt und Tritt? Er nimmt gutgläubig anderen Menschen historische Ereignisse ab, die er selbst nicht erlebt hat. Ihn überzeugen Berichte über Länder und Städte, die er noch nie mit eigenen Augen gesehen hat. Sogar die eigene Herkunft muss er den Eltern glauben. Intellektuelle Redlichkeit gebietet daher zunächst einmal, der Heiligen Schrift ebensowenig den Glauben zu versagen und unvoreingenommen an die Lektüre heranzugehen. Besitzt deren einfache sprachliche Form, die ihn früher abgestoßen hat, nicht den unschätzbaren Vorteil, dass sie für jedermann verständlich ist, ohne ihren tieferen Sinn zu verlieren? Wenn dem aber so ist, dann muss ein Gott sich in ihr geoffenbart haben, der sich um die Menschen kümmert: „Das also glaubte ich damals bald stärker, bald schwächer.“ Noch schwankte Augustinus. Aber er hatte einen weiteren kleinen Schritt zurück zum Glauben seiner frühen Jahre getan.31
Augustinus und Alypius hören den Heiligen Ambrosius predigen.
Wenn der Zuhörer Augustinus sonntags aus der Kirche nach Hause ging, mündete sein Selbstgespräch, das soliloquium, in die Diskussion mit Freunden.32 „Denn wer ein wissenschaftliches Gespräch über das führt, was das Wahre ist, unterscheidet es durch das Gespräch vom Falschen“.33 Das war bester Platon, der in seinem „Staat“ Sokrates verkünden ließ, im Gespräch miteinander gelange man allein durch das Wort, den logos, zum Wesen der Dinge, „zu dem, was ein jedes ist“.34
Einer der Freunde war Flavius Mallius Theodorus, der in kaiserlichen Diensten bis zum Prätorianerpräfekten – dem höchsten zivilen Verwaltungsbeamten – aufgestiegen war und sich zwischen zwei Amtszeiten in seiner Heimatstadt Mailand aufhielt. Im Lauf seiner Karriere hatte er eine africanische Provinz verwaltet und vielleicht damals Augustinus’ Bekanntschaft gemacht. Dazu kam nun die gemeinsame Beschäftigung mit Plotin und mit der Frage, wie sich die platonische Philosophie zum Christentum verhalte. Theodorus hatte ebenfalls Predigten des Ambrosius („unseres Bischofs“) gehört und war danach wie Augustinus zu der Überzeugung gekommen, „man dürfe, wenn man an Gott denke, überhaupt nicht an irgendetwas Materielles denken, ebensowenig bei der Seele, die unter allem, was existiert, Gott am nächsten sei“. Augustinus erinnerte ihn daran in der Einleitung zu seiner Schrift „Über das glückliche Leben“, die er dem Freund widmete.35
Obwohl Augustinus in seinem „Revidierten Werkverzeichnis“ bedauerte, Theodorus, „der gelehrte Christ“, sei in der ihm gewidmeten Schrift zu gut weggekommen, meinte er in den „Bekenntnissen“ schwerlich ihn mit dem „ungeheuer aufgeblasenen Schwellkopf“, der ihm Schriften der Platoniker in der lateinischen Übersetzung des Marius Victorinus empfahl. Wieder einmal verschwieg er Namen, um nicht Männer zu verewigen, die ihm später nichts mehr bedeuteten. Immerhin führte ihn seine Lektüre zu der Erkenntnis, dass manche platonischen Gedanken mit dem Eingang des Johannesevangeliums übereinstimmten.36 Er war nicht der Erste, der die Übereinstimmung feststellte. Der Priester Simplicianus, Freund und Nachfolger des Ambrosius, dem Augustinus wenig später begegnete, zitierte einen Platoniker, der vorgeschlagen hatte, in allen Kirchen Johannes’ Eingangsworte mit goldenen Lettern an sichtbarer Stelle anzubringen.37 Simplicianus beglückwünschte ihn auch, dass er gerade die Bücher derjenigen platonischen Philosophen gelesen habe, „in denen auf jegliche Weise von Gott und seinem Wort die Rede sei“.38
Nicht ohne Hintergedanken erzählte Simplicianus dem Professor für Rhetorik, wie er in Rom den berühmten Philosophen und Rhetor Marius Victorinus auf seinem Weg zum Christentum begleitet habe: Der heidnische Redelehrer, der die noch weitgehend heidnische römische Aristokratie unterrichtete, habe im hohen Alter angefangen, die Bibel und die Kirchenväter zu lesen. Daraufhin habe er eines Tages Simplicianus gestanden, er sei innerlich Christ geworden. Da er aber in der Öffentlichkeit aus Rücksicht auf seine heidnischen Freunde nichts von seiner Bekehrung verlauten ließ, wollte ihm der andere nicht eher glauben, als bis er ihn in einer Kirche gesehen habe. Ironisch habe ihm Victorinus entgegnet: „Machen also Wände die Christen aus?“ Der Redner übertrug eine berühmte Diskussion über das Wesen des Staates auf das Verhältnis von Glauben und Kirche.39 Das Geplänkel zwischen ihnen wiederholte sich mehrmals. Doch mit der Zeit bekam Victorinus Angst, Christus werde ihm einst seine Feigheit nicht verzeihen. Der gelehrteste Mann Roms, dessen Statue der Senat auf dem Forum aufgestellt hatte, ging mit Simplicianus in die Kirche und wurde Katechumene. Am Tag der Taufe sprach er vor der jubelnden Gemeinde mit lauter Stimme das Glaubensbekenntnis. Entrüstet hatte er zuvor das Angebot der Priester abgelehnt, die einen Skandal in der paganen römischen Gesellschaft vermeiden wollten und ihm deshalb eine stille Tauffeier im kleinen Kreis vorschlugen.40 Als der abtrünnige Kaiser Julian im Jahr 362 ein Gesetz erließ, das christliche Lehrer vom höheren Unterricht ausschloss, gab Marius Victorinus lieber sein Rhetorenamt auf, als sein Christentum zu verleugnen.41
Simplicianus hatte Augustinus richtig eingeschätzt. Die Erzählung von Victorinus’ Bekehrung beeindruckte ihn so stark, dass er den Wunsch verspürte, sofort seinem Beispiel zu folgen. Doch blieb es zunächst beim Wunsch. Augustinus spürte, wie zwei Willen, ein alter fleischlicher und ein neuer geistiger, in seinem Innern miteinander rangen. Der alte Wille behielt im Augenblick die Oberhand, weil er sich mit der Macht der Gewohnheit verband.42
Die Gewohnheit: das war neben der Lehrtätigkeit das Leben im häuslichen Kreis. Zu ihm gehörten mittlerweile neben der Konkubine, dem Sohn Adeodatus und der Mutter Monnica auch Augustinus’ Bruder Navigius und seine beiden Vettern Lartidianus und Rusticus. Vielleicht hatten die drei jungen Männer bereits Monnica von Thagaste nach Mailand begleitet, oder sie waren ihr gefolgt in der Hoffnung, Augustinus, der es bisher von allen Familienmitgliedern am weitesten gebracht hatte, werde in der Residenzstadt etwas für ihre Karriere tun können. Beispiel waren ihre Mitbürger Ponticianus und Euodius, die ab und zu bei ihren Landsleuten vorbeischauten. Ponticianus hatte am Kaiserhof eine hohe Stellung erreicht, und Euodius arbeitete im kaiserlichen Kurierdienst. Aus Thagaste waren zudem die Studenten Trygetius und Licentius, der Sohn des alten Gönners Romanianus, eingetroffen. Alypius, der in Rom keine Stellung und keine Aufträge mehr bekommen hatte, war danach sofort mit Augustinus nach Mailand gereist, und auch ihr Freund Nebridius schloss sich ihnen wenig später an.43
Augustinus war pater familias eines respektablen Haushalts geworden. Keiner Rede wert waren ihm die Sklaven, die dazu gehörten. Das offene Haus des Rhetoriklehrers und die anregenden Gespräche, die dort geführt wurden, sprachen sich herum. Einer der Gäste war der Grammatiklehrer Verecundus, ein Mailänder Bürger, den bald das herzlichste Verhältnis mit Nebridius, Augustinus und Alypius verband. Nebridius folgte seiner Bitte und unterstützte ihn als Aushilfslehrer.44
An der Tagesordnung waren nicht nur philosophische Diskussionen. Immer wieder einmal kam man in deren Verlauf auch auf die Irrungen und Wirrungen des alltäglichen Daseins zu sprechen. „Gemeinsam stimmten wir, die wir freundschaftlich zusammenlebten, Klagen darüber an.“45
Die Verhältnisse in der größer und lauter werdenden Residenzstadt, wo sich ein heftiger Streit zwischen Arianern und Katholiken anbahnte, gaben dazu genügend Anlass. Warum nicht alle Brücken abbrechen und eine Kommune von etwa zehn Freunden gründen, in der man ein Leben in beschaulicher gemeinsamer Muße führen konnte? Jeder würde zum Unterhalt das einbringen, was er besaß. Aus den unterschiedlichen Anteilen würde ein gemeinsamer Fond gebildet, den zwei Mitglieder jeweils ein Jahr lang als Geschäftsführer verwalteten. Sie sollten selbständig alle anfallenden Aufgaben erledigen. „Freunde haben alles gemeinsam“, lautete ein altes, gern zitiertes Sprichwort. Pythagoras soll es geprägt und in einer Hausgemeinschaft mit seinen Schülern erstmals verwirklicht haben. Das Gemeinschaftsgut habe er einzelnen Teilnehmern, den „Politikern“, anvertraut, die sich in „Ökonomen“ und „Gesetzgeber“ teilten. In Augustinus’ Haus dachte man als Vorbild jedoch eher an die Akademie Platons, der als erster das Ideal des „kontemplativen Lebens“, des bíos theoretikós, hochgehalten hatte. Sein Schüler Aristoteles ergänzte, dass der es besser habe, der ein solches Leben zusammen mit Gefährten führe.46
Der eifrigste Befürworter des Plans wurde Augustinus’ Freund und Gönner Romanianus. Er war kurz zuvor in Mailand eingetroffen, weil ihn geschäftliche Schwierigkeiten zwangen, die kaiserliche Verwaltung aufzusuchen. Er war sogar bereit, seinen riesigen Besitz zur Verfügung zu stellen. Doch dann begann die Planung zu stocken. Die Frage war aufgekommen, wie man es mit Frauen halten solle. Denn einige Freunde waren verheiratet, und andere hatten vor zu heiraten. Würden die „Frauchen“ (mulierculae), Ehefrauen und Verlobte, geduldig warten, ob und wann ihre Philosophen wieder einmal zu ihnen kämen? Wohl kaum, lautete die realistische Antwort, an der das Projekt schließlich scheiterte.47
War das stille Begräbnis eines hochgestimmten Plans der Grund, warum Augustinus nicht verriet, dass er als erster auf den Gedanken gekommen war, eine Philosophengemeinschaft zu gründen, zu der er auch gleich eine Verfassung entwarf? Ebensowenig deutete er in dem Zusammenhang an, dass er zu denen gehörte, die die Absicht hatten zu heiraten. Seine stille Absicht besagte zumindest, dass er bei seinem Plan nicht an ein sehr naheliegendes Vorbild gedacht hatte: die auch im Westen des Reiches aufblühenden Klöster. Er wollte ja eine Philosophengemeinschaft, keine Gebetsbruderschaft gründen. Auch wusste er damals noch nicht, dass vor Mailands Toren ein Kloster bestand. Platon erwähnte er allerdings ebenfalls nicht, und genauso wenig Pythagoras, als er auf dessen bekanntes Sprichwort vom gemeinsamen Besitz unter Freunden anspielte.48
Alypius wäre der ideale Genosse in einer künftigen Lebensgemeinschaft von Männern gewesen, die die Begeisterung für die Philosophie verband. Ohne je einen Gedanken an eine Frau zu verschwenden, wäre er ganz „in der Liebe zur Weisheit“ aufgegangen. Augustinus wunderte sich oft, wie ein normaler junger Mann so enthaltsam leben konnte. Er selbst machte dem Freund gegenüber keinen Hehl daraus, dass ihn „die Gewohnheit, seine unersättliche Begierde zu befriedigen“, so heftig bedränge, dass er es ohne regelmäßigen Geschlechtsverkehr nicht aushalte. Wenn Alypius dazu nur missbilligend den Kopf schüttelte, erwiderte ihm Augustinus, der andere könne nicht mitreden. Er habe keine Ahnung von den Genüssen des Fleisches, oder er habe sie vergessen, nachdem seine Erfahrungen, die er als Heranwachsender auf diesem Gebiet gemacht habe, zu flüchtig und zu unbefriedigend gewesen seien. Das lasse sich ändern, überlegte Alypius nach diesem Einwand, blieb sich dann aber doch treu. Lieber redete er Augustinus ins Gewissen, sooft der jetzt davon sprach, er wolle sein Vergnügen endlich in einer ordentlichen Ehe ausleben; rechtmäßige Nachkommen zu zeugen liege ihm dabei weniger am Herzen. Enttäuscht hielt ihm Alypius vor, der Plan einer Philosophengemeinschaft sei damit endgültig gestorben. Das sah Augustinus anders und war nicht um das Beispiel großer Männer verlegen, die durch ihre Ehe weder am Philosophieren noch an der weiteren Pflege ihrer Freundschaften gehindert worden seien.49
Von anderen Freunden bekam Augustinus dagegen Rückenwind für seine Ehepläne. War doch Heiraten für einen Professor in den Dreißigern, der in Amt und Würden war, wahrlich nicht zu früh. Als er der Mutter seine Absicht andeutete, war sie begeistert, zumal sie hoffte, er werde seiner Heirat die Taufe folgen lassen. Seit langem war sie überzeugt, wenn sie Gott darum bitte, schicke er ihr prophetische Träume. War ihre nächtliche Vision, als das Schiff auf ihrer Reise in Seenot geriet, nicht der beste Beweis? Neugierig bat ihr Sohn sie jetzt, ob sie etwas über seine künftige Ehe in Erfahrung bringen könne. Doch sie musste ihn trotz eifrigen Betens enttäuschen. Für ihn weit vorauszuschauen war bald auch nicht mehr nötig. Denn wenig später regelte er selbst durch eine Verlobung seine eheliche Zukunft. Ein junges Mädchen hatte es ihm angetan, und als Monnica, scharfäugig wie alle Mütter, die Verliebtheit ihres Sohnes bemerkte, tat sie ihr Bestes, damit er keinen Korb bekam, als er bei den Eltern um die Hand der Angebeteten anhielt. Schließlich war ein staatlich besoldeter Professor in der Residenzstadt eine gute Partie, falls eine Familie nicht durch ihre Tochter in den Senatsadel einheiraten wollte. Nur ein Hindernis stand einer sofortigen Eheschließung im Weg: die Braut war zu jung. Zwölf Jahre war zwar das gesetzliche Mindestalter, in dem Mädchen heiraten durften. Aber vernünftige Eltern warteten lieber, bis ihre Tochter das vierzehnte Lebensjahr erreicht hatte. Das taten auch Augustinus’ künftige Schwiegereltern und erlegten dem Brautpaar eine zweijährige Verlobungszeit auf. Sie nahmen in Kauf, dass der Bräutigam dann noch zwei Jahre älter sein werde. Auch Augustinus war einverstanden, weil er „das Mädchen liebte“.50
Doch was war mit seiner Konkubine, die „zum Ehehindernis“ werden würde? Sie hatte wohl stets gehofft, dass sie der Mann, dem sie eineinhalb Jahrzehnte die Treue gehalten hatte und den sie immer noch liebte, eines Tages zu seiner rechtmäßigen Gattin machen und ihren gemeinsamen Sohn legitimieren werde. Ungewöhnlich wäre das trotz des Standesunterschieds nicht gewesen. Heiratete doch mancher, falls er kein Senator war, sogar seine Sklavin oder Freigelassene, mit der er Kinder gezeugt hatte. Nun aber eröffnete ihr Augustinus, er werde in zwei Jahren ein vierzehnjähriges Mädchen zur Frau nehmen. Sein Geständnis machte er nicht, ohne ihr zugleich seine ungebrochene Zuneigung zu beteuern und sie zu bitten, ihm in der Zwischenzeit weiter zur Verfügung zu stehen. Nein, war ihre empörte Antwort, der wahrscheinlich ein heftiger Wortwechsel folgte. Danach packte sie ihre Sachen und reiste in die Heimat. Den dreizehnjährigen Adeodatus ließ sie bei seinem Vater zurück.51
Augustinus wollte in den „Bekenntnissen“ diesen Einschnitt in seinem häuslichen Leben nicht mit Stillschweigen übergehen. Andererseits verbot ihm sein männlicher Stolz, offen zu zugeben, dass nicht er das Konkubinat aufgekündigt hatte, sondern dass die Konkubine es war, die ihn hatte sitzen lassen. Peinlichkeiten verschleierte man als geübter Rhetor am besten mit einem beschönigenden Passiv: „Und sie, mit der ich das Lager zu teilen gewohnt war, wurde von meiner Seite gerissen“.52 Seine Männlichkeit bewies er auch durch die Art und Weise, wie er sich über den Verlust hinwegtröstete: Er nahm sich eine neue Konkubine. In der Großstadt Mailand war es nicht schwer, ein armes Mädchen zu finden, das während der zweijährigen Verlobungszeit gegen Kost und Logis den Geschlechtstrieb eines Professors befriedigte. Sie musste sich wohl so manches Mal anhören, wie gut ihre Vorgängerin gewesen war: „Denn meine schwere Wunde, die durch die Amputation der Verflossenen aufgerissen wurde“ – wieder ein vernebelndes Passiv –, „wollte nicht heilen“. Doch dann machte der verlassene Liebhaber die uralte Erfahrung, dass die Zeit alle Wunden heilt, auch wenn bisweilen eine schmerzende Narbe zurückbleibt. Einen bescheidenen Nachruf bekam die Namenlose doch noch: Nach Africa zurückgekehrt habe sie vor Gott das Gelübde abgelegt, von keinem anderen Mann mehr wissen zu wollen. Man hat daraus geschlossen, dass sie in ein Kloster eintrat.53 Für eine unverheiratete Christin zwischen Zwanzig und Dreißig, die vielleicht keine Angehörigen mehr hatte oder ihnen während des langen Konkubinats fremd geworden war, gab es keine bessere Lösung. Ihr concubinus aber konnte sich mit dem Gedanken trösten, dass er der einzige Mann in ihrem Leben gewesen war.
Augustinus beschloss diesen Lebensabschnitt, zugleich die Schwelle zwischen Jugend und vollem Mannesalter, mit einem aufschlussreichen Doppelblick in sein Inneres und auf den barmherzigen Gott: „Mich hielt von dem immer tiefer werdenden Strudel meiner fleischlichen Begierden nur die Furcht vor dem Tod und vor deinem künftigen Gericht zurück, die Furcht, die trotz meiner sich wandelnden Auffassung nie aus meinem Herzen schwand.“54 Angesichts der damaligen Lebenserwartung war die Todesfurcht für einen Menschen, der die Dreißig überschritten hatte, nicht unbegründet, zumal wenn er wie Augustinus an Atemnot und Brustschmerzen litt.55 Ein Gegenmittel gegen die Todesfurcht waren mehr noch als das „Übermaß an fleischlichen Genüssen“ die Gespräche, die Augustinus mit seinen liebsten Freunden Alypius und Nebridius führte. Auf den Spuren Platons und Ciceros diskutierten sie über das höchste Gut und höchste Übel und über den Lohn, den tugendhafte Menschen im Jenseits empfangen.56 Zuversicht hätte ihnen auch die Bibel und der Glaube an die Auferstehung geben können. Aber die Macht der philosophischen Klassiker war vorläufig stärker.
Philosophie und Lehrtätigkeit nahmen Augustinus so stark in Beschlag, dass er kaum einen Blick auf die religiösen Auseinandersetzungen werfen konnte, die damals Mailand erschütterten. Was ging ihn an, ob Katholiken oder Arianer in einer der Kirchen der Stadt Gottesdienst feierten, mochte auch Ambrosius mitten in diesem Streit stehen? Der Kaiserhof hatte 385 den Bischof aufgefordert, die vor der Stadt gelegene Basilica Pontiana den Christen arianischen Glaubens zu überlassen, zu dem sich auch der junge Kaiser Valentinian II. und seine Mutter Justina bekannten. Unterstützt von seinen lauthals protestierenden katholischen Anhängern lehnte Ambrosius das Ansinnen ab. Am 23. Januar 386 erließ Valentinian ein Gesetz, das den Arianern freie Religionsausübung zusicherte und allen, die sie daran hinderten, die Todesstrafe androhte. Auch sollte Ambrosius ihnen zusätzlich die Basilica nova übergeben, die innerhalb der Stadt lag.57 In der Karwoche 396 eskalierte der Streit, obwohl Ambrosius sich alle Mühe gab, Blutvergießen zu verhindern. Am Ende musste der Kaiser nachgeben, weil seine Palastwache in einem bewaffneten Kampf um die Basiliken gegen die städtische Masse der Ambrosianer den Kürzeren gezogen hätte. Valentinian verließ danach Mailand für einige Zeit.
Augustinus bemerkte in den „Bekenntnissen“ zu dem Streit: „Obwohl sich die Stadt damals in Tumult und Aufruhr befand, ließ mich die Sache kalt, weil mich der Geist Gottes noch nicht entflammt hatte.“ Es gab noch einen Grund für seine Distanz: Monnica. Wohl eher amüsiert beobachtete er, wie seine Mutter schleunigst zu einer der bedrohten Basiliken eilte und dort mit dem gläubigen, „zum Sterben bereiten“ Volk Nachtwache hielt, um eine feindliche Übernahme zu verhindern. Mit Hymnen- und Psalmengesang hielten sie sich wach und machten sich gegenseitig Mut. Von hier aus habe sich der im Osten bereits übliche Kirchengesang überall verbreitet, ergänzte Augustinus.58 Er überging, dass Ambrosius der fleißigste Hymnendichter war und seine nächtliche Gemeinde so manche Uraufführung seiner musikalischen Gebete zu Gehör brachte. Den geistlichen Wert des Psalmengesangs erkannte erst der Priester und Bischof Augustinus, der beobachtete, wie bewegt seine Gemeinde beim Singen war. Er selbst vergoss nach seiner Bekehrung Tränen der Rührung, als erstmals Hymnengesang an sein Ohr drang. Aber er sah auch eine Gefahr darin, dass über der schönen Melodie und den schönen Stimmen, die er sich wünschte, die Aufmerksamkeit für den Text verlorenging.59
Im Sommer des Jahres 386 zog Ambrosius die Aufmerksamkeit des Rhetorikprofessors aus einem anderen Grund auf sich: Die „Basilika der Märtyrer“ sollte eingeweiht werden, die der Bischof zu seiner Grablege bestimmt hatte, weshalb sie auch Basilica Ambrosiana genannt wurde. Aber noch fehlten für die Einweihung Märtyrerreliquien, auf die das reliquiengläubige Mailänder Kirchenvolk nicht verzichten wollte. Prompt hatte Ambrosius eine Traumvision, in der ihm die Stelle erschien, wo die Leiber der beiden Märtyrer Gervasius und Protasius viele Jahre unerkannt begraben lagen. Die Überführung der Gebeine wurde zu einer Demonstration gegen die arianische Kaiserin Justina, zumal während der Prozession Besessene von Dämonen erlöst wurden. Ein Heilwunder beschäftigte Augustinus besonders, weil es hieb- und stichfest war: Während der Überführung erhielt ein Mann, der viele Jahre blind gewesen war, sein Augenlicht zurück, als er mit dem Tuch, das die Toten bedeckte, seine Augen berührte. Ein Zweifel war nicht möglich. Zu viele Prozessionsteilnehmer hatten das Wunder miterlebt, und Augenzeugen berichteten Augustinus darüber. Noch viele Jahre später diente ihm im „Gottesstaat“ die plötzliche Heilung als Beweis dafür, dass Gott auch in der Gegenwart noch Wunder wirkt.60