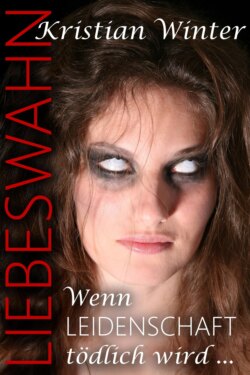Читать книгу Liebeswahn - Kristian Winter - Страница 4
Kapitel
ОглавлениеZwei Monate zuvor
Es war Spätsommer. Schon seit Wochen hatte es nicht geregnet, so dass die Pflanzen welkten und die Flüsse Niedrigwasser führten. Wieder einmal lag eine drückende Hitze über der Stadt und ließ die Luft in den Straßen flimmern. Die meisten Menschen waren an diesem Wochenende ins märkische Umland geflüchtet oder suchten Abkühlung in den nahen Freibädern. Nur vereinzelt waren Passanten unterwegs.
Unter ihnen fiel eine Frau im weißen Trenchcoat auf. Sie trug eine große Sonnenbrille, hatte trotz der Hitze den Kragen aufgeschlagen und verbarg ihr Haar unter einer hellblonden Perücke. Eilig huschte sie zur anderen Straßenseite hinüber. Ihre Bewegungen waren fahrig und unkoordiniert und zeugten von großer Angst. Immer wieder sah sie sich um, als suche sie nach etwas Bestimmten. Manchmal ging sie sogar einige Schritte zurück, setzte dann aber ihren Weg verstört fort. An der nächsten Kreuzung schlug sie plötzlich einen Haken und verschwand in das kleine Café an der Ecke, an dem sie schon fast vorüber war.
Allerdings handelte es sich um kein gewöhnliches Lokal, sondern um das weithin bekannte ‚Savoir-vivre‘ - eine Begegnungsstätte der hiesigen Intellektuellen mit vornehmlich frankophoner Klientel, das um diese Zeit reichlich besucht war. Hier setzte oder besser quetschte sie sich an einen der hinteren Tische, jedoch so, dass sie die Straße noch einsehen konnte. Das schien ihr wichtig, denn sie zog sogleich ihre Brille etwas herab und fixierte fortwährend die gegenüberliegende Seite. Dabei war sie so konzentriert, dass sie den inzwischen herantretenden Kellner, übrigens ein überaus gutaussehender Bursche mit kleinem Oberlippenbärtchen und dunklem Wuschelkopf, gar nicht bemerkte.
„Bonsoir, Madame, Sie wünschen?“, fragte dieser bereits zum zweiten Mal mit französischem Akzent und deutete eine höfliche Verbeugung an.
Die Frau sah erschrocken auf und schien ihn erst jetzt wahrzunehmen.
„Was darf ich Ihnen bringen?“, wiederholte er nun bereits zum dritten Mal.
„Ach ja, einen Kaffee mit Milch ohne Zucker, ein wenig geschäumt, wenn es geht, und bitte, schließen Sie die Tür gegenüber“, antwortete sie zögernd, wobei sie sein Namensschild auf der linken Brustseite betrachtete. „Ich bin empfindlich gegen Zugluft, Francois“, setzte sie noch schnell hinzu.
„Liebend gern, Madame“, erwiderte der Kellner charmant. „Nur bitte ich zu bedenken, dass es draußen drückend warm ist und andere Gäste wiederholt um diese - wie sagt man auf deutsch? - Ventilation gebeten haben.“
„Was kümmert mich Ihre Ventilation!“, empörte sie sich sofort, seinen frankophonen Slang nachäffend. „Zugluft ist schädlich für die Bronchien. Das wird Ihnen jeder Arzt bestätigen. Außerdem weht er den Straßenstaub herein. Also bitte!“
Doch Francois zögerte. Verunsichert über diese unerwartete Forschheit schlug er vor, den Platz zu wechseln. Auf der anderen Seite wäre es sicher angenehmer.
„Das hätten Sie wohl gern!“, blaffte ihn die Frau erneut an.
„Ich verstehe nicht!“
„Oh, ich glaube, Sie verstehen das sehr gut! Sie wollen mich nur aus einem ganz bestimmten Grund hier weg haben. Meinen Sie, ich merke das nicht? Aber das könnte Ihnen so passen!“
Der völlig verblüffte Kellner hielt für einen Moment die Luft an. Dann besann er sich aber und entgegnete gleichmütig: „Wenn Sie meinen! Nur fürchte ich, dann müssen Sie mit der Zugluft leben. Ich werde die Tür jedenfalls nicht schließen!“
„Wie bitte? Das ist ja wohl die Höhe! Ich möchte den Chef sprechen! Sofort!“ Ihre Empörung war so groß, dass sich gleich einige der Gäste umdrehten und zu ihr hinschauten. Man schüttelte die Köpfe und tuschelte, was die Frau nur noch mehr verärgerte. „Da haben Sie es! Das haben Sie doch beabsichtigt! Aber Ihr Plan wird nicht aufgehen! Ich habe Sie durchschaut und werde das verhindern! Was ist? Worauf warten Sie? Nun gehen Sie schon!“
Der Kellner blies die Backen auf und hatte alle Mühe, nicht laut aufzulachen. „Wie Sie wünschen.“ Daraufhin ging er mit einem schiefen Lächeln davon.
Am Tresen erwartete ihn bereits der Chef, ein kleiner seriös, wirkender, überaus schmächtiger Mittfünfziger mit silbrigem Haar und dunklem Anzug. Er hatte das Geschehen bereits beobachtet und machte sich seinen Reim darauf.
„Schon wieder?“, fragte er schmunzelnd den Zurückkehrenden.
„Oui. Heute möchte sie die Tür geschlossen haben. Angeblich zieht es.“
„Na, wenigstens nicht die Stores wie beim letzten Mal.“
„Soll ich rufen die Gendarmerie?“
„Nein, nicht wieder so ein Aufsehen. Das können wir uns nicht leisten. Ich werde noch einmal mit ihr reden. Vielleicht kann ich sie beruhigen.“
„Und wenn nicht?“
„Dann bleibt uns immer noch die Polizei. Aber ehrlich gesagt, möchte ich das nicht, denn irgendwo tut sie mir leid. Sieh‘ sie dir nur an, dieser elegante Gang, diese vornehme Zurückhaltung. Ohne diese Brille und den albernen Mantel sähe sie sicher ganz passabel aus, eine richtige ‚belle femme‘. Ich wette, sie hat studiert, vielleicht sogar promoviert. Und doch hat sie irgendein Problem. Deshalb auch diese Aufmachung.“
„Aufmachung?“ Francois sah ihn fragend an.
„Ja natürlich! Diese alberne Perücke wirkt doch lächerlich. Sie versucht, sich zu verstecken. Das merkt man doch sofort! Womöglich leidet sie unter einer Paranoia? Solche Leute versuchen sich immer zu verstecken.“
„Mon dieu!“
„Und jetzt guck‘ nicht so! Ich werde jetzt zu ihr gehen und sehen, was ich für sie tun kann.“
Mit diesen Worten begab sich der Chef zum betreffenden Tisch. Dort klopfte er mit einer Serviette einige Krümel vom Tischtuch, richtete die kleine in der Tischmitte stehende Blumenvase zurecht und legte vorschriftsmäßig die Serviette über den Arm. „Sie wünschen, verehrte Dame?“, fragte er in Erwartung ihres Anliegens und deutete eine höfliche Verbeugung an.
Die Frau wollte gleich auffahren und hatte auch schon einiges parat. Doch das verständnisvolle Lächeln ihres Gegenübers samt dem mitfühlenden Blick irritierten sie. Verdammt, da war doch was! Im Nu wurde aus Wut Verlegenheit und sie lächelte verschämt, als wüsste sie genau, dass sie sich wieder einmal verrannt hatte und in Erklärungsnot befand.
„Sie werden entschuldigen“, wich sie verstört aus. „Aber ich habe es mir anders überlegt. Ich werde doch besser das Lokal wechseln.“
„Das steht Ihnen selbstverständlich frei, Madame“, erwiderte der Chef nachsichtig. „Nur würde ich es bedauern, wenn Sie mit unserem Service nicht zufrieden sind.“
„Das habe ich nicht gesagt.“
„Ich muss es aber annehmen, nachdem Sie mich über meinen Kellner haben rufen lassen.“
„Dann nehmen Sie falsch an! Das scheint Ihnen öfter zu passieren!“
„Sie meinen doch nicht etwa wie beim letzten Mal?“
Bei diesen Worten schreckte die Frau zusammen und zog fröstelnd den Kragen enger um den Hals. Gott, war ihr das peinlich, auf diese Weise an den jüngsten Fauxpas erinnert zu werden, als sie in der sicheren Annahme, verfolgt zu werden, Schutz in eben diesem Café suchte. Der gleiche Mann sicherte ihr damals seine Hilfe zu und hatte sogar die Polizei alarmiert. Jetzt erkannte sie ihn wieder. Am Ende war das ganze Lokal in heller Aufregung. Doch ihre Befürchtung fand keine Bestätigung. Alles blieb bei unbewiesenen Behauptungen und der ganze Eklat verpuffte. Die Polizei nahm ihre Personalien auf und verschwand wieder.
Sollte sie sich auch diesmal geirrt haben? Unmöglich! Dazu war es zu intensiv. Zwar bewegte sich alles noch im Vorfeld, blieb bei Ahnungen und Befürchtungen. Doch die vielen kleinen Nadelstiche waren nicht nur Produkt ihrer Einbildung. Kaum eine Nacht, in welcher ihre Beklemmung nicht in Todesangst umschlug. Selbst die stärksten Beruhigungsmittel halfen nicht.
„Ist Ihnen nicht gut, Madame Ritter?“, hörte sie von Ferne die Stimme des Chefs.
„Wie bitte? Oh, doch natürlich… Aber woher wissen Sie …?“
„Ihre Personalien wurden doch beim letzten Mal notiert. Erinnern Sie sich nicht? Carola Ritter, 35 Jahre, wissenschaftliche Assistentin, ledig, keine Kinder.“ Er tippte mit dem Zeigefinger an seine Stirn. „Ich habe ein gutes Gedächtnis. Dort drüben haben Sie gesessen und den Beamten den Sachverhalt geschildert und gleich daneben stand ich. Ich hatte Ihnen noch das Glas Wasser gereicht und Sie versprachen mir, künftig auf sich achtzugeben.“
Jetzt erinnerte sie sich. Ein winziges Lächeln irrte über ihr Gesicht. „Oh ja, Sie waren sehr nett zu mir. Und jetzt – jetzt bin ich schon wieder ... Das ist mir sehr peinlich.“
„Das muss es nicht. Immerhin sind wir alle nur Menschen und haben unsere Schwächen. Benötigen Sie etwas?“
„Oh, nein danke.“
„Geht es Ihnen wirklich gut?“
„Was soll das? Selbstverständlich geht es mir gut!“ Sie schlug seine Hand weg, die gerade tröstend ihre Schulter berührte.
„War es denn heute wieder wie beim letzten Mal?“
„Ja natürlich! Oder meinen Sie, ich komme umsonst herein? Es ist immer das gleiche! Das ist es ja, was ich den Beamten begreiflich machen wollte! Doch niemand glaubt mir … Warum gucken Sie so? Aber ich sehe schon! Auch Sie glauben mir nicht und spielen nur den Verständigen. In Wahrheit machen Sie sich über mich lustig!“
„Oh nein, keineswegs!“
„Geben Sie sich keine Mühe! Ich habe Sie durchschaut! Sie sind auch einer von denen! Sie machen mir nichts vor!“
„Bitte beruhigen Sie sich, Frau Ritter! Ich versichere Ihnen …“
„Versichern Sie lieber nichts, denn ich habe einen guten Anwalt! Im übrigen können Sie sich Ihr Mitgefühl sparen! Ich brauche es nicht, von niemandem, verstehen Sie?“ Dann aber, als wäre sie über die eigene Lautstärke erschrocken, mäßigte sie erneut ihren Ton und sah sich scheu um. „Eine Bitte noch. Wenn ich Ihr Café verlasse, möchte ich das unauffällig tun. Verstehen Sie? Das ist doch auch in Ihrem Interesse.“
„Ja natürlich, Madame - nur wie kann ich dazu beitragen?“
„Indem Sie ganz einfach wieder zum Tresen gehen und mit Ihrem Kellner scherzen. Tun Sie das am besten möglichst laut und ungezwungen. Das wird die Aufmerksamkeit der Gäste von mir lenken und ich werde diesen Moment nutzen.“
Der Chef hob verwundert die Brauen, fragte dann aber erstaunlich naiv, ob das auch wirklich alles sei.
Ohne darauf zu antworten, erhob sich die Frau und begab sich mit kurzen, schnellen Schritten zur Tür, allerdings so übereilt, dass es jedem auffiel. Kurz davor stolperte sie auch noch und wäre fast gefallen, hätte sie nicht im selben Moment ein gerade hereinkommender Gast aufgefangen. „Hoppla“, sagte er freundlich und stützte galant ihren Arm.
Daraufhin färbte sie sich krebsrot und entwand sich ihm bitterböse. Dann rannte sie, ohne auch nur ein Wort zu erwidern, aus dem Café, indes er ihr völlig verblüfft nachschaute. Kaum draußen, hastete sie um die nächste Ecke, sank dort rücklings gegen die Hauswand und schnappte nach Luft.
‚Verdammt, wer war dieser Kerl?‘, schoss es ihr durch den Kopf und sie sah ängstlich zurück. Wieso kam er gerade jetzt herein? Aber das war kein Zufall. Niemand kommt ausgerechnet im Augenblick ihrer größten Erregung herein. Das war sonnenklar. Es gehörte dazu. Das alles war nur ein Spiel. Man wollte sie hierher treiben, immer an den gleichen Ort, damit sie sich jedes Mal vor dem gleichen Publikum unmöglich machte. Wie abgekartet! Das musste ein Ende haben, sofort!
Kurze Zeit darauf saß sie in der Bahn und fuhr zu einer bestimmten Adresse eines bestimmten Herrn. Zwar mochte sie ihn nicht, doch konnte sie in letzter Zeit nicht auf seine Hilfe verzichten. Dabei handelte es sich um niemand anderen als den stadtbekannten Neurologen und Psychiater Prof. Dr. Wolfgang Weidenfeller, eine Kapazität auf dem Gebiet der kognitiven Verhaltenstherapie und schizophrener Paranoia. Verständlicherweise vermied sie unangemeldete Besuche, denn sie fürchtete seine mitunter doch sehr ruppige Art. Doch das heutige Erlebnis war derart beunruhigend, dass sie ihre Furcht überwand und gegen diese Regel verstieß.
Als sie sein Behandlungszimmer betrat – ein geräumiger Raum mit hellen, sterilen Wänden, einem rustikalen Schreibtisch und Freud‘scher Couch in der Ecke - huschte ihr verstörter Blick sogleich durch das Zimmer und blieb, Gott weiß warum, an dem schweren Brieföffner auf dem Schreibtisch haften. Eigenartige wulstige Rillen zierten die Seiten des barocken Gegenstandes. Warum ihr das auffiel, konnte sie nicht erklären, ebenso wenig wie das plötzliche Verlangen, ihm dieses Ding an den Kopf zu schleudern.
Der Professor war ein stattlicher, bereits bejahrter Mann mit buschigen ergrauten Augenbrauen und einem markanten, scharf geschnittenen Gesicht. Er kannte die Patientin schon länger und hatte in letzter Zeit einige durchaus bemerkenswerte Erfolge erzielt, schien aber noch nicht recht zufrieden. Im Grunde war er wortkarg und entnahm vieles den Augen und vor allem der Mimik seiner Patienten, so dass längere Diskussionen nicht nötig waren. Es hasste so etwas. Vielmehr liebte er die Schweigsamkeit, durchbrochen von gelegentlichen Monologen.
So war es auch jetzt. Statt etwas zu sagen, schnitt er ein höchst unzufriedenes Gesicht. Mehrmals setzte seine Patientin an, sich ihm zu offenbaren, brach aber immer wieder ab. Schließlich zog sie entnervt ihre Perücke vom Kopf, legte die Brille auf den Tisch und setzte sich ihm gegenüber auf den knarrenden Stuhl.
„Ich bin gekommen, weil…“, versuchte sie es erneut, geriet jedoch nach seinem finsteren Blick ins Stocken.
„Ja, ich weiß“, kam er ihr zuvor, erhob sich und schritt, die Hände über dem Rücken verschränkt, nachdenklich vor ihr auf und ab. Hin und wieder blieb er stehen und betrachtete sie überaus besorgt. „Es ist also wieder passiert“, folgerte er.
„Ja, leider.“
„Und wo dieses Mal?“
„In der alten Linienstraße. Dort habe ich die Nerven verloren und bin weggelaufen.“
„Aber warum? Wir hatten doch vereinbart, dass Sie nicht davonlaufen, sondern sich den Dingen stellen! Warum, um Himmels Willen, tun Sie nicht, was man Ihnen sagt?“
„Ja, ich weiß! Aber ich hatte plötzlich Angst, obgleich ich mir ständig sagte, keinen Grund dafür zu haben. Ich meine, wir sind doch alle Menschen! Geht es Ihnen nicht ebenso, Herr Professor?“
„Um mich geht es hier nicht!“, wehrte er ab. „Sie sind doch nicht etwa wieder in diesem Café gewesen?“
„Doch!“
„Hat Sie das Personal erkannt?“
„Nun ja“, wich sie verlegen aus und senkte den Blick, was ihn nur noch weiter verärgerte.
„Was heißt hier: ‚Nun ja‘? Hat man es mitbekommen oder nicht?“, forderte er eine Antwort.
„Nicht direkt.“
„Tut mir leid, Frau Ritter! Aber wenn die Therapie anschlagen soll, müssen Sie sich an die Abmachungen halten! Widerstehen Sie Ihrem Drang, Ihre Sehnsüchte zu realisieren. Das sind nur unsinnige Verlockungen und somit Prüfstein Ihrer Willensstärke. Sie können sie nur in dem Maße beherrschen, wie Sie sich selber beherrschen. Jedes Nachgeben wäre kontraproduktiv.“
„Das mag wohl sein. Aber ich fürchte bereits, dass er das längst weiß.“
„Das wer was weiß?“
„Er.“
Der Professor zog die Stirn kraus. „Reden Sie nicht solchen Unsinn! Nichts weiß er, weil er gar nichts wissen kann! Sie müssen sich zusammennehmen, Frau Ritter! Es gibt keinen Er und das ein für alle Mal!“
„Meinen Sie wirklich?“
„Ganz bestimmt! Haben Sie Ihre Medikamente genommen?“, fragte er jetzt streng.
„Ja.“
„Bitte öffnen Sie Ihre Bluse. Ich muss Sie untersuchen.“ Der Professor griff zum Stethoskop.
„Untersuchen?“
„Ja, Ihre Atmung geht wieder schwer, vermutlich wieder Ihr Stressasthma. Wir müssen aufpassen, dass es nicht chronisch wird.“
„Soll ich mich entkleiden?“
Der Psychiater schaute seine Patientin verdutzt an. „Wozu das denn?“
„Ich weiß es nicht. Aber manchmal spüre ich diesen Zwang.“
„Welchen Zwang? Werden Sie bitte deutlicher!“
„Mich vor einem Mann zu entkleiden“, fuhr sie errötend fort. „Aber er müsste dabei wehrlos sein, am besten gefesselt, damit er gezwungen ist, mich anzusehen. Diese Konzentration seiner Aufmerksamkeit muss doch zu seiner Gier führen, nicht wahr?“
„Nicht unbedingt. Ich befürchte eher das Gegenteil. Wie kommen Sie eigentlich darauf?“
„Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich fühle nur so. Ist das schon krank?“
„Normal ist es jedenfalls nicht. Denken Sie dabei an jemand Bestimmten?“
„Ja, an meinen Chef.“
„Warum gerade an ihn?“
„Das weiß ich nicht. Er ist so anders, wissen Sie?“
Davon beeindruckt hörte er sie ab, leuchte ihr in den Rachen und betastete routiniert Hals und den Nacken, konnte jedoch keine Auffälligkeiten feststellen.
„Das hatten wir doch schon“, bemerkte er beiläufig. „Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass es vergeblich ist, einen Mann zu lieben, der Ihre Liebe nicht erwidert! Das führt zu Ihrer emotionalen Verwirrung, was wir uns in Ihrem Zustand nicht leisten können.“
Sie überlegte einen Moment, wobei ein leichtes Zucken ihre Lippen umspielte. „Ja, ich weiß! Aber ich kann es nicht abstellen.“
„Das sollten Sie aber. Es hat keinen Sinn, Ihr Verlangen nach ihm zu intensivieren und dabei anderen Dingen keinen mehr Raum zu lassen.“ Der Professor sah der Patientin jetzt tief in die Augen. „Sie sind doch eine attraktive junge Frau! Sie sollten einfach mal ausgehen oder ein gutes Buch lesen. Auch ein längerer Spaziergang an der frischen Luft könnte nicht schaden. Das bringt Sie auf andere Gedanken, dann werden Sie Ihre Verfolgungen bald nicht mehr spüren.“
„Aber wenn es doch so ist?“
„Es ist eben nicht so!“, herrschte er sie an, nahm sich jedoch gleich wieder zusammen. „Welchen Sinn sollte es machen, eine Frau zu verfolgen, von der man nichts will! Ein Stalker verfolgt sein Opfer stets zum Zwecke des Eigennutzes, das heißt, er will es unter seinen Willen zwingen, da er es als sein Eigentum betrachtet. Das kann aber in Ihrem Fall kaum sein!“
„Ich hatte mehrmals versucht, ihn dabei zu ertappen“, fuhr sie jedoch unbeeindruckt fort, als hätte sie gar nicht zugehört. „Es ist mir jedoch bisher noch nicht gelungen. Er ist jedes Mal schneller.“
„Sehen Sie“, der Professor klatschte begeistert in die Hände. „Das erklärt alles. Sie versteigen sich in eine Vision und kollidieren dabei mit der Realität. Sie müssen aber die Realität zulassen, sonst kommen Sie niemals aus diesem Kreislauf heraus … Sie hatten doch sicher schon mal einen Partner?“
„Eigentlich schon, aber nicht wirklich.“
Er sah sie verwundert an. „Wie darf ich das verstehen?“
„Nun ja, es ist nie dazu gekommen, wissen Sie? Der Gustl war zwar ganz patent und sogar beinahe intelligent. Wir waren auch zweimal bei ihm zuhause und er stellte mich seiner Mama vor, einer herzensguten alten Dame, die wunderbare Ringelsöckchen strickte. Er hatte sogar eine Bierdeckelsammlung und war für Halma zu begeistern. Nur war da nichts weiter außer Halma.“
„Verstehe! Und das ist jetzt bei Ihrem Chef anders, obgleich da ebenfalls nichts ist.“
„Er macht einen großen Eindruck auf mich, weshalb mich sein Bild auf Schritt und Tritt verfolgt. Steht er mir dann aber gegenüber, könnte ich ihn erschlagen, schon allein dafür, dass er mich so unverschämt angafft. Es ist mir peinlich, aber auch irgendwie schmeichelnd. Warum müssen Männer immer so gaffen?“
„Was sehen Sie in ihm?“, wich der Professor aus. „Oder was konkret fasziniert Sie an ihm?“
„Das kann ich nicht genau sagen. Es ist einfach seine Art zu reden und sich zu geben, sein Blick und sein Lächeln, eben sein Vermögen, ganz Mann zu sein. Vielleicht ist es meine Ursehnsucht nach … “
„Reden Sie weiter! Was meinen Sie?“
„Es klingt vielleicht albern, wenn ich es so sage, aber ich liebe seine Hände. Sie sind so schlank und zart und jedes Mal, wenn ich sie berühre, beim Morgengruß zum Beispiel, durchschauert mich eine heiße Welle. Manchmal fürchte ich, er könnte es merken, vor allem, wenn mir die Knie weich werden. Doch ich nehme mich immer zusammen.“
„Das ist schon bedenklich“, folgerte der Professor. „Nehmen Sie auch bitte die verschriebenen Medikamente. Ich stelle Ihnen noch ein weiteres Rezept aus und vermeiden Sie unbedingt jeden körperlichen Kontakt und sei es nur die flüchtigste Berührung.“
„Aber wie soll ich das, da ich ihm doch jeden Tag begegne! Er ist mein Vorgesetzter und mir weisungsbefugt.“
„Dann sollten Sie eine Versetzung in Erwägung ziehen. So geht das jedenfalls nicht weiter. Sie ruinieren sich ja.“
„Oh nein!“, intervenierte sie sofort. „Das ist völlig unmöglich! Ich kann dort nicht weg! Es muss eine andere Lösung geben. Verstehen Sie doch, meine Tätigkeit ist mein Leben! Ich kann nicht ein Übel gegen ein anderes tauschen. Ich muss das Problem dort besiegen, wo seine Ursache liegt. Nur so kann ich gesunden. Anderenfalls werde ich daran sterben.“
Der Professor wich erschrocken zurück. „Aber aber, was sind denn das für Reden, Frau Ritter? Sie machen es mir nicht leicht! Sie müssen sich strikt an die Medikation halten und erscheinen bitte weiterhin einmal wöchentlich bei mir zur Kontrolle! Ich weiß ja, dass der Prozess Ihrer Heilung langwierig ist. Sie dürfen nur nicht aufgeben und müssen aufpassen, nicht mit Streichhölzern zu spielen und dabei ein ganzes Haus zu entzünden, wenn Sie verstehen.“
Natürlich verstand sie das. Doch was sollte dieser anmaßende Ton? Erneut fühlte sie sich versucht, ihm den Brieföffner gegen den Kopf zu knallen. Ohne etwas zu erwidern, erhob sie sich und versprach ihm, was er forderte. Der Professor verlor noch einige tröstende Worte und begleitete sie zur Tür, wo er sie dann mit einem unguten Gefühl entließ. Kaum war sie verschwunden, ging er zum Schreibtisch zurück und machte mit sorgenvoller Miene ein paar Notizen in ihre Akte.
****