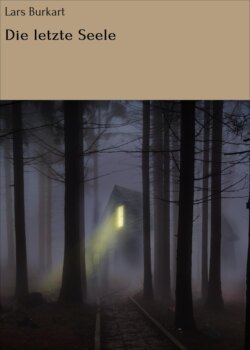Читать книгу Die letzte Seele - Lars Burkart - Страница 5
Kapitel 3
Оглавление3. Kapitel
„Paul, kommst du mit in den Club? Du hast dich ja schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr sehen lassen!“
Er stand auf dem Flur, hielt den Telefonhörer in der einen Hand und eine glimmende Kippe in der anderen. Sein Kopf brummte, und seine Finger schmerzten. Aber diesmal kam das Kopfweh nicht vom Alkohol, sondern war ein Produkt geistiger Arbeit. Seit dem Tag, an dem er die Kontrolle über sich und seine Handlungen verloren hatte, hatte er keinen Tropfen mehr angerührt. Seine Hände zuckten und kribbelten noch vor Anstrengung. Er hatte mit ihnen wie eine Berserker auf die Tastatur eingehämmert, aber nicht vor Wut und Raserei, sondern weil sprudelnd wie ein Wasserfall ein Text aus ihm herausgeprescht kam. Noch vor drei Minuten hatte er am Schreibtisch gesessen, so in seine Arbeit vertieft, dass er das Klingeln des Telefons fast überhört hätte. Erst beim zwanzigsten Mal drang es zu ihm durch
Während er so dastand, kam er sich vor wie ein Fremder in der eigenen Haut. Er hatte keine Ahnung, wovon der Kerl am anderen Ende der Strippe faselte. Er wusste weder wer es war noch, um was für einen Club es sich handelte. Da er aber nicht wie ein Idiot dastehen wollte, schwieg er. Für den Anrufer schien das nichts Ungewöhnliches zu sein.
„Lass mich raten! Du arbeitest an einem neuen Buch. Stimmt’s, oder hab ich recht?“
„Ja.“
Jetzt war er überrascht. Ja, er arbeitete an einem neuen Buch. Oder zumindest an einer neuen Geschichte, vielleicht wurde ja später ein Buch daraus. Er musste erstmal schauen, wie sich das alles entwickelte. Insofern hatte der Anrufer recht, und das hieß, dass er den Störenfried schon länger kannte. Es ging ihm fast immer so, wenn er ein neues Projekt anfing: Wenn eine Idee, die noch in den Kinderschuhen steckte, ihn in ihren Bann zog, konnte er den Eindruck erwecken, an Alzheimer erkrankt zu sein.
„Hab ich’s mir doch gedacht“, fuhr der andere fort. „Dann leidest du immer ein bisschen unter Gedächtnisschwund.“
Jetzt dämmerte es Paul langsam. Der Anrufer konnte nur den Tennisclub meinen. Und nun, da ihm ein Licht aufgegangen war, wurde ihm bewusst, dass er schon lange nicht mehr gespielt hatte. An Lust mangelte es ihm nicht, aber momentan war einfach keine Zeit dafür.
„Tut mir echt leid. Momentan sieht’s schlecht aus. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit. Hab ’ne echt phänomenale Idee, sag ich dir. Das wird der Reißer, der Reißer schlechthin.“ Sein Erzähltempo hatte sich nun verdoppelt.
„Mensch, du bist ja hin und weg! Ich wünschte, ich wäre nur halb so arbeitsgeil wie du. Aber leider, leider … egal, sei’s drum. Ich wünsche dir gutes Gelingen! Und falls du noch Lust bekommst, ein paar Bälle zu schmettern: Du weißt ja, wo du mich finden kannst.“
Er verabschiedete sich und legte auf. Paul hatte versprochen, sich bei ihm zu melden. Jetzt, da das Gespräch beendet war, merkte er erst, dass er keinen Schimmer hatte, wer der Kerl nun war. Egal. Fröhlich pfeifend schlenderte er zurück ins Arbeitszimmer, setzte sich wieder an den Schreibtisch und war nur wenige Sekunden später wieder weggetreten. Die konzentrierte Stille wurde nur unterbrochen, wenn er einen Satz vor sich hinmurmelte, bei dem er sich nicht sicher war, wie er aufgebaut sein sollte. Wenn er ihn hörte, war es oft anders, als wenn er ihn nur stumm las.
Während er angestrengt arbeitete, wiederholte sich in seinem Kopf noch einmal das Geschehen, als er das Notebook zu Boden geworfen hatte und er heulend aus dem Zimmer gestürmt war. Paul registrierte davon nichts. Es geschah in seinem Unterbewusstsein. Es waren nur Bruchstücke, die, noch ehe sie bemerkt werden konnten, weggespült wurden. Weggespült von der Begeisterungswelle, die sein neues Projekt in ihm auslöste.
Noch bevor der Laptop auf den Boden geschlagen war, war er aus dem Zimmer gerannt und wie ein Wirbelwind durch das ganze Haus gefegt, durch das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die zwei Bäder, die Gästezimmer und sogar durch den Keller. Er warf alles um, was ihm vor die Füße kam: Sessel, Stehlampen, Stereoanlage. Er hob es auf und pfefferte es gegen die Wand. Als ob die Dinge an alledem Schuld trügen. Selbst ein Orkan hätte nicht mehr Schaden anrichten können. Die einzigen Dinge, die blieben, wo sie waren, waren zu schwer für ihn. Und dabei schrie er. Er machte einen Lärm wie zehn startende Düsenjets zusammen. Er schrie sich die Lunge aus dem Hals. Das Kratzen in seiner Kehle und das Kreischen in seinem Ohr waren unerträglich. Aber er konnte einfach nicht aufhören. Eine blinde Zerstörungswut hatte ihn gepackt.
Irgendwann dann sackte er in sich zusammen und blieb liegen, wo er war. Er hatte Schuldgefühle, weil er dem Zerstörungsdrang nachgegeben hatte. Gleichzeitig aber war er auch froh darüber. Vielleicht war es das einzig Richtige, was er hatte tun können? Denn nach der Hysterie fühlte er sich besser, viel besser als zuvor. Als wäre damit alles herausgeschleudert worden, was nicht gut für ihn war. Alles, was wie Gift auf seiner Seele lastete. Er war wie ein Vulkan, in dem es zunächst bedrohlich zischt und brodelt, und der schließlich, wenn der Ausbruch stattgefunden hat, wieder still und friedlich daliegt. Seine Stimme war heiser geschrien, und sein Kopf fühlte sich an wie ein Amboss, auf den stundenlang eingedroschen worden war – aber er fühlte sich großartig. Ihm tat alles weh, und seine Knochen schienen alle verdreht und verleiert zu sein, aber er fühlte sich großartig. Seine Muskeln waren schwabbelig wie Wackelpudding und wurden von Krämpfen geschüttelt, aber er fühlte sich großartig.
Schwerfällig wie ein Greis richtete er sich auf, und sofort explodierte eine neue Schmerzwelle in seinem Kopf und Körper. Er quittierte es mit einem triumphalen Gelächter. Es klang wie das Siegesgeschrei eines Kriegsherrn, der nach jahrelangen blutigen Kämpfen endlich siegreich heimkehren kann.
Als er auf seinen Beinen stand, wirkte er wie ein neugeborenes Fohlen. Seine Beine knickten unter seinem Gewicht ein, und seine Arme wirbelten mal haltsuchend, mal ekstatisch durch die Luft. Alle diese Bemühungen begleitete er mit einem hysterischen Gelächter, das mit jeder Sekunde verrückter wurde. Langsam, als ginge er über dünnes Eis, lief er zur Küche. Obwohl es ihm Schwierigkeiten machte, lief er weiter. Irgendwann bekam er sogar den Eindruck, die Schmerzen würden nachlassen, das Brummen im Kopf verschwinden, die Muskelkrämpfe sich lösen. Aber wer weiß, vielleicht gaukelte ihm das sein Gehirn nur vor, weil es überlastet war?
Er öffnete die Kühlschranktür, schauerte kurz, als die herausströmende Kälte zu Boden fiel und seine Beine umspülte und griff beherzt hinein. Seine Bewegungen waren bereits flüssiger, geübter. Offensichtlich ging es ihm sekündlich besser. Während seine Hand über der Butterdose schwebte, überlegte er kurz, nickte dann zustimmend, griff noch tiefer hinein und förderte seinen Alkoholvorrat zu Tage. Und das war nicht gerade wenig. Er musste sogar ein paar Mal nachfassen. Schließlich war es geschafft, und sein gesamtes Arsenal an Bier, Schnaps und Wein stand auf der Spüle. Er hielte kurz inne und betrachtete das, was da vor ihm stand.
Allerdings sann er nicht allzu lange nach. Sein Entschluss stand ohnehin fest. Ohne mit der Wimper zu zucken, öffnete er sämtliche Verschlüsse und kippte alles in den Abfluss. Bald roch es in der Küche wie in einer Hafenbar.
Lange stand er so da und sah zu, wie die Getränke gurgelnd in der Dunkelheit verschwanden. Es tat ihm keineswegs leid, und er bereute es auch nicht im Geringsten. Im Gegenteil: Es machte ihn froh. Er lachte vor sich hin, gackernd wie ein Huhn.
Schließlich machte er sich daran, den Saustall aufzuräumen. Und das dauerte bis zum nächsten Abend. Er musste alle Scherben, alle zerrissenen Kissen und zerfledderten Gardinen aufsammeln und, soweit möglich, durch neue ersetzen. Er richtete die umgeworfenen Möbel wieder auf und topfte die Pflanzen um, die er in seiner Wut herausgerissen hatte. Es war ein hartes Stück Arbeit, dennoch pfiff er die ganze Zeit über fröhlich vor sich hin.
Als endlich alles gesäubert war, fiel er erschöpft in tiefen Schlaf. Er hatte ohne Unterbrechung fast sechsunddreißig Stunden gefegt, gesaugt, geputzt, gewischt und gebohnert. Seine Hände waren schwielig und mit Blasen übersäht.
Am nächsten Morgen erwachte Paul ausgeruht und fühlte sich frisch. Er frühstückte ausgiebig und ausnahmsweise sogar gesund, mit Müsli und Milch, duschte danach abwechselnd kalt und heiß und schlenderte ins Arbeitszimmer, wo er, ohne es richtig wahrzunehmen, das Notebook aufhob, einschaltete, das Schreibprogramm hochfuhr und schließlich auf die Tastatur eindrückte.
Das sollte schon fünf Tage her sein? Kinder, wie schnell die Zeit verging!
Und plötzlich war es wieder wie in alten Zeiten. Er schrieb täglich zwischen vier und sieben Seiten und schaffte es nebenbei sogar noch, ein Buch zu lesen. Abends ging er kurz vor Mitternacht ins Bett, stand früh um acht auf, aß etwas und schrieb dann weiter. Yeah, wie in den guten alten Zeiten, verdammt! Es ging doch nichts über einen geregelten Tagesablauf!
Paul starrte wie gebannt auf den Bildschirm. Der Cursor blinkte und spuckte Buchstabe um Buchstabe aus. Auch das Jucken und Kribbeln in seinen Händen war verschwunden. Auf dem Schreibtisch neben ihm stand ein übervoller Aschenbecher, in dem eine Zigarette qualmte. Ab und zu griff er nach ihr, ohne den Blick vom Bildschirm zu wenden, und nahm einen kräftigen Zug. Er hatte den Rauch noch gar nicht richtig ausgestoßen, da sponn er auch schon weiter.
Hätte er nur ansatzweise geahnt, was er damit in Bewegung setzte, wären seine guten Vorsätze augenblicklich vergessen gewesen. Dann wäre er binnen weniger Tage zum hemmungslosen Alkoholiker geworden.
Es war ein Wunder, dass Sabine keine schweren Verletzungen erlitt, als sie mit ihrem Pferd stürzte. Das Glück schien diesmal auf ihrer Seite zu sein. Leider konnte man das bei dem Pferd nicht behaupten: Es musste eingeschläfert werden. Seine Knochen waren gleich an mehreren Stellen gebrochen und drei Rippen zersplittert. Es tat ihr zwar im Herzen weh, doch es war bestimmt das Beste für das arme Tier. Doch als es dann schließlich so weit war, konnte sie den Anblick nicht ertragen und flüchtete aus dem Stall. Sabine hatte sehr an dem edlen Tier gehangen und ihr war, als ginge ein guter Freund für immer von ihr.
Sie hastete durch den nahen Wald, der die nördliche Grenze des Grundstücks bildete und ließ seinen kühlen Schatten schnell hinter sich. Sie rannte und rannte, vorbei an Wiesen und Feldern, bis sie das Meer erreichte.
Die Küste war an dieser Stelle nichts als eine Felswand, die steil ins Meer stürzte. An ihrem steinigen Fuß brachen sich die Wellen, und an ihrem Scheitelpunkt blies steifer Nordwind. Alles in allem nicht unbedingt ein gemütlicher Ort. Es gab noch nicht einmal einen Weg, auf dem man zwischen den mannshohen Gesteinsbrocken gefahrlos hätte gehen können. Dennoch liebte sie diese Stelle. Hierher verirrte sich kaum eine Menschenseele und wenn doch, nahm sie angesichts der rauen Umgebung schnell wieder Reißaus. Hier war das letzte Fleckchen Erde, das Sabine für sich allein haben konnte. Immer, wenn sie etwas plagte, etwas verunsicherte, sie sich ängstigte oder sie einfach nur in Ruhe nachdenken wollte, ging sie hierher und lauschte dem Rauschen des Windes und dem Toben der Brandung.
Sabine kannte den Platz seit ihrer Kindheit. Seit sie als kleines Mädchen zum ersten Mal mit ihrem Vater hier gewesen war, hatte der Ort nichts von seinem Reiz verloren. Die Ruhe, das Pfeifen des Windes, das Kreischen der Möwen, all das war ihr ans Herz gewachsen. Und sie wollte keinen dieser Momente missen. Wie oft hatten sie hier oben gesessen, ihr alter Herr und sie, hatten aufs Meer hinausgesehen und hinter den Schiffen her, bis sie am Horizont verschwanden? Wie oft? Sie wusste es nicht. Es mussten unzählige Male gewesen sein. Manchmal hatten sie einfach nur geschwiegen und die raue Schönheit in sich aufgesogen.
Sabine konnte sich noch gut an den Moment erinnern, da sie den Vater gefragt hatte, wohin all die Schiffe verschwanden, wenn sie nicht mehr zu sehen waren. Sie hatte tatsächlich geglaubt, sie versänken im Ozean. Der Vater fuhr ihr liebevoll mit der Hand über den Zopf; das tat er immer, wenn er ihr etwas erklären wollte. Es war seine Art, nach Worten zu suchen. Er musste ihr oft etwas erklären, denn Sabine war ein neugieriges Kind. So erfuhr sie, dass die Erde eine Kugel war und die Schiffe keineswegs im Meer versanken, sondern einfach nicht mehr zu sehen waren, weil sich zwischen sie und das Schiff die Krümmung der Erdoberfläche schob.
„Du musst es dir ungefähr so vorstellen“, hatte er gesagt, „wenn du am Fuß eines Berges stehst, kannst du auch nicht über ihn hinweg auf die andere Seite sehen. Und genauso ist es mit den Schiffen: Die Erde, in diesem Fall das Wasser, ist im Weg.“
Sie hatte den Vater angesehen und gelächelt. Und er wusste, sie hatte verstanden. Egal, wie umständlich er sich auch manchmal ausdrückte, irgendwann konnte sie seinen Gedankengängen folgen.
Ihre Mutter war früh gestorben. Sabine konnte sich kaum noch an sie erinnern. Doch sie musste schön gewesen sein. Überall im Haus standen Fotos von ihr, in jedem Zimmer. Auch an den Wänden hingen Fotos, und immer, wenn Sabine eines der Bilder betrachtete, stellte sie fest, dass sie ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war. Sie hätten Zwillingsschwestern sein können, nur, dass die eine eben schon ein paar Jährchen älter war.
Sie hatte den Vater einmal auf den Grund ihres frühen Todes angesprochen, doch er hatte nur gesagt, sie sei sehr krank geworden und irgendwann einmal würde sie alles darüber erfahren. Irgendwann, eines Tages, wenn die Zeit reif war. Durch seine Augen war dabei etwas gehuscht, das wie Angst aussah. Danach hatte er das Thema gewechselt, und das war das Zeichen gewesen, dass darüber genug geredet worden war.
Wenn die Sonne im Meer versank, war es am schönsten. Ihr glutrotes Licht verwandelte alles in ein Farbkonzert, und es schien, als explodiere sie in einem gigantischen roten Ball. Der beständige Wellengang gab dem Ganzen zugleich eine gespenstische Atmosphäre. Je höher die Wellen schlugen, umso farbenprächtiger und eindrucksvoller war das Spektakel.
Jetzt aber war es noch nicht Abend. Noch lange nicht. Allerhöchstens früher Vormittag, und das Meer breitete sich ruhig unter ihr aus, was für diesen Landstrich ungewöhnlich war. Sie sah weit aufs offene Wasser hinaus. Ihr war heiß; Schweiß rann an ihr herunter, und ihr Herz raste in der Brust.
Sabine war eine schöne junge Frau, Mitte zwanzig, gesund und wohlhabend. Ihre weiblichen Rundungen waren genau dort, wo sie hingehörten, und ihr langes blondes Haar strahlte wie die Sonne. Sie zog die Blicke der Männer reihenweise auf sich. Doch leider war es bisher erst zweien gelungen, ihr Herz zu erobern. Der erste (es war wohl mehr eine Art Jugendliebe, schließlich war sie erst sechzehn und er einundzwanzig) hatte ihre Liebe nicht verdient, wie sie inzwischen dachte. Es schien ihm Spaß zu machen, sie hinter ihrem Rücken im Akkord zu betrügen. Als sie ihn endlich durchschaute, war die Enttäuschung tief. Sie durchschnitt das zarte Band, das ihre Liebe gewesen war, und sie schwur sich, nie wieder einen Mann so nahe an sich heranzulassen.
Es dauerte vier Jahre, bis sie ihre Einstellung überdachte, und dann kam der zweite. Er war das Gegenteil seines Vorgängers. Schnell erwies er sich als Mann ihrer Träume. Bedauerlicherweise war auch diesmal das Schicksal anderer Meinung. Es ließ ihn in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlieren. Dabei war sie nicht einmal besonders gefährlich, vielmehr langgezogen und übersichtlich. Er soll nicht lange gelitten haben, hatte man ihr später gesagt, es musste schnell gegangen sein.
Das mochte vielleicht auf ihn zutreffen, dachte sie, als sie seine Identität bezeugte, doch keinesfalls auf sie. Sie war überzeugt davon, nie wieder den Anblick seines leblosen Körpers vergessen zu können. Zwar hatte er, wie er es ihr hoch und heilig versprochen hatte, einen Helm getragen, aber von Motorradhandschuhen hielt er nicht viel. Seine Leiche war in einem guten Zustand, wenn man davon absah, dass sein Genick gleich an mehreren Stellen gebrochen war. Doch das war innerlich, und er war so aufgebahrt worden, dass man als Laie kaum etwas davon sah. Was man jedoch sah, war der Zustand seiner Hände – oder vielmehr das, was von ihnen übrig war. Sie waren nämlich noch nicht bandagiert worden – und dafür verfluchte Sabine denjenigen, der es versäumt hatte.
Später, als sie wieder daheim war und ein Weinkrampf nach dem anderen sie schüttelte, wurde ihr klar, was für den schrecklichen Anblick verantwortlich war. Schon die blanke Vorstellung reichte aus, dass ihr übel wurde. Sie musste sich erbrechen.
Sabine sah den grauenvollen Moment des Unfalls immer wieder vor sich, sah ihn mit seinen Augen. Episoden aus dem Schreckenskabinett. Voller Panik wollte sie ihm helfen, ihn festhalten. Doch es war vergeblich. Sie hatte nicht die geringste Chance.
Durch das Visier des Helms sieht sie die Straße vor sich liegen. Sie ist trocken und eben. Ein kurzer Blick auf den Tachometer und sie weiß, dass sie fast hundertdreißig Stundenkilometer schnell ist. Plötzlich taucht die Kurve vor ihr auf, eng, tückisch. Sie schreit seinen Namen, will mit aller Kraft an der Bremse ziehen; dabei ist ihr, als rissen die Muskeln ihres rechten Armes – dabei erreicht sie nur, dass sie unbeirrt weiterfährt.
Wie ein Rennfahrer legt sie sich in die Kurve, tief und schräg. Wie oft hat sie das als Sozius schon erlebt. Wie oft hat sie das Adrenalin gespürt und ist einfach nur glücklich gewesen, glücklich über das Gefühl der Freiheit und glücklich, bei ihm zu sein.
Bis jetzt ist noch alles in Ordnung. Doch das Unvermeidliche ist nicht aufzuhalten. Das ist es nie. Es würde, musste geschehen, weil es ja schon geschehen war. Plötzlich hat sie das Gefühl zu fliegen; ihre Innereien tun einen Satz nach oben. Das Hinterrad beginnt zu schlingern und rutscht schließlich gänzlich weg. Und auf einmal ist da der Asphalt, direkt vor ihren Augen. Sie reißt entsetzt die Hände hoch.
Und da beginnt der Alptraum.
Da sie mit mehr als hundert Sachen fährt und die Geschwindigkeit nur langsam abnimmt, während sie wie ein Puck über den Asphalt schlittert wie über einen gefrorenen See, muss sie mit ansehen, wie der Belag ihrer Hände (seine Hände) wie eine grob gezahnte Raspel für ein weiches Holz Stück ist. Die Haut und das darunter liegende Fleisch werden bis auf die Knochen Millimeter um Millimeter heruntergescheuert. Sie hört die Schmerzensschreie mit ihren eigenen Ohren. Er leidet vielleicht nicht lange, dafür aber entsetzlich.
Dann, als der Begrenzungspfosten endlich sein Genick bricht, ist es eine Erlösung für beide.
All das geisterte durch ihre Erinnerung, während sie auf der Klippe stand. Es riss die Wunde, die noch nicht einmal zur Hälfte verheilt war, wieder auf – und diesmal sogar um einiges tiefer. Sechs Jahre war es jetzt her, und allmählich hatte sie geglaubt, mit dem Verlust leben zu können. Kurz nach seinem Tod gab es eine Zeit, in der sie fast wieder glücklich war. Damals hatte der Arzt ihr eine Schwangerschaft bescheinigt. Sie war darüber außer sich; auf diese Weise würde wenigstens etwas von ihm weiterleben! Dass sie ein Kind von ihm erwartete, half ihr, mit der Trauer umzugehen. Mit der Zeit begann sie sogar wieder zu lächeln.
Doch auch jetzt wollte das Schicksal ein Wörtchen mitreden.
An dieser Stelle machte Paul eine Pause, denn sein Magen knurrte inzwischen so laut, dass er zu keinem klaren Gedanken mehr fähig war.
Er ließ sich kurzerhand eine Pizza bringen. Es war ihm egal, mit was sie belegt war. Hauptsache, er bekam endlich was zum Spachteln.
Innerhalb weniger Sekunden war das Ding in seinem Magen verschwunden. Ein zufriedenes Grinsen umspielte seine Lippen; es ähnelte dem Grinsen eines Gangsterbosses, der einen teuflischen Plan ausgeklügelt hat.
Eigentlich hatte er nach dem kleinen Mahl weiterschreiben wollen, aber da er bis zum Platzen voll war, ließ er es lieber. Stattdessen packte er sich einen Augenblick auf die Couch. Er wollte nur etwas ausruhen – nur ein klein wenig.
Als er wieder hochschnellte, sah er, dass fast drei Stunden vergangen waren. Sein Schlaf war tief gewesen und fest, und sogar an einen Traum meinte er sich erinnern zu können.
Paul setzte Kaffee auf, rauchte zwei filterlose Luckys und ging zurück ins Arbeitszimmer, wo er sich wieder in die Arbeit vertiefte.
Eines nachts, der Vater des Ungeborenen war nun seit sechs Monaten unter der Erde, erwachte Sabine mit kolikartigen Schmerzen im Unterleib; es war, als ob sie einen großen, schweren, kalten Stein in sich trug. Die Schmerzen kamen und gingen wie Wehen, und ihre erste Vermutung war, dass sie kurz vor der Entbindung stand. Das war durchaus plausibel; vielleicht hatte dieses Kind es ja besonders eilig, die Welt hier draußen kennenzulernen? Wenn es nur halb so neugierig war wie seine Mutter, war das sogar wahrscheinlich.
So laut es ihr unter den Schmerzen möglich war, schrie sie nach ihrem Vater, der eine Etage über ihr schlief. Sie war mittlerweile so benebelt, dass sie davon überzeugt war, er würde sie nie und nimmer hören. Doch es dauerte keine zehn Sekunden, und er stürmte mit sorgenvoller Miene in ihr Zimmer.
„Es geht … es geht …“
Mehr brachte sie nicht über die Lippen. Doch es reichte aus. Der Vater verstand.
Das nächste, woran sie sich später erinnerte, war das Innere eines Krankenwagens. Es war hell darin und blendete ihre Augen, als blicke sie direkt in die Sonne. Dennoch nahm sie ihre Umgebung nur bruchstückhaft wahr. So viele Ampullen, so viele Verbände! Und die Sirene. Allerdings drang diese nur verschwommen in ihr Bewusstsein …
Die Wehen wurden stärker und stärker, und sie bäumte sich auf der Trage unter Schmerzen. Die Bewegung ließ neue Schmerzen in ihrem Unterleib entstehen. Wie ein Kreislauf aus Schmerz. Schmerz gebar neuen Schmerz.
In diesem Moment spürte sie, wie etwas Spitzes in ihre Armbeuge piekste. Fast augenblicklich verebbte der Schmerz.
Wieder Dunkelheit.
Wieder Stille.
Als Sabine erwachte, lag sie in einem Krankenbett. Der Vater saß auf einem Stuhl neben ihrem Bett und wimmerte. Sein Blick war zu Boden gerichtet, doch sie brauchte seine Tränen nicht zu sehen, um zu wissen, dass etwas nicht stimmte.
„Was ist mit …?“ Ihre Stimme klang schwach und tonlos.
Dem Vater zersprang vor Kummer fast das Herz in der Brust. Nur langsam schaute er auf, als scheue er ihrem Blick.
„Was ist passiert? Was ist mit meinem Kind passiert?“
Er rang damit, nicht die Beherrschung zu verlieren. Seine Hände zitterten wie die eines Drogensüchtigen, der unbedingt einen neuen Schuss braucht, und sein Gesicht war bleich wie die Wand. Sein Körper verkrampfte sich, als er endlich antwortete.
„Die … die Ärzte sagen, es geht dir bald besser. In ein paar Tagen kannst du das Krankenhaus verlassen. Sie wollen nur noch ein paar Tests machen. Alles Routine, kein Grund zur Sorge.“
Seine Augen waren ausdruckslos, schwarz wie Höhleneingänge.
„Daddy“, sie hatte Mühe, ihre Stimme nicht zu erheben. Sie schaffte es, nach Aufbietung ihrer gesamten Kraft, ruhig und gefasst zu klingen. „Was ist passiert? Sag mir, was mit meinem Kind passiert ist!“
Ihre Augen bohrten sich in seine. Ihr Blick war wie ein Dolch, der in seine Netzhaut stach und schmerzte wie Feuer. Lange würde er ihm nicht standhalten können. Er konnte ihr nicht ausweichen. Ihre Augen, ihre Körperhaltung sprach eine nur zu deutliche Sprache. Sie schien bereits zu wissen, was geschehen war und wartete nur noch darauf, dass er es bestätigte.
Seine Hand suchte ihre. Sie war eiskalt, aber gleichzeitig nassgeschwitzt. Sie drückte ihre heftig.
„Habe ich mein Baby verloren?“
Der Vater war wie versteinert. Die ganze Zeit über hatte er nach Worten gesucht, falls es die überhaupt gab, hatte verzweifelt versucht, drumherum zu reden, ihre Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, ihre Konzentration auf anderes zu richten. Hatte er auch nur einen Augenblick geglaubt, sein Plan könne aufgehen?
Sabine wartete zwei Sekunden und fragte noch einmal.
„Habe ich mein Baby verloren? Sag es mir! Bitte! Wenn es so ist“, sie musste schlucken, denn die Endgültigkeit, die in dem Satz mitschwang, ließ fast ihre Stimme versagen, „wenn es so ist, will ich es aus deinem Mund hören und nicht von einem wildfremden Arzt, der mich mit trostlosen Augen anstarrt und dabei Mitleid heuchelt. Das könnte ich nicht verkraften. Jetzt nicht, und auch später nicht. Nie! Hörst du, nie! Also sage es mir bitte!“
„Es … es … es … es hatte einen Herzfehler.“
„Ist mein Baby gestorben?“
Ihre Stimme war jetzt gar keine Stimme mehr, nur noch ein Krächzen und Fiepen.
„Sie sagen, es ging so schnell, dass sie nichts gespürt hat.“
Da war er wieder, dieser Satz: Es ging so schnell. Wie sehr sie ihn hasste! Gab es einen abartigeren Satz in der menschlichen Sprache? Nein, nie und nimmer!
„Oh nein, nein, nein! Das stimmt nicht! Das kann nicht stimmen! Du erlaubst dir einen makabren Scherz, oder? Es stimmt nicht, nicht wahr? Sag mir, dass es nicht wahr ist! Sofort! Sie war doch noch nicht einmal geboren, wie soll sie da schon gestorben sein? Es ist nicht wahr! Es darf einfach nicht wahr sein!“
Mit diesen Worten fiel sie zurück in ihre Kissen.
Es schmerzte ihn, seine Tochter so leiden sehen zu müssen. Es tat ihm in der Seele weh. Aber er musste ihr die Wahrheit sagen. Er musste es tun, damit sie irgendwann loslassen und trauern konnte. Er wusste, wie wichtig Trauer war – erst recht, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Er wusste, dass er das Richtige getan hatte – und doch hasste er sich in diesem Moment dafür. Er wusste, dass dieses Gefühl ihn nun eine Weile nicht mehr loslassen würde.
„Es ist wahr, leider.“
Nun konnte auch der Vater seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie klammerten sich aneinander, schmiegten sich in die Arme des anderen und versuchten, einander ein wenig Trost zu spenden.
„Ich wollte doch noch so viel mit ihr unternehmen“, brachte sie stöhnend heraus, „sogar einen Namen hatte ich schon für sie: Sarah Gil!“
„Sarah Gil“, wiederholte der Vater. „Davon hast du mir gar nichts gesagt. Ein schöner Name. Bedeutet er etwas?“
„Ich weiß nicht. Aber er klingt nach etwas Besonderem, und weil mein Kind etwas Besonderes für mich ist, wollte ich ihm einen besonderen Namen geben.“
„Das verstehe ich.“
Sie saßen wortlos einander gegenüber. Jeder kämpfte mit Trauer und Wut. Irgendwie mussten sie beide damit fertig werden, dass der Tod schon wieder in ihr Leben gedrungen war, er schon wieder etwas unendliches Wertvolles zerstört hatte.
„Sabine, ich muss dir etwas über unsere Familie erzählen. Etwas, das schlimm und schrecklich ist, das aber mit der Zeit zu einem Teil von uns wurde. Wir, das heißt, du und ich …“
„Daddy, würde es dir etwas ausmachen, mich allein zu lassen? Ich brauche Zeit für mich. Sei mir bitte nicht böse. Ich will einfach allein sein. Bitte fahr jetzt nach Hause. Und mach dir um mich keine Sorgen, ich komme schon klar.“
„Bist du sicher?“
„Ja, das bin ich.“
„Kann ich dich morgen sehen?“
„Ich ruf dich an, wenn du wieder kommen kannst. Ja? Geh jetzt bitte. Und sei mir nicht böse.“
Sie dachte jetzt zurück an jenes Gespräch, während sie auf den Klippen stand und auf das weite, dunkle Meer sah. Inzwischen wehte ein schwacher Wind, der ihr Haar ausgelassen tanzen ließ.
Weit draußen am Horizont verschwand gemächlich ein Schiff. Ein gespenstischer Anblick; man mochte wirklich glauben, es würde langsam in die Tiefe gezogen.
Sabine fröstelte. Das Wetter hatte merklich umgeschlagen, doch das geschah in diesen Breiten öfter. Aus dem Sonnenschein war raueres Wetter geworden. Die Sonne versteckte sich hinter einer Armee von Wolken, und auch der Wind wurde stürmischer.
Ihr Vater hatte ihr an diesem Tag etwas Wichtiges sagen wollen, und seine Miene dabei hatte ihr keineswegs gefallen, hatte ihr sogar Angst gemacht. Die Falten in seinem Gesicht schienen plötzlich tiefer und zerfurchter, seine Augen blitzten dunkel, und seine Mundwinkel zitterten, als weigerten sie sich, etwas Dunkles preiszugeben.
Noch nicht.
Paul streckte sich auf dem Stuhl aus, bis seine Knochen knackten. Für heute sollte es genug sein. Er hatte zwar noch nicht sein altes Tagespensum geschafft, aber als erfahrener Schriftsteller wusste er, wann sein Pulver verschossen war. Er trank den inzwischen kalt gewordenen Kaffee, speicherte den Text und verließ das Arbeitszimmer.
Wie jedes Mal, wenn er geschrieben hatte, fühlte er sich wunderbar. Es war wie eine Sucht. Er brauchte es einfach, dieses Ringen um jeden Buchstaben, um jedes Wort, das Zusammensetzen der scheinbar aus dem Nichts kommenden Sätze und das Gefühl, durch neue, unbekannte Gefilde zu streifen. Wenn er Blatt um Blatt beschrieb, der Text langsam Form annahm, dann fühlte er sich so richtig glücklich. Dann war er zufrieden mit sich und der Welt.
Im Wohnzimmer warf er sich auf die Couch, griff nach der Fernbedienung und hüpfte durch die Programme. Langsam neigte sich der Tag seinem Ende entgegen. Nicht mehr lange, und er würde zu Bett gehen. Das Leben konnte so wundervoll sein. Oh ja, das konnte es.
Das Wetter war eine Katastrophe. Der Himmel war verhangen mit schwarzen Wolken, und dichter Regen fiel. Hinzu kam noch, dass ein strenger Wind blies. Die Luft war kalt, fast schon eisig, und kroch mit spielerischer Leichtigkeit durch die Haut bis auf die Knochen. Schon der Blick durchs Fenster genügte, um einen frösteln zu machen. Bei jedem x-beliebigem Menschen reichte das, um seine Laune auf den Nullpunkt sinken zu lassen. Aber nicht bei Paul. Er erfreute sich nach wie vor bester Laune.
Er stand am weitgeöffneten Fenster, trank Kaffee und glotzte glücklich in den Garten. Ein seliges Lächeln umspielte seine Mundwinkel, während er dem Regen lauschte, der in Sturzbächen vom Himmel stürzte. Es störte ihn nicht im mindesten, dass er, jedes Mal, wenn der Wind wehte, einen nasskalten Schauer abbekam. Er begrüßte diese Dusche sogar. Sie war so etwas wie ein Jungbrunnen für ihn. Er erschauerte kurz und wartete dann sehnsüchtig auf den nächsten Schwall.
Nachdem Paul eine Weile dem monotonen Prasseln der Tropfen gelauscht hatte, klang es in seinen Ohren immer mehr wie Maschinengewehrfeuer – eines, das unaufhörlich schoss und knallte und ratterte. Paul fand es amüsant, wie er diesen Vergleich zustande gebracht hatte. Schließlich waren das ja zwei Dinge: Der Regen lässt gedeihen und wachsen; er fördert also das Leben. Das Maschinengewehr aber kann nichts anderes, als dieses Leben wieder zu nehmen …
In diesem Moment kam ihm ein Gedanke: Wie wäre es, wenn er einfach nach draußen ging? Hinaus in den Garten, in die Frische, dem regnerischen Wetter zum Trotz?
Er beschloss, es herauszufinden und hüpfte durchs Fenster auf die Veranda. Fast augenblicklich war er durchnässt bis auf die Haut. Der Wind wuselte durch sein Haar und warf es mal hierhin und mal dorthin. Das Wasser auf seiner Haut war kalt, aber es fühlte sich phantastisch an. Die Haare an seinem Körper richteten sich auf, und seine Eier schrumpelten um mehr als die Hälfte zusammen; sie zogen sich sogar ein Stück tiefer in den Sack zurück.
Paul schleuderte die Pantoffeln in hohem Bogen von sich und betrat mit nackten Füßen den pitschnassen Rasen. Die Behaarung richtete sich gleich noch etwas mehr auf. Die einzelnen Haare waren jetzt so starr, dass man sie mit einem Stück Papier hätte abrasieren können. Jeder Grashalm kribbelte zwischen seinen Zehen, und die Wassertropfen schienen zu gefrieren auf seiner Haut.
Der Regen prasselte auf seinen Kopf und verklebte sein dünnes Haar, und von unten kroch die Kälte empor. Das wäre ein guter Grund gewesen, zurück ins Haus zu gehen, die nassen Kleider abzulegen, ein heißes Bad zu nehmen und es sich vor dem Fernseher gemütlich zu machen. Aber nicht für Paul. Statt ins Haus zu gehen, lief er weiter über die nasse Wiese, und statt eines heißen Vollbades nahm er ein eiskaltes Fußbad. Anfangs lief er noch langsam, um nicht hinzufallen, aber nach und nach merkte er, wie absurd diese Vorsicht war. Schließlich war er ohnehin schon bis auf die Knochen nass und da machte es keinen Unterschied mehr, wenn er auch noch eine Bauchlandung hinlegte.
Vor Euphorie kreischend, bretterte er über den durchweichten Rasen. Seine Füße fanden keinen Halt, und er rutschte unkontrolliert durch die Botanik. Immer wieder klatschte er auf den Hintern, gluckste vor Vergnügen und schnellte dann wieder hoch, wie von einem Gummiseil emporgerissen.
Zum Glück für ihn lag sein Haus abseits und er hatte keine Nachbarn. Denn sonst hätten diese mit Sicherheit die freundlichen Männer gerufen, die diese glänzenden weißen Kittel tragen und bei allem, was man sagt, immer nur „Ja, ja, schon recht, Napoleon“ erwidern.
Wie ein Känguru hüpfte Paul über den Rasen, schlug Haken wie ein Kaninchen und trällerte wie ein Vogel. Aber er machte sich deshalb keine Sorgen. Warum auch? Er war ausgelassen und tobte über sein Grundstück. Das war sein gutes Recht. Mein Glück ist kaum noch zu fassen, jubelte sein Verstand, und es wird mit jedem Tag noch besser!
Plötzlich hörte er hinter sich eine Stimme und fuhr herum. Das Ergebnis dieses Manövers war, dass seine Beine wegrutschten und er mit der Nase im Dreck landete. Auch das quittierte er mit animalischem Gelächter. Er blickte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war und sah erst einmal überhaupt nichts, nur Grashalme. Hastig schob er sie beiseite.
„Ja, ist es denn die Möglichkeit? Was hat dich denn hierher verschlagen?“
Jerome stand auf der Einfahrt und kauerte sich unter einem Schirm zusammen, aber da der Wind sich noch immer nicht entscheiden konnte, aus welcher Richtung er wehen wollte, sah er aus wie ein begossener Pudel. Sein Haar war an den Kopf geklatscht, als hätte er sich drei Tuben Gel hineingeschmiert, und seine Klamotten klebten an ihm wie ein zu enges Renntrikot. Auch er war nass bis auf die Knochen, konnte dem aber nicht halb so viel Begeisterung abringen wie Paul.
„Sag mal, ist bei dir alles in Ordnung?“ Seine Stimme klang seltsam – eine Mischung aus Amüsiertheit, Verdruss und Sorge.
„Warum fragst du? Wie kommst du darauf, bei mir könnte nicht alles in Ordnung sein?“
„Weil es für dich offensichtlich nichts Besseres gibt, als bei diesem verdammten Sauwetter wie ein Scheißkarnickel über diesen Scheißrasen zu hüpfen. Du musst zugeben, dass das schon ein klein wenig merkwürdig ist.“
„Gott oh Gott, wie kann man nur so spießig sein? Das ist echt affengeil! Solltest du auch mal probieren! Du fühlst dich dann echt prima!“
„Nein, danke. Kann ich mir gerade noch so verkneifen. Ob wir wohl endlich reingehen könnten? Ich friere mir hier draußen den Arsch ab.“
„Na schön, gehen wir halt rein.“
Paul folgte ihm widerwillig. Einen Moment fragte er sich, wie Jerome wohl hereingekommen war, aber die Frage konnte er sich selbst beantworten: Bestimmt hatte er mal wieder vergessen, die Gartentür abzuschließen. Ein leichtsinniger Fehler bei dem Gesindel, was sich da draußen herumtrieb.
Kurze Zeit später waren sie im Wohnzimmer: einer in der einen Ecke, der andere in der anderen. Jeder hielt ein Handtuch, mit dem er sich trocken zu rubbeln versuchte.
„Bist du sicher, dass du keine frischen Klamotten von mir willst? Wir haben so ziemlich die gleiche Größe.“
„Nee, nee, lass mal.“
„Na schön, wie du willst.“ Paul hob die Hände. „Aber wenn du mit einer Lungenentzündung flach liegst, vergiss nicht, ich hab dich gewarnt!“
„Ja, ja, Einwand zur Kenntnis genommen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse: Hat dir der Schnaps, den du aus meiner Hausbar entführt hast, wenigstens geschmeckt?“
Einen Moment lang wusste Paul nicht, wovon die Rede war. Das lag so weit in der Vergangenheit, dass es schon fast ein anderes Leben war.
„Das war mein bester Stoff, nur damit du es weißt! Sauteuer das Zeug, das kann ich dir sagen. Du hättest wenigstens einen Zettel hinlegen können.“
„Na ja, ich hatte halt Durst.“
„Ach was, der gnädige Herr hatte also Durst? Beklaust du da immer deine Freunde?“
„Jetzt halt aber mal die Luft an! Ich bezahl dir ja deinen Scheiß.“ Paul war außer sich. Doch kaum war der Satz gesprochen, war er auch schon wieder vergessen. Anscheinend wollte Jerome genau das hören, denn auch er beruhigte sich bereits.
Eine seltsame Stille herrschte. Die einzigen Geräusche waren Jeromes Schritte, der ruhelos durchs Zimmer lief und sich die Haare abtrocknete. Paul sah ihm amüsiert zu. Er lief mit weit ausladenden Schritten, und Paul musste an einen General denken, der die Front seiner Truppen abläuft und Parolen brüllt.
„Okay, was führt dich her? Irre ich mich, oder bist du nicht nur hergekommen, um nett mit mir zu plaudern? Raus mit der Sprache!“ Er sah Jerome fest in die Augen.
„Ja … also … nun, weißt du …“ Offensichtlich waren ihm die richtigen Worte entfallen.
„Drück dich bitte ein wenig verständlicher aus.“
„Nun ja, … äh … ich …“
„Ja, ja: Ich weiß schon. Das sagtest du bereits. Aber was ist nun mit dir? Wo drückt denn der Schuh?“
Diesmal war es an Jerome, „Hä?“ zu sagen. Offenbar war er nicht nur unfähig, in ganzen Sätzen zu sprechen, sondern zu allem Überfluss stand er auch noch mit beiden Beinen fest auf der Leitung. „Was denn für ’n Schuh?“
„Oh Mann. Vergiss es! Bist heut nicht auf dem Damm, was?“
„Sie hatte … sie hatte einen Unfall“, platzte es endlich aus Jerome heraus.
Pauls Miene wurde schlagartig ernst. Jegliche Fröhlichkeit war aus ihr gewichen. Ein Unfall? Unmöglich, ging es ihm durch den Kopf. Patrizia fuhr immer vorbildlich. Sie setzte sogar den Blinker, wenn sie in die Garage fuhr. Ihr musste jemand reingerauscht sein …
„Wenn ich das geahnt hätte! Sorry. Wie geht es ihr? Geht es ihr gut?“ Paul war erschüttert. „Bestell ihr liebe Grüße und gute Besserung von mir, ja?“
„Mit Patrizia ist alles in bester Ordnung. Ich spreche von Jeannine.“
„Was …?“
„Einen Motorradunfall. Es ist …“
„Stopp mal, ja? Du verarscht mich! Wie kann sie mit einem Motorrad einen Unfall bauen, wenn sie gar keinen Führerschein dafür hat? Erklär mir das mal!“
Während er das sagte, rannen ihm bereits Tränen die Wangen hinunter. Seine Frau hatte einen Unfall. Schon bei diesem Gedanken begann er am ganzen Körper zu zittern. Sein Magen krampfte sich zusammen und fühlte sich an, als hätte er glühende Kohlen geschluckt. Seine Knie knickten ein, und er sackte nach hinten weg. Zum Glück stand dort ein Sessel. Reglos blieb er sitzen, während seine Gesichtsfarbe ins Aschgraue überging. Ihm war plötzlich speiübel, und am liebsten hätte er sich die Gedärme aus dem Leib gekotzt.
„Wie … wie ist das passiert?“
„Man weiß noch nichts Genaues. Nur so viel ist sicher: Sie hat wahnsinniges Schwein gehabt. Das Motorrad …“
„Ich verstehe das nicht! Wie konnte das nur passieren?“ Pauls Stimme bebte.
„Es ist eben geschehen. Ein unachtsamer Augenblick, und …“
„Nein, das meine ich nicht! Wie kommt sie bitteschön zu einem Motorrad? Das kapier ich nicht, beim besten Willen nicht!“ Hilfesuchend und mit tränenüberfluteten Augen sah er Jerome an.
Jerome wich seinem Blick aus. Dieser Bastard wich einfach seinem Blick aus und setzte an einer anderen Stelle wieder an.
„Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie hat keine ernsthaften Verletzungen davongetragen. Ein paar Prellungen, jede Menge Hautabschürfungen und reichlich blaue Flecken und einen abgebrochenen Fingernagel, hat sie gesagt.“
„Hat sie dir gesagt?“
„Nein, verdammt, sie hat Patrizia angerufen!“
Vor Überraschung klappte Paul die Kinnlade runter und er vergaß glatt zu fragen, wie zum Teufel sie auf ein Motorrad kam. Das musste er erstmal verdauen. Sie hat Patrizia angerufen. Mann, das tat verdammt weh. Sicher, sie waren so gut wie getrennt. Aber sie waren es eben noch nicht ganz. Warum zum Kuckuck kann sie mich nicht selbst anrufen? Warum muss ich das von anderen erfahren? Und was ist mit den Kindern?
„In welchem Krankenhaus liegt sie?“
„Tut mir leid. Das darf ich dir nicht sagen.“
„Was? Warum denn das nicht?“
„Sie will es nicht. So einfach ist das.“
„Ach, sie will es also nicht! Was will sie denn, wenn ich mal fragen darf?“
„Langsam, langsam, Paul! Ich bin nur der Bote. Ich weiß ja, dass du verletzt bist. Ich kann das sehr gut nachempfinden …“
„Das kannst du, ja?“
„… Ich bin hier als dein Freund …“
„Soll ich lachen?“
„… und als ein solcher spreche ich zu dir …“
„Verpiss dich!“
„Ich soll dir von ihr ausrichten, dass die Kinder bereits auf den Weg nach Australien sind. Und bis auf weiteres bei den Großeltern bleiben.“
Jeannines Eltern waren vor ein paar Jahren nach Australien ausgewandert. Gleich nachdem sie in den Ruhestand gegangen waren. Irgendwo inmitten der Pampa, wie er immer treffend bemerkt hatte. Mehr als dreihundert Meilen von der nächstgrößeren Stadt entfernt. Und dort wollte sie allen Ernstes die Kinder lassen?
Autsch, das versetzte ihm gleich noch einen Schlag. Seine gute Laune war vollends verschwunden, und er hatte die finsterste Leichenbittermiene aufgesetzt, die er zustande brachte. Dass sie ihm die Kinder weggenommen hatte, war ihr nicht genug, nein, sie wollte sie auch lieber den Eltern übergeben als ihm, ihrem Vater! Was war er denn? Ein Stück Dreck, das man einfach vom Schuh wischen konnte? Ja, er hatte viele Fehler während seiner Ehe gemacht, das war ihm jetzt klar. Aber er hatte den Kindern nie etwas Böses getan. Er hatte sie geliebt, mehr als …
Paul stotterte: „Ins Flugzeug … nach Australien … zu den Großeltern?“
Jerome wollte etwas erwidern, aber was er auch sagte, es würde falsch sein.
„Tut mir leid, dass du es von mir erfahren musstest. Anscheinend will sie keinen Kontakt mehr zu dir.“
„Das habe ich erwartet, und ich muss zugeben, dass es mir vollkommen egal ist.“ Erstaunlicherweise stimmte das sogar. „Was schmerzt, ist, dass sie Benny und Stefanie die Strapazen einer solchen Reise zumutet! Und dann auch noch allein! Gottverdammt, sie benimmt sich gerade so, als müssten sie vor mir beschützt werden! Als würde ich ihnen was Böses wollen!“
„Das bildest du dir nur ein.“ Bestimmt ein gutgemeinter Einwand, aber er trieb Paul nur noch mehr auf die Palme.
„Schwachsinn! Von wegen, ich bilde mir das nur ein! Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, was hier gespielt wird! Sie will, dass die Kinder sich von mir abwenden, dass sie sich von ihrem eigenen Vater abwenden! Ich hätte nie gedacht, dass sie zu so was fähig ist. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe sie über alles. Ich habe sie nie missbraucht, nie geschlagen oder sonst was mit ihnen angestellt. Ich hab sie immer gut behandelt und war ihnen immer ein guter Vater. Das ist pure Rache, das weiß ich! Sie weiß, wie weh mir das tut, wie ich an den beiden hänge und jetzt versucht sie, sie mir zu entfremden. Dieses Aas! Dieses verdammte, hinterfotzige Aas!“
„Sachte, sachte! Nun beruhige dich doch erstmal!“ Jerome wollte beschwichtigend auf ihn zugehen, doch noch ehe er einen Schritt machen konnte, bellte Paul wieder los.
„Wie soll ich mich da beruhigen, hä? Du hast gut reden! Deine Kinder sollen ja nicht ans andere Ende der Welt!“ Paul sprang vom Sessel. Er hatte eine Wut im Bauch, als könnte er explodieren. In seinen Mundwinkeln sammelte sich Schaum wie bei einem tollwütigen Hund. Mit voller Wucht trat er gegen den Fernseher, bis die Bildröhre implodierte. Er war so in Rage, dass er davon nichts bemerkte. Wie konnte sie das nur tun? Wie konnte sie ihm das antun? In seiner Wut zertrümmerte er nicht nur den Fernseher, sondern auch die Stereoanlage, die er erst vor kurzem mühevoll wieder aufgerichtet hatte.
Allmählich bekam Jerome es mit der Angst zu tun. Er hatte Paul noch nie so gesehen. Besorgt fragte er sich, ob er alles hier drinnen demolieren würde. Obwohl sein Verhalten ihm unheimlich war, verstand er ihn. Auf irgendeine Art verstand er ihn sogar gut. Wahrscheinlich lag das daran, dass er genauso reagiert hätte, wäre er an seiner Stelle gewesen.
Schließlich legte Jerome sein Unbehagen ab und näherte sich ihm. Er sah, dass Paul Tränen in den Augen standen und er am ganzen Körper zitterte. Vorsichtig legte er die Hand auf seine Schulter. Auch sie zitterte. Offenbar fürchtete er einen tätlichen Angriff. Und das lag durchaus im Bereich des Möglichen, schließlich waren schon aus weit weniger gewichtigen Gründen Schlägereien entstanden.
Paul beäugte alles argwöhnisch, ließ es aber ohne Gegenwehr geschehen. Er war sich noch immer nicht sicher, was er von alledem halten sollte. Noch vor wenigen Sekunden war er wie ein junger Hund ausgelassen durch den Garten getobt, hatte sich wie eine Wildsau im Dreck gesuhlt, und nur Augenblicke später, war er wieder am Boden zerstört. Schluchzend ließ er sich fallen und flennte wild drauflos.
Jerome fühlte sich immer unwohler. Was sollte er tun? Ihn trösten? Oder ihn einfach weinen lassen? Vielleicht war es besser, wenn die Tränen ungehindert flossen. Manchmal gab es Tränen, die geweint werden mussten.
Er lief zur Hausbar, mixte eine Bloody Mary und überreichte sie Paul. Das wird ihn beruhigen, dachte er. Zu seiner Verwunderung schnupperte Paul nur daran, verzog angewidert das Gesicht und schüttete es über die Schulter.
„He, was soll das denn? Bist du verrückt? Das Zeug wird dir guttun!“
„Das halt ich für ‘n Gerücht. Das macht alles nur noch schlimmer, glaub mir.“
„Na schön, wie du meinst. Du musst es ja wissen.“ Mit diesen Worten ging er zurück zur Bar und mixte sich selbst einen Drink. Er brauchte dringend etwas Starkes, Hochprozentiges. Jerome nippte vorsichtig an seinem Glas und ließ sich in sicherem Abstand auf einem Sessel nieder.
Paul saß auf dem Boden, hatte die Knie an die Brust gedrückt und starrte ins Leere. Er sah aus wie ein Häufchen Elend.
„Eine rauchen?“ Jerome sprach langsam und deutlich und rechnete nicht mit einer Antwort. Umso überraschter war er, dass Paul reagierte.
„Was?“
„Wollte nur wissen, ob du eine rauchen willst. Meine Lunge pfeift wie ein Schwarm Spatzen vom Dach. Und was tut man da? Man smokt eine.“
Paul begriff noch immer nicht. Er strahlt die Intelligenz eines Hammers aus, wie er so dahockt, dachte Jerome und kämpfte gegen ein Grinsen an.
Allmählich dämmerte es Paul, und ein dümmliches Grinsen wanderte über sein Gesicht. „Ob ich eine Zigarette will, hast du gefragt, stimmt’s?“ Er schien von dieser Erkenntnis hellauf begeistert zu sein.
Oh Mann, Paul war heute echt nicht der Schnellste! Jerome ließ sich nichts anmerken und warf ihm wortlos die Schachtel mitsamt Feuerzeug hin.
Ein paar Minuten lang saßen sie schweigend da, zogen an den Kippen und sahen einander unschlüssig an. Keiner hatte eine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Und noch immer fiel der Regen in Fäden vom Himmel, rann an den Scheiben, perlte an den Blättern ab und tropfte zu Boden. Er schien sogar noch stärker geworden zu sein. Allerdings war Paul die Lust vergangen, in ihm herumzutollen. Abrupt stand er auf, sah Jerome in die Augen und fragte noch einmal, diesmal mit energischer Stimme: „In welchem Krankenhaus?“
„Ich hab dir schon gesagt, dass ich es dir nicht sagen darf.“
Paul gab sich damit keineswegs zufrieden. Er schnippte die Kippe auf den Teppich, beobachtete amüsiert, wie sie ein Loch hineinbrannte und trat sie widerwillig tot. Am liebsten wäre ihm gewesen, wenn der verdammte Scheißteppich mitsamt der ganzen Bude in Flammen aufgegangen wäre. Festen Schrittes näherte er sich Jerome.
„Hör zu, du Scheißkerl …“
„Aber, aber. Ich muss doch sehr bitten!“ Jerome war entrüstet über den verbalen Ausbruch, wagte aber nicht, energischer zu protestieren. Pauls leerer Blick ängstigte ihn noch mehr als zuvor, und er hielt es für ratsam, nicht die große Klappe zu haben. Er merkte, dass er mehr und mehr in seinem Sessel versank. Mit jedem Schritt, den Paul näherkam, schrumpfte er ein paar Zentimeter. Er spürte es, aber er war außerstande, etwas dagegen zu tun. Auch Paul sah, wie er zu Schlumpfgröße mutierte. Der Anblick befriedigte ihn. Schließlich war er es gewesen, der den guten Tag in die Tonne getreten hatte. Er musste jemanden gehörig ans Bein pissen, und da Jerome nun einmal da war, musste er eben herhalten.
„Hör zu, du Pisser!“
Diesmal wagte Jerome es nicht, aufzumucken.
„Was glaubst du eigentlich, was das hier werden soll, hä? Kommst einfach hierher und versaust mir einen wundervollen Tag! Erzählst mir, dass meine Frau einen Unfall hatte, aber nicht, in welcher Scheißklinik sie liegt. Erzählst mir, dass unsere gemeinsamen Kinder (und die Betonung liegt auf gemeinsam!) auf dem Weg ins Känguruland sind. Hast du auch nur einen blassen Schimmer, wie lange man dahinfliegt? Mehr als zwanzig Stunden! Glaub mir, das ist purer Stress! Warum mutet sie das den beiden zu? Gottverdammt, werde ich denn überall übergangen? Ich darf meine eigenen Kinder nicht sehen, aber das Flugticket zahlt sie von meinem sauerverdienten Geld! Aber wenn dieses Miststück glaubt, ich lass mich hier so einfach abservieren, hat sie sich ins Fleisch geschnitten! Ohne mich! Da mache ich nicht mit! Sag mir jetzt, wo sie ist! Und verschon mich mit Ausreden! Raus mit der Sprache! Wo liegt sie?“
Jerome, der mittlerweile zur Größe eines Reiskornes geschrumpft war, wurde noch etwas kleiner. Paul starrte ihn so verbissen an, dass er es bereute, hergekommen zu sein. Welcher Esel hat mich bloß geritten, dachte er wieder und wieder, während er fürchtete, in den Ritzen des Sessels zu versinken.
„Ich warte.“ Ungeduldig klopfte Paul mit den Füßen auf dem Boden herum.
„Sie ist …“
„Ja? Wo denn nun? Ich höre nichts!“
In diesem Moment warf Jerome alle Versprechungen über Bord und verriet es Paul. Er dürfte es um nichts auf der Welt verraten, hatte sie ihm eingebläut. Aber das war leichter gesagt als getan, wenn man jemand gegenüber saß, der nicht nur nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte, sondern überhaupt kein Geschirr mehr besaß.
Genau neunzehn Minuten und dreiundfünfzig Sekunden später stand Paul am Eingang des St. Georgien Hospitals. Unentschlossen zupfte er an seinem T-Shirt und ging hinein. Jerome hatte ihm verraten, wo sie lag und war dann wie ein angestochenes Schwein davongesaust – nicht, ohne ihm vorher einen Besuch bei einem Psychiater zu empfehlen. Und kaum dass Jerome sich aus dem Staub gemacht hatte, war Paul in den Porsche gesprungen und wie ein Teufel durch die Stadt gefahren. Das St. Georgien Hospital lag ein wenig außerhalb inmitten eines großen Waldstückes.
Paul fuhr die ganze Zeit mit Vollgas, das Gaspedal war bis zum Boden durchgetreten, und sein Schutzengel musste Überstunden machen, ob er nun wollte oder nicht. Als er durch den Regen preschte, überlegte er kurz, warum sie Jerome zu ihm geschickt hatte. Wollte sie ihn eins auswischen? Hatte sie Spaß daran, ihn zu quälen? Scheinbar ja. Er sah keinen anderen Grund.
Jetzt, da er sich im Eingangsbereich des Krankenhauses befand, hielt er das Ganze gar nicht mehr für eine so gute Idee. Paul hatte Bedenken, ob der Weg, den er eingeschlagen hatte, richtig war. Was erwartete ihn? Wie würde Jeannette reagieren? Ob sie ihn überhaupt beachtete? Paul kannte sie gut genug. Er wusste, wozu sie fähig war. Er hatte das in den letzten Tagen oft genug erfahren müssen.
All das ging ihm durch den Kopf, als er langsam weiterging. Es konnte seine Schritte bremsen, ihn aber nicht aufhalten. Was ihn aufhalten konnte, war die Angst vor seiner eigenen Reaktion. Bei dem Ganzen hatte er sich kein einziges Mal Gedanken um sich selbst gemacht. Wie werde ich reagieren? Kann ich mich beherrschen oder raste ich einfach aus und falle wie eine wildgewordene Hyäne über sie her? Oder bin ich imstande, mich ruhig und gesittet zu verhalten? Da das alles noch im Dunkeln lag, entschloss er sich, weiterzugehen und es auf einen Versuch ankommen zu lassen.
Die Schritte führten an der Cafeteria vorbei, und hier lag ein Duft von Gebäck, Kuchen und Kaffee in der Luft. Aber da war auch noch etwas anderes. Paul stockte einen Augenblick. Vor Jahren war sein Vater in genau diesem Krankenhaus an Krebs zugrunde gegangen, und dieser Geruch brachte ihm das wieder so in Erinnerung, dass er meinte, es sei gestern gewesen. Warum meinte man in einem Krankenhaus immer die Gegenwart des Todes zu spüren? Nirgends war er so präsent wie dort. Paul glaubte, dass dies den Besuchern noch deutlicher gewahr wurde als den Patienten. Vielleicht vernebelte der Tod einem die Sinne, sodass man, wenn man einige Zeit unter seinem Einfluss stand, gar nichts mehr davon mitbekam?
Paul riss sich aus seinen Gedanken und sah sich verstohlen um. Hatte er etwa wie ein Idiot dagestanden, mit weitgeöffnetem Mund und Augen so groß wie Suppenteller? Schließlich ging er weiter.
Pling, machte es, als sich die Fahrstuhltür hinter ihm schloss. Jetzt stand er im vierten Obergeschoss. Es sah hier genauso aus wie im Erdgeschoss, nur die Cafeteria fehlte. Langsamen Schrittes ging er weiter. Der Flur lag vor ihm im Halbdunkel. Vereinzelt stand eine Tür offen. Aus dem Schwesternzimmer dudelten leise Oldies, und ab und an stöhnte jemand. Es klang wie eine stumpfe Säge auf Holz. Seine Nackenhaare richteten sich nach oben; er hatte ein Déjà-vu-Erlebnis. Damals, als er seinen Vater zum letzten Mal lebend gesehen hatte, hatte er das gleiche quietschende Geräusch gehört. Es war von seinem Vater gekommen, der solche unerträglichen Schmerzen hatte, dass jeder Atemzug einem Krächzen glich. Wenige Stunden später war es vorbei gewesen.
Paul stand stocksteif da und nahm es kaum wahr, als eine Schwester an ihm vorbeihastete. Die Erinnerung an seinen Vater war schmerzlich, aber fehl am Platz. Jetzt hieß es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da konnte er diesen Schmerz nicht brauchen. Es überraschte ihn, wie er den Vater in diesem Moment plötzlich vermisste. Aber vielleicht lag das auch nur an den unangenehmen Erinnerungen, die die Umgebung in ihm wachrief. Er musste schnellstmöglich auf andere Gedanken kommen. Schließlich war sein Vater seit mehr als zehn Jahren unter der Erde. Hatte er, Paul, je um ihn geweint?
Langsam löste sich die Starre, und er lief langsam den Flur hinunter. Aufmerksam studierte er die Zimmernummern. Hatte Jerome vierhundertsechzig oder vierhunderteinundsechzig gesagt? Egal, ein Versuch konnte nicht schaden.
Vierhundertsechzig war die erste. Er trat ein, ohne anzuklopfen.
Als er in das Zimmer trat, traf ihn fast der Schlag. Ja, es war das Zimmer seiner Frau. Aber als er sah, was er sah, wünschte er sich sehnlichst, er wäre nie hergekommen.
Jeannette hatte ein Einzelzimmer. Kein Kunststück, schließlich war sie privat versichert. Um ihren Kopf war ein Verband gewickelt, auf dem sich rote Flecken abzeichneten. Trotzdem war sie noch immer so schön, wie er es in Erinnerung hatte. In ihrem Gesicht tummelten sich Sommersprossen, und ihre Lippen schienen fast noch voller als bei ihrer letzten Zusammenkunft. Ihr langes Haar, das unter der Bandage hervorlugte, war gepflegt, wenn auch blutig. Einen Moment meinte Paul sogar, es riechen zu können. Als sie noch ein frischverliebtes Paar waren, hatte er ihr öfter das Haar gewaschen. Wieder etwas, was er schon lange nicht mehr getan hatte, wurde es ihm siedend heiß bewusst. Das einzige, was ihre Schönheit ein wenig entstellte, war der Bluterguss an ihrer linken Wange. Er erstreckte sich fast über die gesamte Gesichtshälfte. Sie musste böse hingefallen sein. Aber nicht der Bluterguss war es, der ihm einen Schlag versetzte, sondern der wildfremde Mann, der da auf ihrem Bett saß und ihre Hand hielt. Einen Moment war er so naiv zu glauben, es sei der Arzt. Allerdings hielt das nur den Bruchteil einer Sekunde vor. Wenn aber nicht der Arzt, wer dann? Wer?
Langsam dämmerte es ihm. Das hatte er weniger seiner Intelligenz als vielmehr dem ramponierten Aussehen des Mannes zu verdanken. Er sah aus, als hätte er vor nicht allzu langer Zeit einen Unfall gehabt. Einen … Motorradunfall vielleicht? Aber das hieße ja … nein, nein! Oder doch? War das möglich?
Mit einem Mal war ihm speiübel.
He, was soll das, wollte er sie anfahren, aber er brachte kein Wort heraus. In seinem Kopf leuchtete immer wieder ein einziger Satz auf, wie eine Leuchtreklame. Er war hell und grell und verkündete in roten, blauen, grünen und gelben Lettern: Diese verdammte Saubande hat ein Techtelmechtel! Diese verdammte Saubande hat ein Techtelmechtel! Diese verdammte Saubande hat ein Techtelmechtel! Diese verdammte Saubande hat ein Techtelmechtel! Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Licht an.
Wie sie sich anstarren, igitt! Sie haben mich noch nicht mal bemerkt. Warum, zum Henker? Fieberhaft sann er über den Grund nach. Da verschwand endlich die Neonreklame aus seinem Kopf. All das geschah im Bruchteil einer Sekunde. Plötzlich ein dumpfer Knall hinter ihm. Die Zimmertür. Aha, dachte er, darum kam ich mir vor wie Luft.
Nun sahen auch Jeannine und der Fremde zu ihm herüber, und ihre Gesichter sprachen Bände. Sie waren kreidebleich und hatten Ähnlichkeit mit denen von halbstarken Rotzbengeln, die irgendeinen Blödsinn getrieben haben, auf frischer Tat ertappt worden sind und nun der Bestrafung harren.
„Was geht hier vor?“, donnerte es aus Pauls Mund.
„Was willst du hier?“, spie Jeannine ihm entgegen.
Das war keineswegs die Reaktion, die er erwartet hatte. Noch dazu, dass sie auf einmal wie eine tollwütige Hyäne wirkte. Ihre Augen schossen Giftpfeile in seine Richtung, und ihre Stimme war wie Eis. Paul ließ sich davon nicht abschrecken und fragte noch einmal, was los sei. In seinem Inneren fragte eine altkluge Stimme, ob das etwa nötig war, ob er so blind war und es nicht sehen konnte. Er ließ die Stimme links liegen und schenkte ihr keine Beachtung.
„Woher weißt du …? Ach, vergiss es! Hätte ich mir gleich denken können, dass dieser Kerl sein Schandmaul wieder nicht halten kann. Also, was willst du, Paul? Aber fass dich bitte kurz, ja? Ich kann deinen Anblick keine Sekunde länger als unbedingt nötig ertragen.“
Peng. Der Hieb in die Magengrube hatte gesessen. Das musste Paul erstmal verdauen. Aber so hatte er wenigstens einen Augenblick Zeit, seine Gedanken zu ordnen. Was zum Henker wollte er hier? Eine verdammt gute Frage, die sie ihm da gestellt hatte. Was wollte er eigentlich hier? Tja, meine Damen und Herren Geschworenen, was soll man dazu sagen? Er hatte selbst keinen blassen Schimmer. Anfangs hatte er noch eine gehörige Wut im Bauch gehabt, aber die war inzwischen verschwunden. Jetzt war da nur noch Leere, gähnende Leere. Also, warum zum Kuckuck, war er hier? Er musste sich eingestehen, dass er darauf keine Antwort wusste. Also war es wohl besser, die Frage einfach zu übergehen und an einer anderen Stelle weiterzumachen.
„Wo sind die Kinder?“
Zugegeben, das war auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, schließlich wusste er ja, wo sie waren. Aber es war immerhin ein Anfang. Er konnte nach ihnen fragen. Er hatte schließlich ein Recht, es zu erfahren. Das war jedenfalls seine Ansicht zu dem Thema. Jeannine allerdings war da anderer Meinung.
„Das geht dich einen verdammten Scheißdreck an, geht dich das.“
Wieder hatte Paul etwas zu verdauen. So allmählich nimmt das überhand, dachte er. Die Wut, die ihn hierhergeführt hatte und die schon abgeflaut war, loderte wieder auf. Aber sie war hier so nützlich wie ein Kropf. Also versuchte er sie, so gut es eben ging, herunterzuschlucken.
„Bloß damit ich das richtig verstehe, es geht mich einen verdammten Scheißdreck an, wo meine eigenen Kinder sind, aber für die Flugtickets darf ich löhnen? Habe ich das richtig verstanden? Was glaubst du eigentlich, wen du vor dir hast?“
„Einen egoistischen, blinden Idioten.“
Diesmal ging der Schlag nicht in die Magengrube, sondern mitten ins Herz. Alle Hoffnungen auf eine friedliche Lösung des Konfliktes zerplatzten wie Seifenblasen.
„Ich will wissen, wo meine Kinder sind! Und deine Beleidigungen kannst du dir sparen! Die prallen an mir ab!“ Aber seine Augen verrieten etwas anderes. Aber noch konnte er sich beherrschen, konnte die Tränen zurückhalten, obwohl seine Augen schon wässrig waren. Er hatte ein wenig Respekt von ihr erwartet, aber was er hier bekam, war nur Scheiße und Verachtung. Wie schnell Liebe in Hass umschlagen konnte!
„Ach übrigens, ehe ich es vergesse: Du hast dich doch ebenso darüber erregt, dass du die Flugtickets bezahlen sollst, oder? Da habe ich eine gute Nachricht für dich: Das muss dich nicht mehr kümmern. Ich habe sie bezahlt und“, sie sah auf die Uhr an der Wand, „wenn ich mich mit dem Zeitunterschied nicht verrechne, müssten sie jede Sekunde landen. Du siehst also: Du wirst noch nicht mal mehr dazu gebraucht.“
„Wo … wo hast du das Geld her? Wieso hast du das getan?“
Paul stotterte. Jetzt konnte er die Tränen nicht mehr zurückhalten. Was für ein beschissener Tag! Kann kaum noch schlimmerer werden, dachte er. Ein paar Sekunden später wusste er, dass es das sehr wohl konnte.
„Du wagst es zu fragen, woher ich das Geld habe?“ Diesmal klang ihre Stimme wie eine rostige Kette. „Na schön, ich werde es dir verklickern. Aber schön langsam, damit du es auch schnallst. Er hier“, jetzt deutete sie auf den Mann, der auf ihrem Bett saß, „hat es mir gegeben.“
Paul fiel aus allen Wolken. Er hatte die Anwesenheit des Fremden völlig vergessen. Bis jetzt.
„Und er ist es auch, der ab jetzt die Rolle ihres Vaters übernehmen wird.“
Einen Moment wurde es Paul schwarz vor Augen, und fast wäre er nach hinten weggesackt.
„Und nun tu mir bitte einen Gefallen und verpiss dich. Du widerst mich an.“
Paul war so perplex, dass er es tat.
Den Weg vom Zimmer zum Wagen legte er zurück wie im Delirium. Alles um ihn herum schien in einer anderen Dimension stattzufinden, Lichtjahre von dem entfernt, was einmal sein Leben gewesen war. Er hatte Mühe, aufrecht zu gehen. Seine Beine zitterten wie Götterspeise, und seine Muskeln besaßen in etwa die Stärke eines Marmeladenbrotes.
Mit letzter Kraft erreichte er den Porsche, ließ sich in den Sitz fallen, und von da an konnte er den Tränen keinen Einhalt mehr gebieten. Sie flossen in Sturzbächen und durchweichten seinen Hemdkragen. Er ließ es einfach geschehen. Es waren Tränen, die geweint werden mussten. Sie kribbelten auf seiner Haut und brannten. Es war ihm egal. Er wollte nur noch weinen. Weinen wie ein Schlosshund und nie wieder aufhören.
Langsam verschwand der letzte Fetzen Helligkeit, und noch immer saß er da, rauchte eine Zigarette nach der anderen und machte keine Anstalten, nach Hause zu fahren. Unzählige Menschen waren an ihm vorbeigekommen. Die Besuchszeit rückte heran, und der Menschenstrom wurde dichter. In vielen dieser Gesichter stand die Sorge um ihre Angehörigen geschrieben. Ja, dachte er, ein Krankenhaus ist wahrlich ein beschissener Ort. Ein Ort, wo Menschen sterben. Ein Ort, wo Frauen zu Witwen, Männern zu Witwern und Kinder zu Waisen werden. Wie bei ihm selbst. Wenn auch auf andere Art und Weise ….
Er drückte die Zigarette aus und zündete sich sofort eine neue an. Sein Hals fühlte sich trocken an und rau; trotzdem wollte und konnte er nicht auf sie verzichten.
Irgendwann endete die Besuchszeit. Wie viele Stunden saß er nun schon hier? Er hatte keine Ahnung. Mittlerweile mussten es schon fünf sein. Je später es wurde, umso verlassener wirkte die Straße. Nur ab und zu näherte sich ein Krankenwagen mit raschem Tempo, bog ab und verschwand hinter einer hohen Mauer. Paul brauchte kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass da neue Kundschaft eingeliefert wurde.
Während er kettenrauchend dasaß, dachte er über vieles nach. Er dachte an viele Dinge, aber am meisten an den Satz, den sie ihm an den Kopf geknallt hatte: Du widerst mich an.
Gab es da noch etwas misszuverstehen? Wohl kaum. Das war eindeutig. Es gab kaum einen Satz, der mehr verriet als dieser. Wenn er noch Zweifel an ihren Trennungsabsichten gehegt hatte, dieser Satz hatte sie ausgelöscht. Und ihr Geliebter (mittlerweile hatte er es geschnallt, dass es ihr Geliebter war) hatte bei ihr gesessen, hatte ihre Hand gehalten und, was am Schlimmsten war, er hatte die Tickets der Kinder bezahlt. Selbst das hatte sie ihm genommen.
Wieder näherte sich ein Krankenwagen, diesmal ohne Martinshorn und deutlich langsamer. Wieder bog er rechts ab und verschwand hinter der Mauer.
Warum wollte sie, dass er das alles erfuhr? Konnte sie so gehässig sein? Er konnte sich noch immer keinen Reim darauf machen.
Paul fühlte sich wie durch den Fleischwolf gedreht. Er war durstig, sein Kopf schmerzte wie nach tausend Nadelstichen, und seine Eingeweide schienen Polka in Holzpantoffeln zu tanzen. Er war müde, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen. Trotz allem kam es ihm nicht in den Sinn, den Motor zu starten und heimzufahren.
Irgendwann schälte er sich aus dem Sitz und schlich mit hängendem Kopf in eine dunkle Ecke, öffnete den Hosenschlitz und entleerte seine Blase. Keine zwei Minuten später saß er wieder im Wagen, hatte eine Kippe zwischen den Lippen und beobachtete die dunkle Straße. Zwei, drei Stunden später, es musste schon nach Mitternacht sein, entschied er sich endlich, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und heimzufahren.