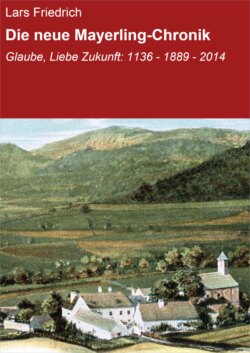Читать книгу Die neue Mayerling-Chronik - Lars Friedrich - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеChronik 2.000 v. Chr. – 1869
2.500 vor Christus
Vor rund 4.500 Jahren kommen die Siedler der Kupferzeit vom Ostrand der Alpen durch das Schwechattal in das Allander Becken – über jenen Weg, dem noch heute die Bundesstraße 25 folgt. In Mayerling gibt es wahrscheinlich schon zur Zeit der Lengyelkultur (um 2.500 vor Christus) Leben. Das Tal der Schwechat ist ein gutes Jagdrevier und ein sicherer Siedlungsplatz, wovon archäologische Funde auf dem Buchberg bei Alland, aber auch aus der Arnsteinhöhle bei Maria Raisenmarkt, zeugen.
um Christus Geburt
Wahrscheinlich führt in der Römerzeit ein Ost-West-Weg von Aquae, dem frühmittelalterlichen Padun (Baden), entlang der Schwechat an Mayerling vorbei in die Gegend von Aelium Cetium (St. Pölten). Obwohl Bodenfunde aus dieser Zeit in Mayerling fehlen, deutet das spätere Kirchenpatrozinium des Heiligen Laurentius auf eine frühe römische Besiedelung hin.
01.11.1002
Zu Beginn des 11. Jahrhunderts wird eine christliche Gemeinde in Alland genannt: Der deutsche König Heinrich II. (reg. 1002-1024) erwähnt mit einem ähnlich klingenden Ortsnamen das Gebiet zwischen Triesting und Dürrliesing in einer Schenkungsurkunde. Die „Urpfarre des Wienerwaldes“ wird Privatbesitz des herrschenden Babenbergers, des Markgrafen Heinrich I. (reg. 994-1018).
1115 bis 1135
Erstmals wird die Pfarre Alland im Zehentvertrag von Greifenstein im September 1135 namentlich erwähnt, wobei eine Kirche mit dem Doppelpatrozinium St. Georg und St. Margareta schon 1115 im Patronatsbuch des Stiftes Klosterneuburg aufgeführt wird und ein einschiffiger hölzerner Vorgängerbau aus dem 8. Jahrhundert wahrscheinlich ist. Alland wird „allod“, „adeleth (1135)“ oder „adel achte“ genannt, was „adeliger Besitz“ bedeutet. Zwischen 1125 und 1130 wird der erste Allander genannt: Adelhart de Adelathe.
02.06.1136
1136 stellt der Stifter des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz, Markgraf Leopold III. (reg. 1095-1136, 1485 heilig gesprochen, seit 1663 niederösterreichischer Landespatron), Mayerling den „Taufschein“ aus: „Ab eo loco, ubi confluunt Satelbach et Swechant, usque Murlingen, ab inde, sicut dirigitur uia, que dicitur uia molendini, usque ad priuentan et per eandem uiam, que girat priuentan, usque ad locum, qui dicitur hausruch“ (Fontes Rerum Austriacarum XI, Nr. 1/001). In der vorletzten Zeile der Gründungsurkunde der neuen Abtei am Sattelbach müssen sich Ozo (a.a.O. auch Opo oder Otho ) und Otfridus (a.a.O. auch Ottfried oder Otfrid) von Murlingen neben 14 weiteren Nachbarn für die Wahrhaftigkeit des Dokumentes und die Richtigkeit der Grenzziehung verbürgen. Schenkt man dem Dokument Glauben, verläuft die Grenze der Klosterneugründung vom Zusammenfluss des Sattelbaches und der Schwechat an ihrem Ufer entlang nach Mayerling und von dort, im rechten Winkel der hochmittelalterlichen „via molendini“ (Mühlenweg, später Preinsfelder Weg) folgend, hinauf zur Allander Höhe.
Ozo von Mayerling besitzt ein freies Eigen mit Herrenhaus und Wirtschaftshof im heutigen Areal der beiden Klöster. Otfridus von Mayerling lebt auf dem strategisch günstiger gelegenen Steinhof, einem turmartigen Herrensitz mit Meierei auf der anderen Schwechatseite (der Steinhof lag auf Grundparzelle 176, oben, 170, 171/1, auf einer jetzt aufgeforsteten Wiese vor dem Eintritt in das Kalkmassiv des Hohen Lindkogels nahe dem Landschaftsschutzgebiet rund um den Felskomplex der Bischofsmütze).
1912 wies der Historiker und spätere Biograph des Kronprinzen Rudolf, Oskar Freiherr von Mitis sen. (1874 -1955 ), in seinen „Studien zum ältesten österreichischen Urkundenwesen“ darauf hin, dass es sich bei der diplommäßig ausgestatteten und überreich verzierten Grenzurkunde vom 2. Juni 1136 um eine „diplomatische Fälschung“ aus der Zeit um 1230 handeln könne. Der Beweis seiner Theorie: die einer päpstlichen Bulle ähnelnde Ausstattung der Schrift, die in dieser Ausführung erst nach Papst Innozenz III. (reg. 1198-1216) in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts üblich ist. Die Annahme von Mitis ist nicht abwegig: Professor Dr. Theo Kölzer (Universität Bonn) fand in 20-jähriger Forschungsarbeit heraus, dass bis zu 15 Prozent der Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts als Fälschungen anzusehen sind, wenn es um Besitzschenkungen, Sonderrechte oder einem Kloster verliehene Rechtstitel geht. Der Grund für die erste überlieferte Mayerling-Lüge der Geschichte: Neid, insbesondere der Allander. Durch ein Privileg von Papst Innozenz II. (reg. 1130-1143) aus dem Jahre 1132 waren die Mönche nämlich von der Entrichtung der Ackerbau-Abgabe an den Bischof (in Passau), den (babenbergischen) Grundherrn und den Pfarrer (in Alland) befreit.
Bereits im Sommer 1133 dürften die ersten Mönche aus dem französischen Morimond das Gründungsterrain erkundet haben. Ihnen folgt am 11. November der spätere erste Abt, Gottschalk (reg. 1135-1147), mit der eigentlichen Gründungskolonie von 12 Zisterziensern. In dem neuen, der Jungfrau Maria geweihten Stift am Sattelbach wurden alle damals üblichen Handwerke ausgeübt. Schon im 1. Jahrhundert ihrer Tätigkeit in Österreich waren die Zisterzienser mit so großem Erfolg wirtschaftlich tätig, dass sich der Orden wegen seiner Abgabenfreiheit viele Feinde machte.
Um 1230 bricht ein heftiger Streit aus zwischen Abt Egilof von Heiligenkreuz (reg. 1227-1242) und dem Allander Pfarrer Liupold, in dessen Pfarrgemeinde das neue Kloster errichtet wurde. Ein Schiedsgericht unter Vorsitz der Babenberger Grundherren, die sich – auch wenn die Pfarre Alland zu Passau gehörte – als Eigenkirchenherren fühlten, legte fest, dass der Allander Pfarrer auf den Zehent aus dem Bereich der Klosterneugründung zu verzichten habe. In dieser Zeit dürfte der Heiligenkreuzer Stifterbrief gefälscht worden sein, um während des Prozesses eine gesiegelte Urkunde vorweisen zu können, die den Umfang der 1136 wohl zunächst nur mündlich zugewiesenen Ländereien bestätigt.
Als urkundlich dokumentierte Entschädigung für die Abtretung des Zehents erhält der Allander Pfarrer drei Mansen in Dornbach und die Einkünfte eines Talentes in Traiskirchen. Ohne Schwierigkeiten verlief fast einhundert Jahre vorher die Entschädigung des Passauer Bischofs Reginmar (reg. 1121-1138): Auf Bitten des Markgrafen Leopold verzichtete er auf seinen Anteil aus Heiligenkreuz und erhielt zur Entschädigung zwei Mansen: das Höflingshaus Alland Nummer 6 samt heutiger Kirchgasse mit den Häusern 4, 7, 8, 9 und 10 bis zur Brunnwiese gegen Grub und das Anwesen Raisenmarkt 25, den sogenannten „Wimbauern“ (Wiedenhof/Raisenmarkt). Zudem zählte der „Steinbauer“ (Schwechatbach 25) dazu. Dieses Anwesen wird 1431 im Urbar des Stiftes Heiligenkreuz erwähnt. 1683 wird der Hof von den Türken niedergebrannt und die Familie des Inhabers, Jakob Strüchler, getötet. 17 Jahre lang liegt der „Steinbauer“ öde, bis er im Jahre 1700 von Andreas Sulzer erworben wird. 1716 verkauft er das Anwesen an Philipp Schöckl. Aus dem Besitz der Familie geht der Hof 1853 an den Wiener Bankier Simon Georg Freiherr von Sina (1810-1876) und 1871 an Anastasia Gräfin von Wimpfen über. 1893 ist der Hof vom Waldaufseher Schmidt bewohnt.
Der „Steinbauer“ hatte bis 1848 die Pflicht, den Getreidezehent von Waitzbaum, Rabenthal, Schanzenstein, am Schober, von Gutental und Zobel in den Pfarrstadel von Alland abzuführen. Zusammen mit dem Wimbauern und dem Höflingshaus in Alland war der „Steinbauer“ der größte Pfarrhof der Reichs- bzw. Babenbergerpfarre Alland.
Trotz des vom Passauer Bischofs Rudiger von Bergheim (reg. 1233-1250/abgesetzt) bestätigten Vergleiches herrschte zwischen Alland und Heiligenkreuz tatsächlich erst ab 1253 Frieden, als Herzogin Gertrud von Babenberg (reg. 1248-1269) das Allander Patronats- und Präsentationsrecht für die Kirche auf Heiligenkreuz überträgt, was dann 1311 auch nachträglich bestätigt wird. Am 17. März 1380 verleibt der Passauer Bischof Albert III. von Winkel (reg. bis 1380) die Pfarre Alland dann dem Stift Heiligenkreuz ein, wodurch dieses auch über die Pfarrpfründe der Gemeinde verfügen konnte, was wiederum 1386 durch Papst Urban VI. (reg 1378-1389) bestätigt wird.
1196
Um 1196 nennt der Passauer Bischof Wolfger von Erla (reg. 1191-1204) in einer Urkunde den letzten Herrn von Mayerling: Bernhardus de Murlingen bezeugt die Exemtion, also Ausgliederung der von Adelheid von Sparbach gestifteten Nikolaus-Kirche zu Sparbach von der Allander Mutterpfarre.
1272
Albert, Sohn Dietrichs unter dem Stein (Albertus Ditrici sub Lapide filius), verkauft mit Zustimmung der Familie sein Eigen, den „Steinhof“ in Mayerling, an das Zisterzienserstift Heiligenkreuz.
1275
Ohne die namentliche Erwähnung des Besitzers wird der „Steinhof“ in einer Arnsteiner Urkunde genannt.
15.05.1276
Otto von Arnstein stirbt. Er vermacht das Haus Mayerling 9 mit Zins und Rente der Mühle den Heiligenkreuzer Mönchen als Messstiftung.
1294
Ein Hof und eine Mühle beim „Steinhof“ in Mewerling werden als stiftliches Eigentum im Heiligenkreuzer Gültenverzeichnis genannt (wahrscheinlich Mayerling Nr. 9). Zum Wohle der Mönche muss der Mühlenhof acht Hühner, sieben Käse, 30 Eier und eine Gans zu den jährlichen Kirchenfesten Ostern, Weihnacht, Pfingsten und Fasten an die Zisterzienser abtreten. Neun Schilling Bargeld am Michaelstag kommen noch hinzu.
06.03.1378
Lorenz, der Hutter von Baden, verkauft den Berg zwischen Mayerling und Alland („zwischen Mayerling vnd Alacht der do heizzet der Chirchiperkch“) und eine Hofstatt (Mayerling Nr. 4), ein herzogliches Lehen, an die Oheime seiner Frau Chunigunde, Nikolaus und Lienhart Wedel. Unter Umständen stand schon zu dieser Zeit eine kleine Andacht oder Kapelle in Mayerling, was die Benennung der Gemarkung „Chirchiperkch“ (Kirchberg/heute: Kirchenfeld) erklären könnte.
1388
Auf dem „Steinhof“ sitzt Bidel Fullo, ein Tuchmacher, der dort eine Tuchmühle betreibt. Ihm folgen als Besitzer Andre (1431) und später Michael und Sigmund Vogel. Schon zu dieser Zeit sprechen die Bauern der Umgebung von der Mayerlinger Mühle als Mühle „an der Bruckh“ („an der Brücke“), um 1580 von der „Speichmühle“ und 1650, nach dem neuen Besitzer Michel Schwab, von der „Schwabmühle“.
Um 1700 – in Mayerling gibt es zehn Häusern – pachtet dieses Anwesen Hans Georg Fleischmann, dessen Familie dort bis 1853 verbürgt ist. 1848 jedoch wird das Klostergut, das auch den Getreidezehent von Greith, Feichtenbühel, Obermaierhof, Rohrbach und Raisenmarkt abzuführen hatte, aus dem Besitz des Stiftes Heiligenkreuz gestrichen.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es in Mayerling zwölf Häuser und 115 Einwohner. Neben dieser Mühle muss es in der Gegend um Mayerling noch weitere Mühlen gegeben haben: die 1297 von Wiehard von Arnstein an Heiligenkreuz verpfändete und 1454 wieder ausgelöste „Mittermühle“ (Untermeierhof 9) sowie die „Schatz-„ oder „Gritschmühle“ (Untermeierhof 8). Die nächstgelegene Mühle befindet sich in Raisenmarkt 14 (seit 1431 „Höllmühle“). Die „Moosmühle“ (1629 entstanden) ist heute nicht mehr zu lokalisieren.
11.11.1392
Die Zisterzienser verpachten „Mawrling pei der Swechent“ für einen jährlichen Grundzins von 38 Michaelispfenning sowie den Ackerbauzehent an die Brüder Niklas (Nikolaus) und Lienhart Wedel (Fontes Rerum Austriacarum XVI, Nr. 326). Aus dem Pachtvertrag kennen wir einen weiteren Bewohner Mayerlings: den Bauern Friedrich, der eigenes Land an der Schwechat besitzt. Der Besitz der Gebrüder Wedel wird in den Lehensbüchern der österreichischen Herzöge im 15. Jahrhundert als „Hof im Tal“ bezeichnet. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist er in der Hand der Wisinger. 1455 wird Friedrich Bischof von Kaiser Friedrich III. (1415-1493) damit belehnt. Als Seelgerätsstiftung des neuen Herrn geht der Hof 1479 an das Benediktinerkloster Mariazell.
31.07.1412
Nachdem die Zisterzienser in Heiligenkreuz eine beeindruckende Klosteranlage errichtet haben, bauen sie nach und nach für die Bevölkerung der Umgebung eigene Gotteshäuser. 1412 lässt Abt Albert von Heiligenkreuz (reg. 1402-1414) auf dem Erbteil des Ozo von Mayerling eine steinerne Kapelle und daneben ein Granarium errichten, das den Zisterziensern als Wirtschaftshof dient. Am Sonntag nach Jakobi wird das neue Gotteshaus von Andreas, dem Suffragan des Passauer Bischofs Georg von Hohenlohe, dem Abtpatron und römischen Erzdiakon Laurentius (230-258) zu Ehren geweiht. „Ecclesia haec aedificata ab Abbate Monasterii Crucis Alberto ann 1412 in honorem S: Laurentii, ab Andrea Episcopo Passaviensi dicata” wird auf einem 1889 aufgefundenen Pergament aus dem Turmknopf der Laurentius-Kirche zu lesen sein.
1458-1463/1477
Das ungarische Heer unter seinem König Matthias Corvinus (1443-1490) brennen 1477 beim Sturm auf Wien die feste Kirche in Mayerling nieder. Vielleicht ist sie aber bereits zwischen 1458 und 1463 dem Bruderkrieg zwischen Kaiser Friedrich III. (1415-1493) und Erzherzog Albrecht VI. (1418-1463) um die Nachfolge im Herzogtum Österreich zum Opfer gefallen, bei dem auch Alland geplündert wird.
15.09.1516
Abt Bernhard Medrizer (reg. 1516-1519) errichtet in Mayerling ein neues Gotteshaus, das im September 1516 von Bischof Bernhardus, einem Mitarbeiter des Passauer Fürstbischofs Wiguleus Fröschl von Marzoll (1445-1517), geweiht wird.
1529
Im Herbst stürmt das 120.000 Mann starke osmanische Heer unter Sultan Süleyman I. (1495–1566) beim Marsch auf Wien erneut die Laurentius-Kirche – das Gotteshaus und die Gehöfte in Mayerling brennen bis auf die Grundmauern nieder.
30.12.1550
Die Heiligenkreuzer Zisterzienser kaufen dem Nachbarkloster Mariazell den von Erhart Sunnleutner bewirtschaftet freien Wirtschaftshof in Mayerling und weite Flächen des einstigen Herrensitzes des Ozo von Mayerling ab.
1640
Der Wiener Kaufmann Tonolino kommt zur Erholung nach Mayerling und reist geheilt heim. Aus Dankbarkeit stiftet er das Steinrelief der „Armen Seelen im Fegefeuer“, das innerhalb der Klostermauern erhalten sein soll und 1890 an der Rückwand des im spanischen Stil errichteten Kolumbariums angebracht wird. Mit der „Heilung“ dieses italienischen Kaufmanns könnte rund um Mayerling und im Wienerwald der Wunsch entstanden sein, Bittwallfahrten in die Kirche von Mayerling zu unternehmen.
1640-1643-1647
Die Heiligenkreuzer beginnen unter Abt Michael II. Schnabel (reg. 1637-1658) mit dem neuerlichen Aufbau der Kirche in Mayerling. Der Abt beauftragt den Heiligenkreuzer Pater Edmund Flöhel (1605-1648; 1640-1646 Waldschaffer und Provisor in Mayerling) mit dem Bau. Zöchmeister der Kirche in Mayerling ist zu dieser Zeit Veit Wagenhofer. Die 17 Wohltäter des Kirchenneubaus sind namentlich bekannt, unter ihnen u. a. der ehemalige Heiligenkreuzer Prior und seit 1639 Erzabt von Pannonhalma, Mathias Palffy (gest. 1647) mit drei Gulden, der Kapellmeister des Erzherzog Leopold, Hyacinthus Kornathy (stiftet das Hochaltarbild), und Richard Mild, Maurermeister aus St. Pölten, der die Kapelle „für einen geringen Lohn“ errichtet. Für den Unterhalt des Gotteshauses stellt Abt Michael II. 1647 einen Weingarten in Kaltenberg bei Baden zur Verfügung.
1647
Einer der beiden amtierenden Rektoren der Wiener Universität, Bernardus Holler, und seine Freunde, Hans Suttinger von Thurnhof und Leonhard Denckl, schenken der Kirche in Mayerling einen silbernen Kelch mit Patene, der Neuhäuser Richter Johannes Gritsch stiftet ein neues Missale und der Hof- und Grundschreiber von Heiligenkreuz, Jacob Weinrieder, ein Glöckchen.
16.05.1648
Mit Spendengeldern wird die noch immer nicht fertig gestellte Sakristei der Kirche vollendet.
16.06.1648
Weihe der aus Spendegeldern erworbenen Glocke zu Ehren „Unserer Lieben Frau und Himmelskönigin Maria“.
20.07.1649
Neben der „Capellen des hl. Laurenty“ in Mayerling, die seit dem 8. Januar 1646 der Waldschaffer Pater Johannes Baptist Jurman (1602-1658) als Nachfolger Flöhels betreut, wird ein neuer „Freythof vnd Gottes Acker“ angelegt und im Juli 1649 fertig gestellt. Da die heimischen Bauern ihre Anbauflächen bis an die Kapelle von Mayerling heran gelegt hatten, erhalten sie auf Wunsch des Abtes Ausweichflächen – der Bauer Stephan Knotzer darf seinen Acker zum Beispiel Richtung Wald ausweite. Auf Bitte des Waldschaffers gestattet der Abt von Heiligenkreuz, dass in Mayerling nicht nur an Kirchweih und dem Patronatsfest ein Gottesdienst gefeiert wird, sondern auch an anderen Tagen.
1650
Durch Abt Michael II. wird unter Leitung von Pater Johannes Baptist Jurmann von den Bauern aus Sulz, Mayerling, Grub und Preinsfeld eine Seitenkapelle angebaut. Aus Opfergeldern wird ein weiterer Weingarten erworben.
10.08.1651
Der Provisor feiert die erste Heilige Messe in der erweiterten Kapelle. Von dem Opfergeld werden ein neuer Kelch und ein neues Missale (Messbuch) erworben.
21.06.1652
Die dunkle Holzdecke der Laurentius-Kirche wird abgetragen und ein Gewölbe mit einem Fenster eingezogen. Ein weiterer Weingarten wird erworben. Die mittlere Glocke zu Ehren des hl. Johannes des Täufers wird gegossen und geweiht. Am 21. Juni stiftet der Wiener Bürger Hans Schlidt eine Laurentius-Fahne.
11.08.1652
Abt Michael II. weiht die erweiterte Kapelle, den Hochaltar und, in der talwärts gelegenen Seitenkapelle, den neuen Marienaltar (das Liebfrauenbild stiftete Georg Khielmann).
02.04.1653
Erweiterung des Friedhofes in Mayerling durch Ankauf von Ackerland. Viti Wagenhofer, Richter von Mayerling, bestätigt den Erwerb durch den Provisor.
01.11.1656
In der nördlichen Kapelle wird an Allerheiligen durch Abt Michael II. ein Seitenaltar zu Ehren der 1654 durch Pater Johannes Jurmann und den Stiftskämmerer Pater Franz Eiserer gegründeten und unter Kaiser Josef II. (reg. 1756-1790) mit Dekret vom 9. August 1783 verbotenen Bruderschaft zu den Pestheiligen Rochus und Sebastian geweiht. Die Statuen der Pestheiligen finden ihren Platz zu beiden Seiten des Hochaltares. Im gleichen Jahr erhält die Kirche einen steinernen Turm, zwei Glocken, neue Paramente und Kelche. Vor der Kirche wird ein eingeschossiges Heiliges Grab errichtet. Gilt die Kapelle zu Mayerling bislang als Filialkirche der Allander St. Georgskirche, setzt Heiligenkreuz die Provisoren ein, die nun dort den Gottesdienst versehen, am Ort leben und die Leitung der Rochus- und Sebastian-Bruderschaft übernehmen.
1667
Abt Clemens Schäffer (reg. 1658-1693) führt einen neuerlichen Weiheakt in der Laurentius-Kirche durch: „Zue Mayerling nit weit vom Fluß Schwechant, Sanct Lorenz kürchen ist worden bekannt, durch Clementis soge und grosse mühe, Allwo man thuet opfern ochsen und kuehe.“
Ähnlich wie beim Aegidien- und Stefanskult im benachbarten Schwarzensee könnten in Mayerling, das am Rande des Pilgerweges „via sacra“ von Wien nach Mariazell liegt, berittene Freibauern bis in 17. Jahrhundert hinein eiserne Tierfiguren geopfert haben. Opfertag ist das Laurentiusfest am 10. August. An diesem Tag, sowie am ersten Sonntag nach dem 2. Juli (Tag der Kirchenweihe), zieht die Prozession von Alland nach Mayerling. Zu Ehren des Heiligen Rochus von Montpellier (1295-1327) pilgern am 16. August die Holzhauer aus Klausen-Leopoldsdorf in einer Votivprozession nach Mayerling.
20.05.1671
Pater Alberik Höffner (gest. 1717) wird zum Provisor ernannt (bis 1693).
1679 bis 1682
Die Pestwelle von 1679 verschonte sowohl Heiligenkreuz als auch Mayerling. In Dankbarkeit lässt Abt Clemens Schäffer 1681 die Kapelle in Mayerling abtragen und in zweijähriger Bauzeit für 5.839 Gulden, 34 Kreuzer und 2 Pfennigen an gleicher Stelle eine größere Kirche mit Seitenkapellen zu Ehren der seligen Jungfrau Maria und der Heiligen Rochus und Sebastian errichten. Maurermeister ist der Italiener Caroli Canouial, das Dach stellt Zimmermeister Johannes Heri (Traiskirchen) her. Das Gebäude hat eine Breite von 28 Metern, der westliche Anbau ist acht Meter breit. Für die Innenausmahlung ist der Heiligenkreuzer Laienbruder Frater Stephan Molitor (1642-1695) verantwortlich, den figuralen Schmuck – das sind die Holzfiguren der Heiligen Benedikt und Clemens, zwei sitzende Engel, zahlreiche Engelsköpfe und Zierrat aus Lindenholz, zwei Seitenaltäre und zwei geschnitzte Bilderrahmen – erstellt in drei Monaten der Bildhauer und Giuliani-Partner Benedikt Sondermayr. Das Hochaltarbild sowie die beiden Seitenaltäre malt der Wiener Künstler Franz Blumb. Am 15. September 1681 wird im Knauf des Kirchturmkreuzes die Memoriale für die Nachwelt eingeschlossen: u. a. ein Kreuz aus Spanien und Reliquien der Märtyrer Paulinus, Olympus, Julianus, Antonius, Crescentius, Vitus, Innocentius sowie ein heiliges Wachstäfelchen aus Flandern. Zudem stockt der „barocke Bauabt“ das Granarium um eine Etage zum Herrenhaus auf und baut es, barockisiert, zur Mönchsherberge um. Dort ist der Amtssitz des Waldschaffers der hinteren stiftlichen Waldungen untergebracht.
Der ebenfalls verwüstete Wirtschaftshof nahe der Schwechat wird wieder aufgebaut.
14.07.1683
Vor Wien stehen sich erneut Kreuz und Halbmond gegenüber. Am 14. Juli werden Kirche und Wirtschaftshaus während dieser zweiten Türkenbelagerung unter Großwesir Kara Mustafa Pascha (1626 oder 1636-1683) zerstört. Provisor Alberik Höffner berichtet, der Turm samt Glocken sei eingestürzt und eine umgefallene Giebelmauer habe das Gewölbe durchschlagen, Hoch- und Seitenaltäre seien zertrümmert und die Kirchengeräte – darunter zwei silberne Kelche und 11 Reliquienkapseln – geraubt worden. 70 Menschen werden in Mayerling und Umgebung getötet und nur das Heilige Grab wird von den Osmanen verschont.
1685 bis 1692
Das Herrenhaus und die Kirche werden unter Provisor Alberik Höffner teilweise neu errichtet. Am 7. August läuten erstmals die neuen Glocken (Guss: Mathias Glaser). 1692 lässt Abt Clemens mit 1.000 Ziegeln das noch nicht gerichtete Kirchengewölbe wieder herstellen und innen mit Stuck verzieren.
1712 bis 1725
Abt Gerhard Weixelberger (reg. 1705-1728) lässt 1712 einen neuen Turm errichten und stiftet für die Kirche einen vergoldeten Hauptaltar sowie zwei Seitenaltäre, die am 8. Juli 1725 vom Passauer Bischof, Joseph Dominikus Graf von Lamberg (reg. 1723-1761), geweiht werden.
15.03.1729
Das Viertel unter dem Wienerwald mit insgesamt 64 Pfarren fällt an das 1722 gegründete Erzbistum Wien.
1730 bis 1733
Abt Robert Leeb (reg. 1728-1755) lässt die Wallfahrtskirche renovieren, erweitert 1732/1733 die Heilig-Grab-Kapelle, errichtet einen neuen Hochaltar mit einem mächtigen Aufbau aus vier flankierenden, korinthischen Säulen und seitlich je einer Nische. Zudem lässt er einen neuen Turm samt Kreuz errichten. Da jetzt von einer „turris major“ die Rede ist, kann die Kirche in Mayerling zu diesem Zeitpunkt kurzfristig auch zwei Türme besessen haben. Seit 1730 feiert der Provisor an allen Sonntag sowie an den Kirchenfesten der Heiligen Sebastian, Laurentius und Rochus sowie am Kirchweihfest in der Kirche zu Mayerling die Heilige Messe.
01.11.1738
Der Wiener Lederer-Meister Nikolaus Kronister und seine Frau Rosina stiften für die Kirche in Mayerling ein Muttergottesbild für den Hauptaltar, einen silbernen Kelch und ein Messgewand. Zudem richteten sie eine Stiftung für 13 hl. Messen pro Jahr ein.
18.01.1785
In Mayerling wird Ambros Schöny geboren (1785-1864), der 1804 im Stift Heiligenkreuz eingekleidet wird und dort u. a. von 1825 bis 1840 als Frühprediger tätig ist. Zu dieser Zeit gibt es in Mayerling zehn Häuser.
16.02.1823
In Mayerling wird Robert Lintner (1823-1868) geboren, der 1841 im Stift Heiligenkreuz eingekleidet wird und u. a. von 1855 bis 1860 als Professor am Gymnasium in Wiener Neustadt unterrichtet.
1825
Unter Abt Xaver Seidemann (reg. 1824-1841) wird die Kirche – nach Auflösung der Bruderschaft war ihre Stellung in der Gesellschaft stark geschwächt und so konnte die Natur dem nicht mehr ausreichend gepflegten Bauwerk ihren Tribut abtrotzen – wieder hergerichtet.
1831
Die Einwohner Mayerlings sind durchweg Waldbauern, die neben spärlichem Ackerbau vielfach Holzhandel betreiben. Unter den 24 Familien, die in 12 Häusern leben, gibt es nur zwei Handwerker. Allerdings besitzt der Ort neben den beiden Mahlmühlen eine Brettsäge und die „Schatzmühle“ von 1452. Erst 1955 wird ihr Mühlengraben zugeschüttet und eingeebnet. Grundherrschaft des Ortes ist das Stift Heiligenkreuz, landgerichtlich gehört der Weiler diesseits der Schwechat zu Weikersdorf, jenseits zu Fahrafeld, in Bezug auf Schule und Pfarre zu Alland. Zum Vergleich: 1869 leben in der Gemeinde Alland 1.954 Bürger, im Bezirk Baden 57.063, in Niederösterreich 1.077.232. Zu dieser Zeit müsste das Waldbauerndorf mehr Infrastruktur gehabt haben als heute, auch wenn man den „schindelgedeckten Bauernhäusern... die Ärmlichkeit bei jeder Fensterluke“ ansieht.
„Beim (...) Wirtshaus theilen sich die Straßen, die eine führt (...) an dem reizend gelegenen Mayerling mit der großen Kirche (...) vorüber in den freundlich grünen Thalkessel“, schreibt 1888 Erzherzog Thronfolger Rudolf von Habsburg selbst in der „Öst.-ung. Monarchie in Wort und Bild“. Dieses Einkehrgasthaus für Fuhrleute, im Besitz des Stiftes Heiligenkreuz und an die Familie Gottwald verpachtet, war seit der Zeit Maria Theresias (1717-1780) eine Fahrpoststation mit Herberge. Bereits morgens um sechs erreicht Mayerling der erste Postwagen Richtung Baden. Im Keller des Gasthauses gibt es einige einfache Schlafplätze für Kutscher und Fuhrleute und im Gastraum dürfen Lebensmittel und Proviant verkauft werden. Auf dem Vorplatz stehen Kutschen und Einspänner.
Hinter dem Haus liegt, von einer Mauer umgeben, ein Gutsbesitz und eine Villa mit Holzbalkon und Veranda. Zu dieser Villa gehören ein Gärtnerwohnhaus, eine Scheune und ein Stall. Die Schwechat ist in Mayerling Richtung Raisenmarkt nach einigen Quellen über eine Brücke, nach anderen Berichten über eine Furt zu queren. Reisende berichten zu dieser Zeit: „Von der berühmten Thermalstadt Baden durch das Helenental kommend, genießt man einen schönen Blick in den lieblichen Talgrund, in dessen Mitte das alte Wienerwald-Bauerndörfchen Mayerling liegt.“
Hier an der Schwechat soll sich eine hölzerne Badehütte für die Damen des „Marienhofes“ gefunden haben – die Herren badeten damals ganz einfach „zwischen Schilf und Rohr“.
03.05.1851
Die Wallfahrtskirche wird renoviert und die neuen Glocken werden geweiht.
1869
In Alland leben 1.954 Einwohner, in Mayerling 108 (in 13 Häusern).