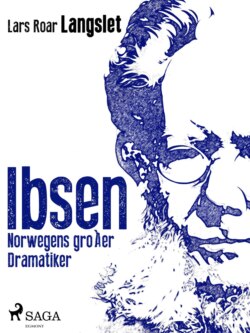Читать книгу Ibsen - Norwegens großer Dramatiker - Lars Roar Langslet - Страница 5
Vom Szenograph zum Dramatiker
ОглавлениеIn den sechs Jahren in Bergen lernte Ibsen gründlich alle Seiten der verschiedenen Arbeiten in einem Theater kennen (außer einer: Im Gegensatz zu vielen anderen Dramatikern ist er niemals als Schauspieler aufgetreten!). Aber mit der Zeit konzentrierte sich seine Führungsverantwortung auf das Szenographische: Das Entwickeln des Bühnenbildes, die Kostüme, die Beleuchtung, die Choreographie der Handlung. Eine andere Person übernahm das Einstudieren der Texte und der einzelnen Rollen.
Es gibt Vorzeichen für ein Phänomen, das zu einem wichtigen Kennzeichen Ibsenscher Dramatik wird: Er ist ein ausgesprochen visueller Dichter. Er sah das Ganze vor sich – den Raum, die Personen und ihre Kleidung. Die Bühnenbilder sind immer äußerst detailliert beschrieben, mit exakten Anweisungen für die Möblierung, den Lichteinfall, die Farben und die Stimmung. Das alles soll seine wortlose Sprache im Zusammenspiel mit den Repliken führen und bildet einen wichtigen »Untertext« für den Handlungsablauf.
1857 kehrte Ibsen als Regisseur und künstlerischer Leiter des dortigen Theaters nach Kristiania zurück. Das wurde eine Schufterei unter prekären ökonomischen Verhältnissen. Im Laufe einer einzigen Saison mußte er 44 Stücke inszenieren! Nur einige wenige Stücke von Molière und Holberg kamen auf den Spielplan, meistens waren es schablonenhafte Lustspiele und romantische Melodramen, die inzwischen schon lange vergessen sind. Der Name, der am häufigsten auftaucht, ist der des französischen Massenproduzenten von Verwechslungskomödien, Eugène Scribe (den Ibsen verachtete). Aber so war damals das Repertoire der großen Bühnen Europas!
Das läßt Ibsens bahnbrechenden Einsatz nur um so deutlicher hervortreten: Das Drama als literarische Form war in einer traurigen Periode des Verfalls. Seit Schillers Tod (1805) waren so gut wie keine Schauspiele von Bedeutung mehr geschrieben worden. Die Theaterkunst war zu einer Unterhaltungsbranche mit oberflächlichen Dutzendprodukten als literarischer Rohstoff verkommen. Der Verfall führte zu der weitverbreiteten Auffassung, auch unter Literaturkennern, daß das Drama als Form ungeeignet für eine tiefergehende Menschenschilderung war. Als Ibsen später mit seinen Stücken, die heute als Höhepunkte der Weltliteratur gelten, das Gegenteil bewies, kam es zu folgender Wechselwirkung: Jedesmal wurde Ibsen angeklagt, künstlich »geheimnisvoll« und »unverständlich« zu sein – weil er so offensichtlich mit den gewohnten Schablonen brach und eine neue dramatische Form schuf, die zu deuten das Volk noch nicht gelernt hatte.
Aber in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts befand er sich noch in einer Phase, in der sein Stück nur wenig mehr als ein »Lehrstück« wurde – begabt, mit vielen Hinweisen auf einen großen Dramatiker, aber von den kunstvoll erdachten Verwicklungen und äußeren Effekten der Zeit geprägt.
Die alte norwegische Geschichte lieferte den Stoff für die wichtigsten Stücke dieser Zeit, »Frau Inger auf Østråt« (1857) und »Die Helden auf Hegeland« (1858), die geistigen und literarischen Ideale der Romantik prägten sie. Aber sein erstes wirklich ausgereiftes Stück kam erst 1863 heraus: »Die Kronprätendenten«.
Das ist ein Drama über das Bewußtsein, berufen zu sein. König Håkon will alle Norweger zu einem Volk vereinen, stößt jedoch auf großen Widerstand durch machthungrige Adlige, die der Methode »Teile und herrsche« folgen. Herzog Skule, der sich als Gegenkönig ausrufen läßt, ist die faszinierendste Gestalt des Stückes: ein Zweifler, der versucht, weiterzukommen, indem er Håkons Sammlungsidee »stiehlt«. Aber er scheitert und erscheint durch sein Scheitern als »Gottes Stiefkind auf dieser Erde«.
Ende der 1850er Jahre durchlebte Ibsen eine Krise voller Zweifel an seiner eigenen Berufung, mit hohem Alkoholkonsum, einer labilen Gesundheit und schlechter finanzieller Lage. 1862 wurde das Theater geschlossen und der Kampf ums Dasein noch härter, keines seiner eigenen Werke war bisher ein Erfolg gewesen. Seine Gattin Suzannah (sie heirateten 1858) hatte einen starken Charakter, und sie versuchte ihn zu stützen, aber die Rettung kam erst, als Freunde, mit Bjørnson an der Spitze, Geld sammelten, damit Ibsen nach Italien fahren konnte (1864). Damit begann sein 27jähriges Exil, teils in Italien, teils in Deutschland.