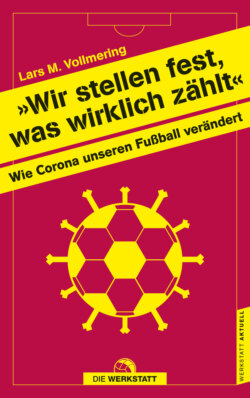Читать книгу "Wir stellen fest, was wirklich zählt" - Lars Vollmering - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGrätsche von hinten
Wie die Fußballwelt von einem Virus hart getroffen wird
»Die ganze Bundesliga, die DFL und der DFB müssen zusammenstehen«, sagt Karl-Heinz Rummenigge. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München spricht mit ernster Miene. Seine Kleidung ist durchnässt vom Regenguss, der kurz zuvor auf ihn niedergegangen ist. Hand in Hand mit Dietmar Hopp steht er am Mittelkreis der Hoffenheimer PreZero Arena unter offenem Himmel. Ganz Fußball-Deutschland soll diesen Schulterschluss der Solidarität sehen und die unmissverständliche Botschaft erhalten: So geht es nicht weiter. Es ist Samstag, der 29. Februar 2020.
Gerade eben ist das Bundesligaspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern zu Ende gegangen. 6:0 hat der Deutsche Meister gesiegt, doch das Ergebnis ist nebensächlich. Im Fokus stehen an diesem Nachmittag Schmähplakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, die während des Spiels im Bayern-Fanblock zu sehen sind. Schiedsrichter Christian Dingert hat die Partie deswegen mehrfach unterbrechen müssen. Im letzten Teil des Spiels treten die Kicker beider Mannschaften in einen in der deutschen Ligageschichte beispiellosen Streik: Sie kicken sich den Ball im Mittelkreis mehr oder weniger lustlos zu.
Sichtlich erschüttert steht Dietmar Hopp nach Spielende auf dem Rasen des Stadions mit Rummenigge. Sie nehmen sich in den Arm. Später sprechen die Klubverantwortlichen von einem Eklat, der »nicht entschuldbar« sei. Die Plakaturheber aus der Ultraszene, fordert Rummenigge, müssten »zur Rechenschaft gezogen« werden. Es ist die Rede vom »hässlichen Gesicht«, das der Fußball an diesem Tag gezeigt habe.
29. Februar 2020, PreZero Arena, Hoffenheim: Schulterschluss in Hoffenheim – Bayern-Präsident Karl-Heinz Rummenigge reicht dem von Bayern-Fans geschmähten Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp am Mittelkreis die Hand.
imago images/HMB-Media
Es ist dies aber auch jener Moment, in dem zumindest in Fußball-Deutschland kurz wieder Normalität eintritt. Der sogenannte Hopp-Skandal, der sich an der von den Ultras scharf kritisierten Wiedereinführung von Kollektivstrafen im deutschen Fußball entzündet hat, verdrängt für einen kurzen Moment nämlich ein anderes Thema, das sich seit Jahresbeginn in der öffentlichen Wahrnehmung eingenistet hat: In China hat ein unbekanntes Virus erhebliche Infektionszahlen und sogar Todesfälle nach sich gezogen: Corona.
Die meisten Deutschen empfinden das Virus, das schnell auch als Covid-19 bekannt wird, zunächst als allenfalls abstrakte Bedrohung. Und doch: Bilder von ersten Hamsterkäufen und leergekauften Klopapierregalen machen die Runde. Während manche Experten erste Empfehlungen für Hygieneverbesserungen geben, warnen andere vor »Panikmache«: ein tödliches Virus, das sich weltweit ausbreiten werde – für viele klingt das mehr nach Hollywood als nach Hoffenheim. Ein Stoff für Aluhutträger und Apokalyptiker. In den sozialen Medien wird die »Witz-Maschinerie« basierend auf den Themen »Hopp« und »Corona« angeschmissen. Twitter-Schandmaul und Moderator Micky Beisenherz, als Macher von »MML« einer der bekanntesten Fußball-Podcaster Deutschlands, steht mit seinem Tweet stellvertretend für die damalige Stimmung: »Dietmar Hopp hat Corona erfunden, damit diese Fangesänge aufhören.« Podcast-Kollege Tommi Schmitt (»Gemischtes Hack«) teilt seinen knapp 120.000 Followern mit, dass er »keine Lust mehr auf Corona, Hopp« habe. Vielmehr sei es doch Zeit, jetzt lieber über die anstehende Fußball-EM zu diskutieren. Nur zwei Beispiele für den zu Beginn eher verharmlosenden Umgang mit Corona in Deutschland, das von der Weltgesundheitsbehörde (WHO) am 11. März offiziell zur Pandemie erklärt wird.
Zwischen Hopp-Debatte und »China-Virus«
Medien und Fans scheinen gleichwohl dankbar für einen Wechsel der Tagesordnung vom »China-Virus« auf die gute, alte Kommerz- und Fanverhalten-Debatte im deutschen Fußball. Von taz bis Tichy von »Doppelpass« bis DAZN – die Resonanz auf die Hopp-Thematik ist nahezu flächendeckend. Mögliche Corona-Szenarien stören dabei offenbar nur. Natürlich kann zu diesem Zeitpunkt niemand die kommenden Ereignisse voraussehen. Eine Blaupause für das Verhalten anlässlich dieses noch längst nicht überstandenen »Jahrhundertereignisses« gibt es ja bis heute nicht. Und Ende Februar dominiert noch das zweckoptimistische Mantra: »Wird schon nicht so schlimm werden.« So richtig ernst nimmt kaum jemand das, was da unaufhaltsam über die Welt hereinbricht.
Dabei hat es in jenem Moment, als Rummenigge und Hopp auf dem Rasen von Sinsheim gestanden haben, in einem anderen, nur wenige hundert Kilometer entfernten Fußball-Land schon deutliche Anzeichen gegeben, was auch auf Deutschland zukommen könnte.
Die reichste Region Italiens, die Lombardei, ist an diesem 29. Februar bereits Quarantänegebiet, die Metropole Mailand befindet sich im Ausnahmezustand. 888 Infektionsfälle, 21 Tote vermelden die italienischen Behörden. Geschlossene Geschäfte und Sportplätze. Abgeriegelte Ortschaften. Bereits eine Woche vor den Ereignissen von Hoffenheim hat die Serie A vier Spiele wegen der Corona-Epidemie absagen müssen. Darunter das Aufeinandertreffen von Inter Mailand und Sampdoria Genua. Die italienische Liga folgt damit den Vorgaben der Regierung zur Eindämmung des Virus. In Deutschland ist man noch nicht so weit. Trotzdem beobachtet man die Entwicklung jenseits der Alpen mit zunehmender Sorge. Hinzu kommt, dass außerhalb des Fußballs weltweit immer weitreichendere Entscheidungen für Einschränkungen und Absagen im Kampf gegen Corona getroffen werden. Ein Dominospiel über alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ist in Gang gesetzt. Und die Steine fallen unaufhaltsam von Ost nach West. In China wird bereits Anfang Februar das dortige Formel-1-Rennen abgesagt, Sportwettbewerbe aus Asien werden in Windeseile verlegt, die Fußballliga in Südkorea setzt den Saisonstart aus. Am 24. Februar bereits hat die Serie A angekündigt, Geisterspiele stattfinden zu lassen. Auch Begegnungen in der Europa League sollen in Norditalien ohne Zuschauer ausgetragen werden. Doch der italienischen Regierung reichen die Absichtserklärungen der Fußballfunktionäre nicht, sie übt erfolgreich Druck aus: Ab dem 4. März werden alle Sportveranstaltungen in Italien für zunächst einen Monat ohne Zuschauer stattfinden – mit besonderem Hinweis auf den Profifußball. Auch in der Schweiz pausieren zu diesem Zeitpunkt bereits die oberen Ligen. In Deutschland tut man sich mit vergleichbaren Entscheidungen noch schwer.
Das große Dilemma
Dabei ist das Corona-Virus zu diesem Zeitpunkt längst im deutschen Fußball angekommen: Zwei Tage vor den Ereignissen von Hoffenheim hat der Fußball-Verband Mittelrhein alle Spiele im Kreis Heinsberg abgesetzt. Grund: die hohe Anzahl der dort gemeldeten Corona-Fälle. Heinsberg liegt im Einzugsgebiet von Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Der Klub hatte am 22. Februar – also fünf Tage vor der Verbandssperre – noch ein Heimspiel vor 50.250 Zuschauern durchgeführt. Gegner beim 1:1 war: die TSG Hoffenheim. Die Partie musste von Schiedsrichter Dr. Felix Brych zwischenzeitlich unterbrochen werden, weil Anhänger der Borussia ein Schmähplakat gegen Dietmar Hopp entrollt hatten. Corona und mögliche Konsequenzen für den Fußball? Auch an diesem Abend am Niederrhein kein Thema …
22. Februar 2020, Borussia-Park, Mönchengladbach: Ultras der Heimmannschaft nehmen (wieder einmal) Hoffenheim-Geldgeber Dietmar Hopp ins Visier. Es ist für lange Zeit das letzte Spiel vor Publikum im Mönchengladbach.
imago images/Sven Simon
Das große Dilemma in dieser Phase Ende Februar/Anfang März: Es gibt, nicht nur im deutschen Fußball, keine einheitliche Linie angesichts von Corona. Spielabsagen, Geisterspiele, Hygieneregeln, Kontaktsperren – von Bundesland zu Bundesland, von Verband zu Verband, von Verein zu Verein wird der Situation unterschiedlich begegnet. Die generelle Verunsicherung ist spürbar. Und treibt mitunter merkwürdige Blüten. Beim Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen wird eine Gruppe Japaner des Stadions verwiesen. Grund: Der Ordnungsdienst beruft sich auf eine Empfehlung des Berliner Robert-Koch-Instituts, wonach Personengruppen aus potenziellen Risikogebieten verstärkt zu kontrollieren seien. Das Problem: Japan hat zu diesem Zeitpunkt 239 Infizierte und damit nur ein Fünftel der in Italien gemeldeten Fälle. Ob italienischstämmige Personengruppen vom Leipziger Ordnungsdienst an diesem Tag auch besonders kontrolliert werden, ist nicht bekannt. Wahrscheinlicher ist, dass die japanischen Fußballfans aufgrund ihres »asiatischen Aussehens« in einen Topf geworfen worden sind mit den von Covid-19 besonders betroffenen Chinesen. Schnell werden Rassismusvorwürfe laut, der Verein steuert dem aufbrausenden Shitstorm sofort entgegen. RB Leipzig entschuldigt sich kleinlaut für den Fauxpas seines Ordnungsdienstes: Die Sicherheitsleute seien wegen Corona schlichtweg verunsichert gewesen. Die japanische Gruppe wird als Wiedergutmachung zuerst zu einem vermittelnden Gespräch und anschließend zum RB-Auswärtsspiel am 25. Spieltag in Wolfsburg eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass dieser Bundesligaspieltag der letzte für einen langen Zeitraum sein wird.
Nichts geht mehr
Der deutsche Fußball stellt sich dem Thema Corona nun – allerdings eher unter dem Gesichtspunkt, wie die Spiele doch noch stattfinden könnten. Es geht in erster Linie um finanzielle, nicht um rein sportliche Interessen.
Während in Italien, Spanien, Frankreich, Portugal und England der Ball ruht, möchten die Funktionäre in Deutschland weiterspielen. Es hagelt Proteste. Auch von Bundesligaspielern. Bayern-Star Thiago etwa fordert in den sozialen Netzwerken: »Das ist verrückt. Hört auf rumzualbern und landet in der Realität. Es gibt Dinge, die sind wichtiger als jeder Sport.«
Wenige Stunden vor Beginn des 26. Spieltags lenkt die DFL ein. Am 13. März wird der Spielbetrieb der ersten und zweiten Bundesliga vorerst eingestellt. Dabei hat DFL-Boss Christian Seifert noch wenige Tage zuvor auf eine Fortsetzung des Spielbetriebs gedrängt. Es stehe »außer Frage«, erklärt Seifert am 8. März, »dass die Saison bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit.« Und weiter: »Das Corona-Virus bringt die gesamte Gesellschaft und damit auch den Fußball in eine schwierige Situation. (…) Dabei muss es das Ziel sein, in unterschiedlichen Lebensbereichen den jeweils angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht.« Allein an diesem Tag meldet die vom Bundesligastandort München gerade einmal 500 Kilometer entfernte Lombardei 103 Todesfälle durch Covid-19.
Dass der Fußball in Anbetracht der größten globalen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg keine Sonderstellung einnimmt, versteht man in Deutschland so spät wie in kaum einem anderen europäischen Land. Demut und Realismus setzen in weiten Teilen der deutschen Fußballbranche erst mit der verordneten Einstellung des Spielbetriebs am 13. März, dem Verschieben der EURO 2020 und dem Anstieg von Fall- und Todesopferzahlen durch Corona ein. Am 18. März sagt DFB-Präsident Fritz Keller: »Wir müssen momentan große Einschnitte hinnehmen. (…) Der Fußball tritt nun aber in den Hintergrund. Wir alle müssen uns jetzt an Regeln halten, um so Zeit im Kampf gegen die Ausbreitung des CoronaVirus zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass die Absage aller Fußballspiele in den kommenden Wochen und Monaten einen großen Beitrag dazu leistet, die Infektionskette zu unterbrechen.«