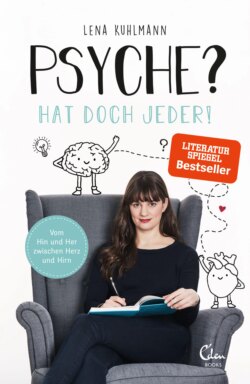Читать книгу Psyche? Hat doch jeder! - Lena Kuhlmann - Страница 8
eine gemeinsame krankheitslehre: worüber sich psychoanalytiker und tiefenpsychologen einig sind
ОглавлениеDie Geschichte der Psychoanalyse beginnt im 19. Jahrhundert mit Sigmund Freud, Josef Breuer (Arzt und Philosoph) und dessen Patientin, Bertha Pappenheimer (bekannt unter dem Pseudonym Anna O.) – sie war eine der ersten Patientinnen, die mithilfe von Sprache behandelt wurde. Es waren die zarten Anfänge der Psychoanalyse, erst später entwickelte sich die Tiefenpsychologie (kurz: TP) quasi aus der Psychoanalyse heraus. Daher leuchtet es auch ein, dass die beiden psychodynamischen Verfahren dieselbe Vorstellung über die Funktionen und die Entwicklung der Psyche teilen; die gleiche Krankheitslehre, wie wir dazu sagen.
Eine häufig verwendete Metapher, um die Psyche aus psychodynamischer Sicht zu verdeutlichen, ist das Bild eines Eisbergs. Dieser teilt sich bekanntlich in zwei Hälften. Das, was man oberhalb des Meeresspiegels sehen kann, steht für das Bewusste, also für alles, was wir im Alltag gut abrufen können. Viel interessanter ist aber der Teil, der sich unterhalb der Wasseroberfläche befindet. Er verkörpert das Unbewusste. Das Unbewusste spielt eine zentrale Rolle in den psychodynamischen Verfahren, weil davon ausgegangen wird, dass der Mensch überwiegend davon gesteuert wird. Eine Art Autopilot, der auch darüber bestimmt, wie wir auf unser Gegenüber reagieren und wie wir uns verhalten (Körpersprache, Tonlage, Mimik). Es handelt sich dabei um verborgene beziehungsweise verdrängte innere Vorgänge und Erlebnisse. Im Unbewussten schlummern Erfahrungen aus der Vergangenheit, insbesondere aus der Kindheit.5
Das Unbewusste triumphiert besonders in Stressmomenten und weil der Alltag meistens ziemlich hektisch ist, reagieren wir nicht selten wie fremdgesteuert.6 Dann ist uns oft gar nicht bewusst, was uns zu einem bestimmten Verhalten verleitet. Warum wir eine Person von Beginn der Bekanntschaft an nicht leiden können oder vielleicht auch warum Leitungspositionen eher mit Männern besetzt werden als mit Frauen. Viele gute Argumente also, um es langsam angehen zu lassen, durchzuatmen und den Dingen ein wenig Zeit zu lassen.
Aber zurück zum eigentlichen Thema und zu den Tiefenpsychologen und Psychoanalytikern. Ein Ziel der Tiefenpsychologie ist es, innere Konflikte aufzuspüren und aufzulösen. Im Vergleich zu ihren analytischen Kollegen gehen Tiefenpsychologen in ihrer Arbeit dabei etwas direkter vor und der Patient wird im Sitzen behandelt. In einer klassischen Psychoanalysesitzung dagegen redet der Therapeut nur sehr, sehr wenig. Oft liegt der Patient dabei auf einem Sofa und wird aufgefordert, seinen Gedanken ungefiltert freien Lauf zu lassen.
Das Ziel der Psychoanalyse ist unter anderem die Veränderung der Persönlichkeitsstrukturen. Das braucht natürlich seine Zeit und daher ist die Frequenz höher als bei allen anderen therapeutischen Verfahren. Man trifft sich mehrmals in der Woche und das über Jahre hinweg.7
Gemeinsam haben beide Therapierichtungen, dass sie das Buch gern ab der ersten Seite lesen. Genau das habe ich letztens einem Freund erklärt, der gerade von einem ersten Gespräch bei einem Tiefenpsychologen kam und sich ein bisschen aufgeregt hat: »Was interessiert es mich, ob ich damals gestillt wurde? Das ist fast dreißig Jahre her und ich habe weiß Gott genügend andere Probleme.« Nun, den Kinderjahren kommt in den psychodynamischen Verfahren eine besondere Bedeutung zu. Sie gelten als Fundament, auf dem das psychische Gerüst errichtet wird. Konflikte, die in dieser Lebensphase auftreten, können sich später in ähnlichen Themen niederschlagen beziehungsweise sich im Erwachsenenalter aktualisieren.
Aber fangen wir vorn an: Ausgedacht hat sich das Ganze Sigmund Freud und zu ihm kommen wir auf den folgenden Seiten. Neben seinen Theorien klären wir außerdem, wie die Zahnpasta jeden Morgen auf seine Zahnbürste kam und warum der Vater der Psychoanalyse bei Feministinnen keinen allzu guten Stand hat. Danach kommen wir zu neueren Theorien der Psychoanalyse beziehungsweise zu ihren Weiterentwicklungen. Außerdem geht es auf den nun folgenden Seiten um die frühe Kindheit, um Säuglinge und um Kleinkinder. Und weil fast alle Menschen Babys mögen, ist dies ein weiteres Argument dafür, sich von so ein bisschen Fachwissen nicht gleich abschrecken zu lassen.
DER VATER DER PSYCHOANALYSE HAT DIE KINDHEIT FEST IM BLICK
Dass Sigmund Freud irgendetwas mit Psychoanalyse am Hut hat, ist kein Insiderwissen, das nur Fachleuten vorbehalten ist. Es ist auch keine Information, mit der man bei seinen Freunden glänzen kann, und bei der beliebten Ratesendung Wer wird Millionär? gewinnt man damit höchstens eine der Aufwärmfragen. Fast achtzig Jahre nach seinem Tod ist der Begründer der Psychoanalyse noch immer das Gesicht der Psychotherapie und das, obwohl seine Theorien heute teilweise als veraltet und überholt gelten. Unvergessen ist vor allem das berühmte, durchgesessene Behandlungssofa, auf das ich mich vor meinem Kurztrip nach Wien so sehr freute. Keine Frage, natürlich stand das Sigmund-Freud-Museum in den ehrwürdigen Praxis- und Wohnräumen in der Berggasse ganz oben auf der Liste meiner Must-see-Reiseziele. Dass das gute Stück aber nicht dort, sondern in Freuds Exilwohnung in London steht, habe ich dann vor Ort schmerzlich feststellen müssen. Ich gebe zu, das hätte man wissen können, wenn man sich vorher informiert hätte. Aber das ist ein anderes Thema.
Freud sorgte Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen Theorien für viel Aufruhr. Vor allem seine Überlegungen zur Bedeutung der Triebe (in der gleichnamigen Triebtheorie) wurden oft diskutiert, denn der gelernte Neurologe ging davon aus, dass der Sexualtrieb (auch Libido genannt) eine der treibenden Kräfte im Leben eines jeden Menschen sei. Und das nicht etwa ab der Pubertät, sondern von Geburt an. Ein Skandal! Man kann sich wohl ungefähr ausmalen, dass diese Hypothesen in den eher prüden frühen Jahren des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt überall für Beifall sorgten.
Oral, anal oder ödipal – glaubt man Freud, dann durchläuft jeder Mensch zu Beginn seines Lebens verschiedene Phasen der psychosexuellen Entwicklung. Im Vordergrund steht dabei immer ein zentrales Grundbedürfnis, das aufgrund von gesellschaftlichen Spielregeln eingeschränkt wird. Dass das Leben also nicht immer eitel Sonnenschein ist, merkt beispielsweise schon der kleine Säugling, denn niemals können alle seine Bedürfnisse sofort und immer und überall befriedigt werden. Es ist ganz normal, dass kleinere Frustrationen entstehen, für deren Umgang er Strategien erlernen muss. Wenn es in den einzelnen Phasen aber zu Störungen kommt, dann können sich diese in Form von Symptomen (auch später noch) niederschlagen. Dazu im Folgenden mehr.
Die orale Phase
In der oralen Phase (die so circa bis zum 18. Lebensmonat geht) dreht sich, wie der Name bereits verrät, alles um die Befriedigung über den Mund. Die Saugaktivität zählt zu den ersten Fähigkeiten, die Säuglinge überhaupt besitzen. Alles, was irgendwie reingeht, wird angesabbert – auf diese Art erkunden Babys ihre Umwelt.8 Über das Lutschen an Mutterbrust oder Schnuller kommt es zu einer angenehmen Stimulation und Beruhigung (wir nennen das Lustgewinn). Außerdem ist das Saugen eine überlebenswichtige Funktion, die der Nahrungsaufnahme dient (das nennen wir Selbsterhaltungstrieb). Dass es dabei leicht zu kleineren Frustrationen kommen kann, erleben wir im Alltag immer wieder, beispielsweise wenn Babys weinen, weil die Mama während des Einkaufens gerade keine Zeit hat, ihrem Kind jetzt und sofort Nahrung zu geben.
Uns Therapeuten interessieren bei allen Phasen die Themen, die sich hinter den einzelnen Entwicklungsabschnitten verstecken. In der oralen Phase geht es, leicht erkennbar, um die Themen Abhängigkeit und Versorgt-Werden, schließlich ist das Baby ohne Hilfe und Unterstützung nicht überlebensfähig (über die Bedeutung, die dabei die Beziehung zur Bezugsperson einnimmt, werden wir später noch mehr erfahren).
So weit klingt das ziemlich einleuchtend, nicht wahr? Psychoanalytiker gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie beschäftigen sich beispielsweise mit der Vorstellung, dass das Baby die Mutter quasi über die Muttermilch in sich aufnimmt. Oder dass sich die Mutter umgekehrt von ihrem Säugling ausgesaugt fühlen könnte. Ihr merkt schon, in der Psychoanalyse und Tiefenpsychologie ist viel Raum für Interpretationen und manches klingt zugegebenermaßen ein bisschen weit hergeholt. Psychoanalytiker sitzen oft stundenlang zusammen, um das Verhalten eines Patienten aus verschiedenen Blickwinkeln zu deuten. Im Grunde gibt es dabei kein Richtig und kein Falsch. Alles nur Hypothesen. Diese ewige Fachsimpelei ist eine Sache, die mich auf Fortbildungen immer mal wieder in den Wahnsinn treibt.
Störungen in der oralen Phase
Kommt es in der oralen Phase zu Störungen, können psychische Auffälligkeiten die Folge sein. Kritisch wird es beispielsweise, wenn eine Mutter die Signale ihres Kindes dauerhaft falsch deutet, zum Beispiel weil sie selbst sehr belastet ist. Wenn sie das Kind stillt, obwohl es eigentlich nur in den Arm genommen werden will. Oder umgekehrt, wenn sie gar nicht mitbekommt, dass der oder die Kleine schon wieder Hunger hat.
Mögliche Zusammenhänge zwischen oralen Themen und psychiatrischen Störungsbildern werden bei Essstörungen oder Depressionen vermutet. Auch wird eine Parallele zu Suchterkrankungen gesehen. Aber orale Ersatzbefriedigungen spiegeln sich ebenso in unserem Alltagsleben wider. Nägelkauen ist ein gutes Beispiel. Auch das Rauchen einer Zigarette kann für einen Nachholbedarf an oraler Stimulation stehen (neben der Tatsache natürlich, dass Zigaretten abhängig machende Stoffe enthalten). Freud höchstpersönlich soll übrigens den Durchbruch einer Therapie gemeinsam mit seinem Patienten in einer kleinen Zigarettenpause zelebriert haben. So viel also zur Vorbildfunktion.9
Die anale Phase
In der analen Phase, die Kinder circa vom zweiten bis zum dritten Lebensjahr durchlaufen, dreht sich alles um das Ausscheiden. Es ist das Alter, in dem Jungen und Mädchen die Kontrolle über ihren Urin und Kot gewinnen, indem sie lernen, ihren Schließmuskel zu steuern. Gleichzeitig werden damit neue Anforderungen an sie gestellt und das Ende der Windelzeit eingeläutet. Es findet also erneut eine Einschränkung in der Auslebung der Bedürfnisse statt. Die Mama findet es nämlich gar nicht mehr lustig, wenn die Hose schon wieder voll ist. Auch kann man nicht jederzeit und überall zur Toilette gehen, selbst wenn es noch so dringend ist. Funktionieren und Selbstbestimmung sind somit die großen Themen dieser Phase. Es geht um Sauberkeit, um Macht und Kontrolle (gerade im Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind). Kinder fangen an, sich zu behaupten, sie wollen alles »allein« machen und eins der häufig gesagten Wörter ist »Nein«. Außerdem geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Festhalten, Loslassen und, sorry für den plumpen Ausdruck, um das »Drauf-Scheißen«.10
Störungen in der analen Phase
Kommt es in der Auslebung der analen Bedürfnisse (wie der Lust am Ausscheiden) zu Einschränkungen, beispielsweise wenn Mütter und Väter in der Sauberkeitserziehung übertrieben penibel oder angeekelt sind oder wenn sie diese zu früh einläuten, können Probleme auftreten und Störungen entstehen. So wird die anale Phase zum Beispiel oft in Zusammenhang mit Zwangserkrankungen gesehen. Unterdrückte Bedürfnisse wie das lustvolle Ausscheiden können sich dann in das Gegenteil umkehren und beispielsweise in einem Waschzwang enden.
Die ödipale Phase
Zuletzt sei hier noch kurz die ödipale Phase (oder auch phallische Phase) angesprochen. Freud hat sie nach der gleichnamigen griechischen Sage benannt (Die Geschichte des Ödipus). Ödipus hatte nämlich, wenn man hier mal die Kurzversion abspult, eine Liebelei mit seiner eigenen Mutter.
Die Stimulation findet circa im vierten bis fünften Lebensjahr über die erogenen Zonen (Penis und Klitoris) statt. In dieser Zeit setzen sich Kinder mit ihrer eigenen Geschlechtsrolle auseinander. Sie fangen an, ihren Körper zu erforschen.11 Das hat in vielen Kindergärten wahrscheinlich schon für Panikanfälle unter Erziehern, Mamas und Papas gesorgt und den einen oder anderen Elternabend zum Thema Doktorspiele initiiert.
Auch der Ödipuskomplex wird dieser Phase zugeordnet. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie ihr im Kindergartenalter ganz verliebt in euren Vater wart? Oder die männlichen Leser in die Mutter? Keine Panik, das ist, Freuds Annahmen nach, im Sinne einer »gesunden« Geschlechtsentwicklung vollkommen normal. Die Theorie des Ödipuskomplexes besagt außerdem, dass Kinder in der ödipalen Phase Eifersucht und Rachsüchtigkeit gegenüber dem gleichgeschlechtlichen Elternteil entwickeln, weil dieser mehr Zeit als das Kind selbst mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil verbringt.
Störungen in der ödipalen Phase
Es gibt (veraltete) Hypothesen darüber, dass Störungen in dieser Phase mit Homosexualität in Zusammenhang stehen könnten. Die gleichgeschlechtliche Liebe wurde sogar noch bis vor Kurzem als Krankheit geführt, bis zum Jahr 1992, um genau zu sein, als die zehnte und überarbeitete Ausgabe des ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, das Klassifikationssystem aller Erkrankungen, herausgebracht von der Weltgesundheitsorganisation) erschien. Das hat viele Menschen zu Recht sehr gekränkt. Ein Glück, dass diese Überlegungen heutzutage als überholt gelten. Love is love.
Nicht näher ausführen möchte ich hier die Latenzphase (circa vom sechsten bis zum elften Lebensjahr) und die genitale Phase (circa ab dem zwölften Lebensjahr), weil wir uns nicht allzu sehr mit den in die Jahre gekommenen Theorien aufhalten wollen. Aber auch wenn die Annahmen Freuds schon etwas veraltet sind, geben Informationen zu diesen frühen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen Entwicklung des Kindes manchmal interessante Hinweise auf zum Beispiel die dahinterliegende, fragliche Psychodynamik einer Erkrankung. Die Phasen der psychosexuellen Entwicklung werden demnach auch heute noch (leise) mitgedacht.
Das Drei-Instanzen-Modell
Es, Ich, Über-Ich: Vielleicht habt ihr schon einmal von Freuds Drei-Instanzen-Modell (auch Strukturmodell genannt) gehört? Der Theorie nach verfügt jeder Mensch über die genannten drei Parteien. Jeder Instanz wurde dabei eine andere Funktion übertragen. Dem Es wurde die Rolle des Bösen zugeteilt. Im Es gibt es keine Moral und keine Regeln, das Es ist nur auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und Triebe aus (nach dem sogenannten Lustprinzip). Rücksicht auf andere ist hier Fehlanzeige. Wenn wir an die Eisberg-Metapher am Anfang dieses Kapitels zurückdenken, dann liegt das Es unterhalb des Meeresspiegels, im Unbewussten. Freuds Idee war es, mithilfe eines bestimmten therapeutischen Settings dorthin durchzudringen. Er forderte seine Patienten auf, eine Liegeposition einzunehmen und ihren Gedanken freien Lauf zu lassen. Diese therapeutische Methode wird auch heute noch angewendet und »freies Assoziieren« genannt. Freud dachte, dass durch diese Umstände und durch den mangelnden Blickkontakt zwischen Therapeut und Patient die prüfenden Augen von Über-Ich und Ich eingeschränkt würden und damit der Zugang zum Es freigelegt werden könnte. Es ist eine Hypothese, die sich in ähnlicher Weise auch in Freuds Traumtheorie wiederfindet. Hier ging er davon aus, dass sich im Schlaf verborgene Triebe und Wünsche aus dem Unbewussten zu Wort melden. Die psychoanalytische Traumdeutung ist demnach eher eine individuelle Sache und hat keine allgemeingültige Bildsprache. Das Gerücht, jemand Geliebtes könne versterben, wenn man von einem ausgefallenen Zahn träumt, könnt ihr also beruhigt zusammen mit dem Handbuch der häufigsten Traumsymbole verbannen.12 Letztlich ist die Traumdeutung in der heutigen Psychotherapiebewegung sowieso ein bisschen in den Hintergrund getreten.
FALLBEISPIEL
Ich muss gestehen, dass ich mich schon hin und wieder mit meinen Träumen auseinandersetze. Es gibt beispielsweise so einen Traum, den habe ich immer und immer wieder. Jedes Mal versuchen Einbrecher, gruselige Wesen oder andere bedrohliche Gestalten auf verschiedensten Wegen in meine Wohnung einzudringen. Dann renne ich panisch von Tür zu Fenster, um alle Eingänge zu mir zu versperren. Mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Am nächsten Tag wache ich meist nassgeschwitzt auf und der Traum hängt mir noch viele Stunden nach. Deswegen habe ich ihn mir in meiner Selbsterfahrung deuten lassen. Unterm Strich, so die These, könnte es sich um Angriffe auf mein Ich handeln. Und tatsächlich befinde ich mich, wenn ich davon träume, meist in Job oder Alltag in herausfordernden Umständen. Wenn ich also nach einer solchen Nacht am nächsten Morgen darüber nachdenke, bin ich doch immer wieder erstaunt über diese psychodynamische Deutung, die ich ziemlich passend finde. Da kann die Hirnforschung noch so viele Fakten bringen.
Der Gegenspieler des Es ist das Über-Ich. Das Über-Ich entwickelt sich durch Erziehung und das Aufwachsen in der Gesellschaft. Es beinhaltet Normen, das Gewissen, Regeln und Grenzen und ist daher so etwas wie der Moralapostel. Weil man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen kann, soll ein Beispiel das Zusammenspiel zwischen Es und Über-Ich ein bisschen besser veranschaulichen: Gerade heute Morgen als mein Wecker klingelte, lieferten sich die Gegenspieler wieder ein kleines Duell. »Es ist so schön gemütlich hier, bleib doch einfach noch eine Weile liegen«, flüsterte mir das Es ins Ohr. »Aber, aber, das geht nicht, du musst doch los. Deine Patienten warten und du kannst auf keinen Fall zu spät zur Arbeit kommen«, entgegnete das Über-Ich panisch. »Ich bin müde«, raunzte das Es, »die kommen auch so klar.« – »Das kannst du echt nicht bringen. Was sollen deine Kollegen nur denken? Hast du mal an deine Patienten gedacht und wie sie sich fühlen, wenn sie auf dich warten müssen?« So in etwa ging das noch eine Zeit lang hin und her. Schlussendlich bin ich natürlich doch aufgestanden, denn zum Glück gibt es ja noch die dritte Instanz: das Ich, den Streitschlichter. Es hat vielleicht den schwierigsten Part, denn es muss zwischen den beiden Gegensätzen Es und Über-Ich vermitteln und noch dazu alles in Einklang mit der Realität bringen.13
Im optimalen Fall funktioniert die Zusammenarbeit der Instanzen relativ ausgeglichen. Aber es kann auch anders laufen und zu einem Ungleichgewicht kommen, wenn eine der Parteien Überhand gewinnt. Dazu fällt mir spontan eine junge Patientin ein. Sie war in jeder Stunde überpünktlich und vor allen Dingen war sie niemals krank oder musste auch nur einen einzigen Termin absagen. Was habe ich mich schlecht gefühlt, als ich einmal mit einer Grippe im Bett lag und unsere Sitzung verschieben musste. Diese Patientin war eine sehr gute Schülerin, sie war stets strebsam und fleißig, sie trank keinen Alkohol, rauchte nicht und ging immer zur selben Zeit ins Bett. Bei kleineren Meinungsverschiedenheiten mit anderen blieb sie höflich und freundlich und deswegen kam es eigentlich nie wirklich zu einem Streit. Schlussendlich stellte meine Patientin ihre Bedürfnisse hinten an, um das Gegenüber nicht zu verärgern oder zu enttäuschen. Ihre Gefühle schluckte sie einfach herunter. Dass das auf Dauer nicht gut für das eigene Wohlbefinden ist, ist ziemlich einleuchtend. Nur weil Wut und Ärger nicht rausgelassen werden, heißt das ja nicht, dass sie einfach so verschwinden. Und wenn sie nicht im Außen für Aufruhr sorgen, dann tun sie es eben im Inneren. Zum Beispiel in Form von Selbsthass, wie das bei meiner Patientin der Fall war. Uns soll dieses Beispiel dazu dienen, um eine starke Ausprägung des Über-Ichs besser zu veranschaulichen.
Ein dominantes Es fällt mir ein, wenn ich an einen Jugendlichen zurückdenke, der nur für kurze Zeit bei mir in Behandlung war. Er vergaß unsere Termine oft und eigentlich hatte er auch wenig Lust darauf, sich mit mir auszutauschen. Er verbrachte die Tage zu Hause in seinem Bett, wo er entweder schlief oder ein Onlinespiel zockte. Freie Zeit hatte er genügend, denn er war gerade (mehr oder weniger) auf der Suche nach einer neuen Ausbildungsstelle. Zuvor hatte er zwei andere Ausbildungen abgebrochen. In der ersten hatte es immer wieder Ärger mit dem Chef gegeben. Der sei aber auch ein Riesenarschloch gewesen, deswegen habe er irgendwann beschlossen, nicht mehr hinzugehen. In der zweiten Ausbildungsstelle dagegen wurde mein Patient entlassen, weil er viele Fehlstunden hatte. Davon abgesehen gab es auch mit der Polizei in regelmäßigen Abständen immer mal wieder Ärger. Alles in allem machten ihm diese Eigenschaften ein Leben in der Gesellschaft mit ihren Regeln und Normen ziemlich schwer.
Der Penisneid
Zuletzt habe ich noch eine kleinere Anmerkung, damit wir Missverständnisse aus dem Weg räumen können. Es geht um den Penisneid. Fälschlicherweise kursiert das Gerücht, hierbei handele es sich um die Sorge der Männer, sie könnten schlechter als der Rest der Truppe ausgestattet sein. Weit gefehlt. Freud meinte weniger Vergleiche wie: »Wer hat den Längsten?«, sondern bezog diese Theorie vielmehr auf das weibliche Geschlecht. Den Ursprung sah er dabei ebenfalls in den Kinderjahren (in der ödipalen Phase), wenn Mädchen bezogen auf die Genitalien der Jungen Neid empfänden und demgegenüber die Klitoris als minderwertig einstuften. Aber auch die erwachsene Frau fühle sich ohne Penis unvollständig und benachteiligt. Erst mit der Geburt des eigenen Kindes sei dieser Komplex annähernd überwunden, so Freud.14 Nun ja, das finde selbst ich ziemlich weit hergeholt und damit bin ich wohl nicht allein. Diese gewagte Theorie hat natürlich schon damals eine Welle der Entrüstung ausgelöst – vor allen Dingen unter den vermeintlich Betroffenen. Feministische Gruppen sollen sogar wütend auf die Straßen gezogen sein.
Die frauenfeindliche Haltung Freuds wird umso deutlicher, je mehr man sich mit dem Psychoanalytiker beschäftigt. Zwar gab es auch gute Momente, in denen er einforderte, auch Frauen in die Psychoanalytische Vereinigung (eine Organisation führender Psychoanalytiker, die Freud ins Leben gerufen hatte und die sich zunächst in seinen Praxisräumen traf) mit aufzunehmen; in seiner Grundhaltung verstand er das weibliche Geschlecht aber als kindlich und Über-Ich-schwach. Ab dem Alter von dreißig Jahren, so Freud, würden Frauen sich nicht mehr weiterentwickeln und zu kulturellen Beiträgen wären sie schon gar nicht imstande.15 Zu guter Letzt betitelte er sie als dunklen Kontinent. Aber wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntlich nicht mit Steinen werfen und gerade Freud zeigte sich in seiner eigenen Ehe ziemlich kleinkindhaft und unselbstständig. Er war sogar so bequem, dass er sich, so sagt man, täglich von seiner Frau die Zahnpasta auf die Zahnbürste hat schmieren lassen. So oder so, mein Feministinnenherz hat jedenfalls leise geweint, als ich das alles gelesen habe.
Zum Glück hat sich die Psychoanalyse im Laufe der Zeit weiterentwickelt und die Theorien Freuds gelten heute größtenteils als überholt. Dazu konnten nicht zuletzt neue Erkenntnisse aus der Forschung (vor allem aus der Neurologie- und Säuglingsforschung) ihren Beitrag leisten. Dennoch bilden Freuds Werke den Grundstein psychotherapeutischer Arbeit und er gilt noch heute als Ikone, die sich ziemlich gut vermarkten lässt. Neben Sigmund-Freud-Hausschuhen oder -Badeenten, Shirts mit dem Aufdruck »Deine Mutter« und, besonders lustig, wie ich finde, Tassen mit dem Schriftzug »Pink Freud« (in Anlehnung an die Rockband Pink Floyd) ist so ziemlich alles dabei.
Wer sich weiter für die Anfänge der Psychoanalyse interessiert, dem möchte ich noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben: Alle Schriften Sigmund Freuds sind im Internet frei zugänglich erhältlich, weil die Urheberrechte mittlerweile verfallen sind (zum Beispiel unter www.freud-online.de). Und sogar auf Spotify kann man sich nachgelesene Vorlesungen über die Psychoanalyse anhören (siehe Sigmund Freud: Über Psychoanalyse – fünf Vorlesungen).
An alle Hobbypsychologen
So weit, so gut. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in die Theorien Freuds bekommen und noch ein bisschen mehr Wissen gesammelt, das nur allzu leicht dazu verleitet, das Verhalten eurer Mitmenschen näher zu analysieren. Das ist allerdings nicht sonderlich zu empfehlen. Erstens ist dies nur ein kleiner Auszug der Theorie und nicht ohne Grund handelt es sich sowohl bei dem Psychologiestudium als auch bei der Psychotherapeutenausbildung um eine mehrjährige Angelegenheit. Außerdem kann jemand, der emotional involviert ist, keine objektiven Hypothesen aufstellen – das weiß ich aus erster Hand zu berichten. Und zu guter Letzt: Was bringt so eine (selten von den Betroffenen erbetene) Laienanalyse, wenn man nicht weiß, was man damit nun anfangen soll?
FORTSETZUNG FOLGT: WIE ES NACH FREUD WEITERGING
Die Geschichte der Psychoanalyse geht nach Sigmund Freud natürlich noch weiter (auch wenn diese Neuerungen leider wenig Beachtung in der heutigen Gesellschaft finden). Genau genommen bleibt das Ganze in der Familie, zumindest unter anderem.
Die Ich-Psychologie
Anna Freud, ja richtig, Freuds Tochter, hat die Arbeiten ihres Vaters weiter fortgesetzt. Sie war eine Vertreterin der Ich-Psychologie, die auf Freuds Triebtheorie (Es, Ich, Über-Ich) aufbaut. Das Ich steht dabei im Mittelpunkt. So nahm man an, dass sich das Ich vor Angriffen von außen schützen kann. Dazu verfügt es über sogenannte Abwehrmechanismen. Verdrängung beispielsweise ist einer davon. Ein paar Absätze weiter werden wir uns noch einmal ausführlicher mit diesen Schutzmechanismen beschäftigen.
Die Selbstpsychologie
Heinz Kohut (unter anderem) hat die Überlegungen Freuds ebenfalls genutzt, um seine eigene Theorie, die Selbstpsychologie, darauf aufzubauen. Dabei rückte er die Beziehungen zu anderen Menschen mehr in den Fokus. Kohut nahm an, dass Störungen entstehen, wenn die Beziehungen zu Bezugspersonen unbefriedigend sind. Für eine gesunde Entwicklung brauche schon der Säugling unter anderem Spiegelung, das heißt jemanden, der seine Gefühle in sich aufnimmt und zurückspielt, der ihm zeigt: »Du bist willkommen.« Es gibt in diesem Zusammenhang ein bekanntes Experiment, das mich sehr bewegt hat. Man findet es im Internet, wenn man nach »still face Experiment« sucht. Das Video zeigt auf eine sehr berührende Weise die Verzweiflung und Hilflosigkeit eines Babys, wenn das Gegenüber in der Interaktion die Mimik einfriert. Das ist fast nicht auszuhalten, so schlimm finde ich das.
Die Objektbeziehungstheorie
Und dann gibt es noch die Objektbeziehungstheorie (unter anderem nach Melanie Klein), die die Beziehung zur Mutter (oder einer anderen wichtigen Bezugsperson, hier Objekt genannt) in den Mittelpunkt stellt.16 Diese Verbindung gilt als Grundlage für die weitere Entwicklung der Persönlichkeit und der Beziehungsgestaltung. Beziehungen werden nach dieser Vorlage eingeordnet (zum Beispiel bedrohlich? freundlich? gut? böse?).
Die vielen Gesichter einer Kindheit
Alle Erklärungsmodelle der Psychoanalyse starten in den Säuglings- und Kleinkindtagen und ihr könnt euch vorstellen, dass diese prägende Zeit ziemlich unterschiedlich ausfallen kann. Genau genommen fängt sie eigentlich schon neun Monate vorher (pränatal, also vor der Geburt) an: War es denn ein Wunschkind? Wie ging es der Mutter in der Schwangerschaft? Und wie dem Vater in seiner neuen Rolle? Gab es im Verlauf irgendwelche Komplikationen? Oder anderweitigen Stress? Wie wurde die Geburt erlebt? Und kam das Kind gesund und munter zur Welt? Fragen, die wir Psychotherapeuten in einem Erstgespräch mit den Patienten, wenn möglich, gern erheben.
Das Willkommenspaket in dieser Welt ist für jedes Baby unterschiedlich ausgestattet. Da gibt es Kinder, die in eher schwierigen Verhältnissen leben, mit finanziellen Sorgen oder schwierigen Familiensituationen. Es gibt Kinder, die im Krieg aufwachsen, auf der Flucht oder in einem Umfeld, in dem es viel Streit oder Stress gibt. Manche Eltern können sich nur eingeschränkt um ihre Kleinen kümmern, weil sie selbst (psychisch) erkrankt sind, weil sie vielleicht anderweitig eingespannt oder belastet sind, oder aber sie sind nicht empathisch genug, können sich nicht in das Baby hineinfühlen oder sind mit der Elternschaft überfordert. Andere wiederum sind überfürsorglich und überbehütend. Stets in Sorge um ihren Schützling, kreisen sie wie ein Helikopter über dem Kind und lassen ihm kaum Raum, um in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, selbstständig und selbstbewusst zu werden und sich altersangemessen vom Elternhaus loszulösen. Man hat es eben nicht in der Hand, wie man in die Welt startet. Mir fällt in diesem Zusammenhang ein scherzhafter Spruch ein, der mir im Internet schon mehrfach begegnet ist: »Man kann sich seine Familie leider nicht aussuchen, seinen Psychotherapeuten dagegen schon.« Oder wie andere Kollegen manchmal nicht ganz ernst gemeint sagen: »Augen auf bei der Elternwahl!«
Aber auch ohne ungünstige Faktoren gilt es in der Kindheit viele Entwicklungshürden zu meistern. Dazu zählen Veränderungen und neue Situationen wie die Eingewöhnung in die Kindertagesstätte, die Einschulung, der Wechsel auf die weiterführende Schule, die Suche nach der beruflichen Perspektive, körperliche und hormonelle Veränderungen in der Pubertät, die Geburt eines Geschwisterkindes, die erste Liebe, sexuelle Erfahrungen oder das Loslösen vom Elternhaus. Diese ganzen Umstellungen bringen die Psyche in Dauerrotation. So ist das eben mit dem Großwerden. Einfach ist es nicht.
Von diesen ganz normalen Entwicklungsherausforderungen abgesehen, kann der Mensch zu jeder Zeit seines Lebens zusätzlich kritischen Ereignissen oder Katastrophen ausgesetzt sein. Zu den sogenannten Life-Events zählen unter anderem der Verlust einer geliebten Person, Trennung, Scheidung oder eine schwere Erkrankung. Life-Events können das Ausbrechen einer psychischen Erkrankung fördern und manchmal sind sie so etwas wie der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.17
Die genannten äußeren Umstände können Faktoren sein, die Belastungsmomente darstellen oder Konflikte auslösen, sie müssen es aber nicht. Und bitte nicht falsch verstehen: Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden, und schon gar nicht um Mother-Blaming. Die perfekte Kindheit, die fehlerfreien Eltern, den perfekten Lebenslauf gibt es nicht. Niemals. Und das ist auch gut so, schließlich merken Kinder auf diese Weise, dass man im Leben auch Fehler machen darf und wie man damit einen Umgang findet.
Es gibt aber, das muss ich zugeben, durchaus Fälle, in denen das Umfeld einen großen Teil dazu beiträgt, innere Konflikte zu unterfüttern. So war das nämlich bei einer meiner Patientinnen, deren Eltern aus der Türkei kamen. Sie wurde streng religiös erzogen und die Eltern wünschten sich, dass ihre Tochter ihre Ansichten und Haltung teilte. Meine Patientin hatte aber ihren eigenen Kopf und wollte ein Leben wie ihre Mitschülerinnen führen. Weil diese eher moderne, offene Lebenseinstellung nicht gern gesehen war, versuchten die Eltern, sie mehr und mehr einzuschränken. Schlussendlich führte dies dazu, dass meine Patientin in ihrem Leben keinen Sinn mehr sah. Sie klagte über Antriebsschwäche, mangelnde Lebensfreude und eine getrübte Stimmung. Das ging sogar so weit, dass sie sich konkrete Ausführungsideen für Suizid überlegte.
Sie befand sich in einem unauflösbaren Konflikt und konnte ihre eigenen Bedürfnisse nicht ausleben. Noch dazu hatte sie ein schlechtes Gewissen und wollte ihre Familie weder verraten noch verlassen. Letztlich entschied sich das Mädchen unter Zuhilfenahme des Jugendamtes dafür, in einer Wohngruppe zu leben. Ihre Symptome linderten sich relativ schnell, wenngleich sie noch lange Zeit später Schuldgefühle plagten. An der Beziehung zu ihren Eltern konnte im Verlauf gearbeitet werden.
Die Psyche hat einen Schutzschild
Die Psyche ist großen und kleinen Herausforderungen nicht wehrlos ausgesetzt, denn zum Glück gibt es ja noch die Abwehrmechanismen. Sie können zwar keine Konflikte lösen, dafür aber Frustrationen erträglicher machen und das Selbstbild vor weiteren Beschädigungen schützen. Dies ist eine wichtige Funktion, die das Überleben im Alltag manchmal überhaupt erst möglich macht.
FALLBEISPIEL
Ich hatte mal einen Patienten, dessen Vater starb, als er acht Jahre alt war, und zwar ziemlich dramatisch an einem Herzinfarkt, während sein Sohn mit ihm allein zu Hause war. Eine traumatisierende Situation, nach der sich mein Patient aber zuerst gar nicht belastet zeigte. Er ging ganz normal zur Schule, seine Noten blieben auf demselben Niveau und auch in anderen Bereichen lief es eben so weiter wie bisher. Freunde und Bekannte berichteten zu dieser Zeit, man habe ihm die Trauer gar nicht angemerkt und geweint habe er auch nicht. Ich vermutete also, dass er diesen Vorfall zum Selbstschutz verdrängt hatte. So gewaltig waren die Gefühle, so unerträglich der Schmerz – wie hätte er das auf einmal verarbeiten können? Deswegen wurde alles in eine große Kiste gepackt, ein dickes Seil darum geschnürt und ab damit in die hinterste Ecke der Psyche. Erst viele Jahre später fing die Kiste plötzlich an zu rappeln. Die Seile lösten sich und der Deckel schien nicht mehr richtig zu halten. Stück für Stück ließ die über Jahre hochgezogene Abwehr nach, häppchenweise kamen die verdrängten Gefühle wieder an die Oberfläche und das mit ziemlicher Wucht, trotz all der Jahre, die bereits vergangen waren. Gefühle haben eben kein Verfallsdatum. Mein Patient verfügte mit der Zeit aber über mehr Ressourcen, wie er mit diesem Schicksalsschlag einen Umgang finden konnte. Und er holte sich Hilfe. Dann begann der Teil, den wir Verarbeitung nennen. Alles zu seiner Zeit.
Im hier geschilderten Beispiel kam der Abwehrmechanismus der Verdrängung zum Einsatz. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von weiteren Abwehrmechanismen, die uns im Alltag begegnen. Hier folgt ein kleiner Ausschnitt:
•Bei der Vermeidung werden angstbesetzte, unangenehme Situationen umgangen. Der jährliche Kontrolltermin beim Zahnarzt ist da ein gutes Beispiel. Na? Wer war noch nicht, wer muss noch mal?
•Bei der Verleugnung wird die Realität verzerrt und nur in Teilen wahrgenommen. Sie begegnet uns im Alltag häufig.
•Bei der Wendung gegen das Selbst dürfen wir uns von der sperrigen Begrifflichkeit nicht stören lassen. Mit Selbst ist in diesem Fall die eigene Person gemeint. Das Wort »Ich« war in der Welt der Psychoanalyse, wie ihr jetzt wisst, bereits vergeben. Bei der »Wendung gegen das Selbst« werden Aggressionen, die eigentlich einer anderen Person gelten, gegen sich selbst gerichtet. Vielleicht weil man unbewusst das Gegenüber nicht verletzten will oder weil man Angst um die Beziehung zu dieser Person hat. Die aggressive Energie wütet also nicht in Form eines Streites im Außen, sondern im Inneren (ähnlich wie bei unserem Beispiel zum Über-Ich). Es ist eine Form der Selbstbestrafung und auf Dauer natürlich nicht sonderlich gesund. Beispiel: »Paul ist gestern in unserem Streit total ausgerastet und hat mich übel beschimpft. Aber er hat ja auch recht: Ich bin einfach keine gute Zuhörerin und vergesslich bin ich auch.«
•Bei der Projektion werden eigene Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle oder Gedanken einfach auf das Gegenüber verschoben. Dazu ein klassisches Beispiel aus dem Beziehungsalltag: »Oh Mann, jetzt bist du ja schon wieder total genervt« – wenn man es eigentlich selbst ist.
•Bei der Intellektualisierung werden emotionale Inhalte auf eine sachliche, theoretische Ebene gebracht. Beispiel: »Marlene und ich haben uns vor vier Wochen scheiden lassen. Keine seltene Angelegenheit, wenn man sich mal so im Freundeskreis umschaut. Gerade gestern habe ich wieder eine Studie gelesen, dass in Deutschland jede zweite Ehe geschieden wird.«
•Die Rationalisierung ähnelt der Intellektualisierung. In diesem Fall werden allerdings eigene Gefühle auf gesellschaftlich anerkannte Gründe zurückgeführt. Beispiel: »Nach dem Ärger mit der Chefin habe ich schon wieder Kopfweh. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig getrunken.«
•Bei der Affektisolierung oder auch Isolierung werden Gefühle, die einen in einer bestimmten Situation begleitet haben, ausgeklammert. Der Betroffene erinnert sich zwar an die Situation, nicht aber an das, was er dabei empfunden hat.
•Die Affektualisierung ist die Übertreibungsform. Ihr habt vielleicht auch eine kleine Drama Queen im Freundeskreis, die aus jeder Mücke einen Elefanten macht? Beispiel: »Mein Tag war fürchterlich. So viel Stress hatte ich noch nie auf der Arbeit. Die Kunden waren eigentlich alle unhöflich und haben sich die ganze Zeit beschwert. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ausbildung noch zu Ende machen kann, so schlimm fand ich das heute.«
•Bei der Reaktionsbildung handelt es sich um eine Umkehr ins Gegenteil. Ängste und aggressive Impulse werden nicht ausgelebt und einfach in das Gegensätzliche gewendet. Aus Minus wird Plus. Dahinter könnte ein strenges Über-Ich als Moralinstanz stehen oder die Angst, die Beziehung zu gefährden. Beispiel: »Hier hast du einen selbst gebackenen Kuchen. Ich wollte dir damit einfach mal so eine Freude machen.«
•Ein Rückzug auf frühere Entwicklungsstufen ist mit dem Abwehrmechanismus der Regression gemeint. Zu beobachten ist das vor allen Dingen bei Kindern, die ein Geschwisterchen bekommen. Gar nicht so selten verfallen sie dann wieder in Babysprache, nässen erneut ein oder wollen von Mama und Papa angezogen werden, obwohl sie das schon lange allein können. Dieses Phänomen ist aber auch bei Erwachsenen zu beobachten, zum Beispiel bei Krankheit. Auch im Alltag kann es einer gestandenen Frau passieren, dass sie, wie damals als kleines Mädchen, in Tränen ausbricht und sich am liebsten in einer Ecke zusammenkauern würde, weil sie nach einem hektischen Tag auf der Arbeit auch noch ewig im Stau stand, obwohl sie eigentlich einen dringenden privaten Termin hätte wahrnehmen müssen. Ich spreche da aus Erfahrung.
•Bei der Idealisierung werden andere Menschen, die in der Psychoanalyse und Tiefenpsychologie übrigens Objekte genannt werden, überbewertet beziehungsweise idealisiert. Das habe ich gerade letztens wieder erlebt, als mein bester Freund die Beschreibung seiner neuen Freundin zum Besten gab: »Ida ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Sie ist schlauer als alle anderen und humorvoller ist sie auch. Ich war niemals glücklicher.«
•Bei der Spaltung findet eine Trennung in Gut und Böse statt. Es gibt nur Schwarz und Weiß und nichts dazwischen. Neulich beim Friseur rief eine Kundin durch den ganzen Laden: »Ich könnte mir keine bessere Hairstylistin für mich vorstellen. Die Frau, bei der ich früher war, hat mir die Haare grauenhaft geschnitten. Ich sah aus wie ein gerupftes Huhn. Sie dagegen verstehen ihr Handwerk und das sieht man auch.«
•Auch Somatisierungen können zu den Abwehrmechanismen gezählt werden. Oft ist es für uns Therapeuten ein Warnzeichen, wenn der Konflikt schon in das Körperliche übergeht. Kinder mit Trennungsängsten klagen beispielsweise nicht selten an Schultagen über (echte und nicht gespielte) Bauchschmerzen, die sich meist wieder legen, wenn sie nicht in die Schule gehen müssen. Die Angst, ohne Mama zu sein, kann sich also verkleiden. Vor allem den psychosomatischen Störungen wird ein enger Zusammenhang zur seelischen Befindlichkeit nachgesagt. Zu diesen Erkrankungen können Rheumatoide Arthritis, Asthma, Bluthochdruck, Schilddrüsenüberfunktion oder Neurodermitis zählen. Aber auch Migräne und Rückenschmerzen sind Klassiker, die für eine psychische Belastungsreaktion stehen können.18
Hinter der Abwehr
Es gibt Abwehrmechanismen, die besonders häufig bei bestimmten Störungsbildern vorkommen. Angststörungen und Vermeidung tauchen zum Beispiel gern im Doppelpack auf, wenn die angstbesetzte Situation umgangen wird. Spaltung ist dagegen ein typisches Merkmal der Borderline-Störung. Depressive tendieren eher zur Regression oder zur Wendung gegen das Selbst (in Form von Selbstzweifeln, Selbsthass). Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung neigen zur Entwertung (der anderen) und zur Idealisierung (der eigenen Person). Bei Zwängen kommt meist der Abwehrmechanismus der Reaktionsbildung zum Einsatz.
Ein Ziel der therapeutischen Arbeit ist es, diese Schutzmauer abzubauen, um an die dahinterliegenden Konflikte zu kommen und diese aufzulösen. Dazu muss man sie natürlich erst einmal aufspüren, was zum Thema in der Fallbesprechung mit den Kollegen werden kann (und zur Analyse der Psychodynamik des Patienten gehört).
Jetzt, wo ihr eingeweiht seid, entdeckt ihr diese Mechanismen vielleicht auch bei euch selbst oder aber, sehr viel wahrscheinlicher, bei Menschen in eurem Umfeld. So ging es mir zumindest, nachdem ich mich intensiver damit auseinandergesetzt hatte. Aber aufgepasst und auch wenn ich mich an dieser Stelle wiederhole: Psychologisches Grundwissen hilft dabei, das Gegenüber besser zu verstehen, dennoch sollte man Laieninterpretationen immer mit Vorsicht genießen und auch ich halte mich im Privaten damit sehr zurück, weil es als Freundin, Kollegin oder Familienmitglied nicht meine Aufgabe ist, therapeutisch zu analysieren oder zu intervenieren.
KONFLIKTE, DIE MAN MIT SICH SELBST AUSMACHEN MUSS
Man kann, das sage ich aus Erfahrung, ziemlich schnell in Konflikte geraten. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich signifikant, wenn man sowieso schon miese Laune hat und das Wetter auch noch schlecht ist. Dann streitet man sich vielleicht darüber, wer zuerst den Blinker gesetzt hat, um in die freie Parklücke zu steuern, warum die Milch schon wieder leer ist und wieso zur Hölle man nicht einfach eine neue kaufen kann. Oder darum, wer in der Schlange an der Brottheke als Nächster dran ist. Um diese Konflikte geht es hier zum Glück nicht.
In den psychodynamischen Verfahren gehen wir davon aus, dass hinter jedem Symptom ein unbewusster, innerer Konflikt steckt.19 Aber wie darf man sich das bitte schön vorstellen?
Die intrapsychischen Konflikte, in die ein Mensch verstrickt sein kann, werden im sogenannten OPD-2 oder für Kinder im OPD-KJ-2 (Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik, zweite Ausgabe) gelistet. Diese Übersicht soll dem Therapeuten dabei helfen, die oft schwammigen psychodynamischen Prozesse des Patienten ein bisschen greifbarer zu machen. Außerdem ist sie bei der Planung des Therapieverlaufs eine gute Unterstützung. Das OPD besteht aus mehreren Unterteilungen (zum Beispiel Beziehung, Krankheitserleben oder Strukturniveau), hier Achsen genannt. Besonders interessant finde ich die im Folgenden beschriebene Konfliktachse.20
Nähe vs. Distanz (oder auch Individuation vs. Abhängigkeit): Den hier angesprochenen Konflikt beobachte ich in der heutigen sogenannten »Generation beziehungsunfähig« häufig. Es ist das Verlangen nach einer Beziehung, einem sicheren Hafen und Geborgenheit auf der einen und die Sehnsucht nach absoluter Freiheit, Abenteuer und Abwechslung als Single auf der anderen Seite. Beides gleichzeitig geht nun mal nicht. Einige meiner Freunde Anfang dreißig befinden sich, wenn ich das an dieser Stelle unterstellen darf, in einer ähnlichen Krise und können sich zwischen Heirat und der Suche nach einer oder einem anderen (besseren?) Partner beziehungsweise Partnerin nicht entscheiden. Diese Zerrissenheit bedeutet Stress für die Psyche. Es ist ein Zwiespalt, in dem sich schon das Kleinkind befindet. Einmal will es alles allein machen, dann soll die Mama doch lieber mithelfen. Im Vordergrund dieses Konfliktes steht demnach die Bedeutung von Bindung und Beziehung.
Unterwerfung vs. Kontrolle: Ich gehe gern zu Hochzeiten und immer wenn eine Einladungskarte eintrudelt, bin ich ganz aus dem Häuschen. So viel Freude, so viele Liebesbekundungen – ich glaube, eine schönere Gelegenheit, um das Leben zu feiern, kommt selten. Das Anschneiden der Hochzeitstorte zählt zu meinen persönlichen Highlights. Kennt ihr diese Tradition, dass derjenige, der die Hand dabei oben hat, auch in der Ehe das Sagen haben wird? Erstaunlich eigentlich, wie oft man als Außenstehender mit Einschätzungen zur Beziehungsdynamik des Hochzeitspaares am Ende richtig tippt. Nun ja, warum ich das erzähle? Weil es in diesem Konflikt darum geht, wie sehr man sich in einer Beziehung unterwirft beziehungsweise unterordnet oder ob man alles mit sich machen lässt. Ob man die Kontrolle behalten will (aus Angst vor dem Kontrollverlust) und immer der Bestimmer sein muss.
Selbstversorgung vs. Versorgtwerden (ehemals Autarkie): Im Zentrum dieses Konfliktes steht die Frage danach, ob ein Mensch in einer Beziehung eher für sich selbst die Verantwortung behalten will oder ob er sich auch versorgen lassen kann, zum Beispiel im Hinblick auf finanzielle Themen. Ist dieser Konflikt sehr ausgeprägt, kann sich dies in klammerndem Verhalten oder Ausbeutung des Partners zeigen.
Selbstwertkonflikt: Wie der Name verrät, dreht sich hier alles um den Selbstwert. Gegenüber stehen sich einerseits Minderwertigkeitskomplexe, Selbstunsicherheit und die Aufwertung anderer Menschen und das genaue Gegenteil auf der anderen Seite: Selbstüberschätzung, Tendenzen zum Größenwahn und die Überbewertung der eigenen Person. Ein mangelndes Selbstbewusstsein kommt übrigens gar nicht so selten vor. Es ist einer der am häufigsten genannten Veränderungswünsche meiner Patienten.
Schuldkonflikt: Der Schuldkonflikt gibt Hinweise darauf, wie Menschen in Konflikten mit anderen umgehen. Da gibt es solche, die die Ursachen immer bei sich selbst suchen, sich Vorwürfe machen oder sich gar bestrafen. Und dann gibt es andere, die immer nur das Gegenüber dafür verantwortlich machen, wenn irgendetwas nicht klappt oder es Streitigkeiten gibt, Menschen, die überhaupt keine Einsicht zeigen.
Ödipaler Konflikt: Dieser Konflikt bezieht sich auf die ödipale Phase, die wir im vorangegangenen Kapitel schon kennengelernt haben, und auch in diesem Fall stehen sich zwei Extreme gegenüber. Einerseits nämlich die Auslebung sexueller Wünsche, zum Beispiel in Form von gesteigertem Flirtverhalten, aufreizender Kleidung, Offenheit oder sexueller Experimentierfreudigkeit. Und auf der anderen Seite Hemmungen und Beklemmungen hinsichtlich sexueller Themen und Erotik bis hin zur Verdrängung dieser Bedürfnisse.
Identitätskonflikt: Die Suche nach der eigenen Identität ist ein Prozess, der im Grunde das ganze Leben andauern kann. Gegenüber stehen sich Unsicherheiten hinsichtlich der eigenen Person und die Identitätssicherheit auf der anderen Seite. Es ist eben gar nicht so einfach zu wissen, wer man ist.
Diese Liste soll zeigen, dass es sich bei allen Konflikten nicht um total abwegige Situationen handelt, die nur den anderen passieren. Genau genommen sind alle Konstellationen ziemlich menschlich, oder? Einmal durchgelesen, findet man vielleicht den einen oder anderen Punkt, in dem man sich ein bisschen wiedererkennt. Oder etwas, das man zumindest gut nachvollziehen kann.
Die Tiefenpsychologie hat für sich erkannt, dass so eine dauerhafte Zerrissenheit auf die Kosten der Psyche geht und es zu krankhaften Symptomen kommen kann. Nichts also mit psychisch Kranken, die total durchgedreht, ballaballa oder bekloppt sind. Vielmehr handelt es sich um unaufgeregte und ziemlich alltägliche Dinge, wie ich finde.
Dankbar können all jene sein, die sich psychisch gesund fühlen. Wer sich also nur mit dem Finanzamt, mit seinem Bruder oder den Lehrerinnen rumärgert, der kann sich glücklich schätzen, dass er nicht auch noch in seinem Inneren einen Wirbelsturm bekämpfen muss.
BINDUNGSTHEORIE — WARUM SICH MUSTER AUS DER KINDHEIT IN PARTNERSCHAFTEN WIEDERHOLEN
Ich habe meine Diplomarbeit damals – herrje, klingt das eingestaubt, na ja, vor einiger Zeit eben – über die Bindungstheorie geschrieben und immer, wenn dieses Thema zur Sprache kommt, fühle ich mich an die vielen Stunden in der Universität erinnert. Ich weiß noch genau, wie ich in der riesigen Bibliothek verzweifelt nach verborgenen Büchern gesucht, den langsamen Kopierer verflucht und mich in kryptischen Fachtexten verloren habe. Der traurige Höhepunkt meines Tages war das tägliche Mittagessen in der Mensa und das allein zeigt schon, wie trist diese Zeit ausgesehen hat. Damals hätte ich also im Leben nicht gedacht, dass ich Jahre später wieder an einem Text zu diesem Thema brüten würde. Freiwillig auch noch.
Die Bindungstheorie ist Teil der psychodynamischen Verfahren und John Bowlby ist der Name, den man sich in diesem Zusammenhang gut merken sollte. Der studierte Mediziner widmete sich Anfang der Vierzigerjahre nicht ganz ohne Hintergedanken der Bedeutung der frühen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Bowlby selbst hatte ein distanziertes Verhältnis zu seiner Mutter und wurde überwiegend durch Angestellte betreut.21
In einer seiner Forschungsarbeiten für die Weltgesundheitsorganisation konnte er aufzeigen, dass die mangelnde Fürsorge und emotionale Zuwendung durch das Pflegepersonal in europäischen Waisenhäusern der Nachkriegszeit teilweise zum Tod der Schützlinge führte.22 Daraus folgernd sprach er der emotionalen Versorgung einen großen Stellenwert zu.
Bowlby forschte in einer Zeit, in der man noch nicht allzu viel über die Fähigkeiten eines Säuglings wusste. Damals dachte man, man müsse das Kind auch mal richtig brüllen lassen, damit sich die Lungen weiten, und dass man nicht immer sofort springen sollte, wenn das Baby einmal schreit. Man nahm an, dass der Säugling ein ziemlich passives Wesen sei, und man war sich nicht sicher, ob und was er überhaupt von seiner Umwelt mitbekommt. Das änderte sich glücklicherweise, nachdem man anfing, dies genauer zu untersuchen.
Info
In den Fünfzigerjahren führte Harry Harlow mehrere Untersuchungen mit kleinen Rhesusaffen durch. Er trennte sie von ihrer Mutter und bot ihnen stattdessen zwei »Ersatzmütter« an. Bei der einen handelte es sich um ein milchspendendes Drahtgestellt, die andere Attrappe verfügte über ein Gesicht und war mit Handtüchern etwas kuscheliger ausgestattet. Zusammenfassend hielten sich die armen Äffchen überwiegend bei der mutterähnlichen, flauschigeren Figur auf und suchten das einfache Drahtgestell nur zur Nahrungsaufnahme auf. Essen allein ist eben nicht alles.
In der Bindungstheorie nach Bowlby geht es darum, wie schnell und stimmig die Bedürfnisse des Säuglings von der (männlichen oder weiblichen) Bindungsperson befriedigt werden. Bowlby nennt das feinfühliges Verhalten: Es ist die Kunst, sich auf den Säugling einzulassen, auch ohne Sprache zu erkennen, was er gerade braucht, um diesem Verlangen im zweiten Schritt nachzugehen. Vor allen Dingen auf die, wie er es nennt, prompte Bedürfnisbefriedigung komme es an. Also stillen, wenn das Baby Hunger hat, kuscheln, wenn es Zuwendung braucht.23 Es handelt sich dabei um eine intuitive Angelegenheit: wie man das Kind hält, wie man mit ihm kommuniziert (der typische Elternsingsang), welche Stimmung zwischen beiden entsteht. Da hilft dann auch ein Elternratgeber wenig weiter.
Diese Bindung zwischen Mutter und Kind dient als inneres Arbeitsmodell. Das Kind speichert Informationen darüber fest ab. Es bemerkt: »Wenn ich Angst habe und weine, dann bekomme ich sofort Unterstützung und werde von meiner Mama getröstet.« Es hat viel damit zu tun, ob sich das Kind in seinen Belangen gesehen fühlt, ob jemand da ist und es wahrnimmt. Danach entwickelt sich eine Art Schubladendenken für die einzelnen Beziehungen. Wir sagen dazu Bindungsrepräsentanzen. Die dort gespeicherten Informationen überdauern viele Jahre und schlagen sich auch in neuen Beziehungen nieder.24 Wenn es der Bezugsperson nicht gelingt, in diesem Sinne auf das Kind einzugehen, ist die Entwicklung einer sicheren Bindung gefährdet. Und das kann sich dann auch auf spätere Beziehungen im Leben des Kindes auswirken, sogar noch im Erwachsenenalter. Außerdem ist eine unsichere Bindung ein Faktor, der die Entstehung psychischer Krankheiten fördern kann. Aber, und das ist die gute Nachricht, Bindungsmuster sind veränderbar.
Bindung ist nicht gleich Bindung und um die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung zu messen und Unterschiede aufzuzeigen, hat die Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth in den Siebzigerjahren den sehr bekannten Fremde-Situation-Test konstruiert. Es handelt sich dabei um eine feste Abfolge von Trennungs- und Wiedervereinigungsszenen, in denen das Kleinkind beobachtet wird, während seine Mutter den Untersuchungsraum verlässt. Das Verhalten des Kindes wird dann in eine der folgenden vier Kategorien aufgeteilt.
Sicher gebundene Kinder rufen nach der Mutter und suchen sie, wenn sie nicht im Raum ist. Dabei weinen sie und erscheinen gestresst. Bei ihrer Wiederankunft kann man ihnen die Freude und Erleichterung ansehen. Es ist ein Verhalten, das man so auch erwarten würde, demnach also der Normalzustand und eine optimale Bedingung für die weitere Entwicklung. Erwachsene, die sicher gebunden aufgewachsen sind, erlebten ihre Kindheit meist als behütet und beschreiben eine gute Beziehung zu ihren Eltern. Sie berichten davon, in Krisen Unterstützung erhalten zu haben. In der Regel verfügen sie über einen guten Zugang zu den eigenen Gefühlen und können meist spüren und benennen, wie es ihnen gerade geht. In Beziehungen beziehungsweise Partnerschaften zeigen sie sich verfügbar, können über ihre Empfindungen offen sprechen und sich an unterschiedliche Situationen anpassen. Eine sichere Bindung ist, wie wir einige Seiten vorher schon erfahren haben, ein Schutzschild, der vor psychischer Krankheit schützen kann (ein Resilienzfaktor).
Kinder mit unsicher-vermeidender Bindungsstruktur stellen eine weitere Kategorie dar. Sie reagieren in der Untersuchungssituation wenig, wenn die Mutter den Raum verlässt. Auch wenn die Mutter zurückkommt, zeigen sie sich eher verhalten bis ablehnend. In Untersuchungen wies man ihnen dennoch einen enormen Stresspegel nach. Später, also im Erwachsenenalter, zeigen sich diese Menschen in ihren Beziehungen wenig reflektionsfähig. Der Zugang zu den eigenen Gefühlen ist eingeschränkt, was sich wiederum negativ auf die Qualität der Beziehung zum Partner auswirken kann.
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder zeigen sich in der Trennungssituation massiv gestresst und hilflos. Auch bei Ankunft der Mutter können sie nur schwer beruhigt werden. Ihr Verhalten ist ambivalent: Einerseits suchen sie den Körperkontakt, auf der anderen Seite zeigen sie aggressives Verhalten, zum Beispiel indem sie nach der Mutter schlagen oder treten. Noch lange nach der Volljährigkeit kann diesen Menschen die Ablösung von der Mutter schwerfallen, weil die Beziehung zu ihr auf Unsicherheiten und auf wackligem Fundament gebaut ist. Diese Geister der Vergangenheit können sich, wie in den vorangehenden Fällen, auch im Hier und Jetzt und in neuen Beziehungen niederschlagen.
Kinder mit desorganisiertem Bindungsverhalten stellen die letzte Gruppe dieser Aufzählung dar. Häufig wurden Betroffene in der frühen Kindheit Traumatisierungen und massiven Ängsten ausgesetzt. Beziehung wurde als etwas Bedrohliches wahrgenommen. Dementsprechend schwierig gestaltet sich auch das Miteinander im Erwachsenenalter. Partnerschaften sind von Misstrauen geprägt und erweisen sich als sehr fragil.25
Natürlich gibt es immer nachvollziehbare Gründe für das Verhalten einer Mutter, das sich wiederum in der Bindungsstruktur niederschlagen kann. Ich habe eine Freundin, die im Umgang mit ihrem Baby zunächst sehr entspannt war, bis dieses von jetzt auf gleich vorübergehend aufhörte zu atmen und die Lippen blau anliefen. Da war meine Freundin natürlich in großer Panik, der Notarzt kam und alle waren außer sich vor Sorge. Am Ende ging Gott sei Dank alles gut aus. Aber ab dann war von der ursprünglichen Gelassenheit im Umgang mit der Kleinen natürlich nicht mehr viel übrig. Ziemlich logisch, dass eine Mutter im weiteren Verlauf mehr »klammert« oder in Sorge ist. Deswegen sind die Schilderungen dieser Zeit für uns Therapeuten wertvolle Informationen.
Die Geburt des eigenen Kindes und die Begleitung durch seine Entwicklungsphasen kann außerdem immer (verdrängte) traumatische Erinnerungen an die eigene Kindheit wachrütteln.26
Hui, dieses ganze Wissen über die Bedeutung der Bindung und ihre Konsequenzen ist für uns Therapeutinnen im, wie man so schön sagt, gebärfähigen Alter Fluch und Segen zugleich. Jede Mutter will natürlich nur das Beste für ihr Kind, aber der fachliche Background hilft uns in diesem Fall, wie ich finde, nicht wirklich weiter. Im Gegenteil: Vielleicht wird durch dieses Wissen alles nur noch verkopfter, komplizierter und krampfiger. Eine befreundete Kollegin, die gerade ihr erstes Kind erwartet, hat mich in diesem Zusammenhang schon augenzwinkernd vorgewarnt: »Schaut uns dann bloß nicht mit diesem analysierenden Fachblick an, sonst lade ich euch nicht mehr ein, bis das Kleine aus dem Gröbsten raus ist.«