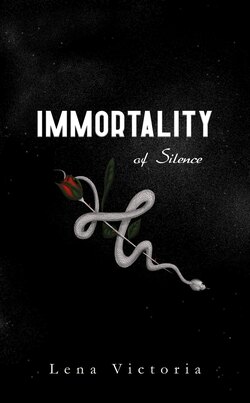Читать книгу Immortality of Silence - Lena Victoria - Страница 5
ОглавлениеKAPITEL 1 – DER STURM VOR DER
RUHE
Es war der zweite Februar 2016. Dieser Tag war das Ende von allem, aber gleichzeitig auch der Anfang von so vielem. Ich hatte nicht daran geglaubt, dass es noch ein Leben nach diesem Tag geben könnte. Es schien wie das Ende, obwohl ich noch immer Kohlenstoffdioxid an meine Umwelt abgab. Es war mir nicht bewusst, dass das Leben solange weitergeht bis ich nicht mehr darüber nachdenken konnte, ob es so wäre.
Es ist schwer jemandem meinen Schmerz zu erklären, der ihn noch nicht selbst empfunden hat. Falls du es doch zu verstehen versuchen willst musst du an die Person denken, die dir am allermeisten bedeutet auf dieser großen weiten Welt – an all eure gemeinsamen Erinnerungen und an all die schönen Momente, die dich zum Lächeln gebracht haben. Plötzlich verwandeln sich all diese positiven Erinnerungen in eine unerträgliche Last, die sich an deinen Rücken kettet – unmöglich loszuwerden, doch untragbar. Kein weiterer Schritt scheint mehr möglich. Es bleibt dir keine andere Möglichkeit als auf der Stelle zusammenzusacken, zu beobachten, wie die Schwere der Last dich in den Boden versinken lässt und an jedem weiteren Tag, an dem du nach oben zu deinem letzten Schlupfloch blickst, scheint der Ausweg immer weiter weg am Horizont zu verschwinden. Irgendwann wird das Loch so tief, dass es verrückt erscheint, überhaupt noch an Hoffnung zu glauben.
Normalerweise würde diese eine Person doch da oben stehen und ihre Hand nach dir ausstrecken. Doch diesmal nicht, denn dieser Mensch ist für immer verschwunden.
Am zweiten Februar 2016 hat mein großer Bruder Noah Selbstmord begangen. Er ist erst zwanzig Jahre alt gewesen. Ich weiß bis heute nicht wieso und diese Frage wird mich auch für immer quälen. Hätte mir damals jemand erklärt, dass es auch ohne meinen Bruder möglich wäre, zurück an die Oberfläche zu klettern, hätte ich es bestimmt nicht geglaubt, denn zu dieser Zeit fühlte ich mich genauso leer wie er. Doch eines Tages habe ich verstanden, dass man sich manchmal selbst die Hand reichen muss, anstatt auf jemand anderen zu warten. Es war ein harter Weg, der an manchen Tagen unendlich erschien, doch es war all die Anstrengungen wert.
Die Zeit ohne meinen Bruder war für meine Eltern mindestens genauso unerträglich wie für mich. Von einer Sekunde auf die andere hatte sich unser Leben komplett verändert – ohne eine Verabschiedung oder eine Erklärung. Mein Vater Jean, der der stolze Besitzer einer Bar namens ›Lorain’s‹ in unserer Heimatstadt Oregon ist, begann noch mehr zu trinken als er es ohnehin schon tat. Meine Mutter Mary versuchte sich mit pausenloser Arbeit von ihrer Trauer abzulenken. Sie war oft von morgens bis spät abends im Büro und schrieb Artikel für eine bekannte Zeitung, bei der sie schon einige Jahre beschäftigt war. Früher – als unsere Familie noch nicht zerbrochen war – hatten mein Bruder und ich ihre Berichte täglich gemeinsam gelesen. Ich habe mich schon immer für das Schreiben interessiert und daher nach der Schule begonnen Publizistik zu studieren, da ich den Traum hatte, später denselben Beruf auszuüben wie sie. Bis ich sie eines Tages kaum mehr zu Gesicht bekam und aufgehört hatte, überhaupt noch daran zu glauben, dass es eine Zukunft für mich geben würde. Trotzdem habe ich das Schreiben nie aufgegeben. Allerdings waren meine Werke nicht mehr für die Öffentlichkeit bestimmt – sondern nur noch für meine Augen. Das Schreiben half mir mit meinen Ängsten klarzukommen, wenn diese wieder einmal lauter wurden als mein eigener Verstand.
Schlussendlich wurden Gespräche mit meiner Mutter seltener als ein Lächeln auf ihrem Gesicht und Konversationen mit meinen Büchern wurden vielversprechender als Wortfetzen mit meinem Vater auszutauschen, der sich in einem permanenten Rauschzustand befand. Ich hatte auch nicht viele Freunde, und unter den wenigen gab es leider niemanden, dem ich wirklich nahestand. Übrig blieben also nur ein Block, ein Stift und meine Gedanken – ich führte zu dieser Zeit wahrscheinlich mehr Selbstgespräche in meinem Kopf als ich mit realen Menschen kommunizierte. Irgendwann begann auch mein Bedürfnis nach menschlicher Nähe zu verblassen und ich hatte Gefallen an meiner Einsamkeit gefunden. Die Isolation schien ein guter Ort zu sein, um meine Trauer und Ängste wegzusperren und die Illusion zu hinterlassen, dass ich Kontrolle darüber hatte. Während es mit meinen Freundschaften immer weiter bergab ging, litten auch meine Noten unter meinem Desinteresse gegenüber meiner Zukunft. Ich saß noch immer in meinem selbstgegrabenen kleinen Loch, und trotz all den Menschengruppen, die an der Oberfläche versammelt waren und mit verwunderten Blicken zu mir herabschauten, blieb all die Zeit immer eine riesige Kluft zwischen mir und der Außenwelt. In der Uni wechselte ich, wenn es unbedingt nötig war, immer wieder ein paar Worte mit Bekannten, doch damit war mein damaliges gesellschaftliches Leben bereits zusammengefasst – es war praktisch nicht vorhanden. Meine nachdenkliche Ader wurde zu dieser Zeit immer mehr zu meinem Verhängnis. Die Grübeleien führten dazu, dass sich all meine vermeintlichen Fehler in meine Gedanken einschlichen und sich dort wie Blutegel festsetzten, um den Rest meines erbärmlichen Daseins aus mir herauszusaugen. Die schlechten Erinnerungen drehten sich wie ein Kreisel, der sich von meiner Schädeldecke bis tief in mein Gehirn bohrte, und dabei all die schönen Gedanken vernichtete. Was am Schluss blieb war die Frage, ob ich je wieder zurück an das Licht gelangen würde, und falls nicht – hätte das alles überhaupt noch einen Sinn?
Nachdem auch mein Unileben kein Zuckerschlecken mehr war, hatte ich weder Lust noch Motivation überhaupt dort aufzutauchen. Es sammelten sich immer mehr Fehltage und negative Zukunftsprophezeiungen meiner Professoren an, die mich allerdings nicht sonderlich berührten. Ausdruckslos nickend lies ich mich von ihren Predigten berieseln, während ich über die süße Stille der grenzenlosen Einsamkeit der Endlichkeit grübelte.
Schließlich wurden meine Eltern von meinen Professoren dazu gedrängt, mir wieder Aufmerksamkeit zu schenken. So verwandelte sich neben der Uni auch noch mein Zuhause zu einem Ort, gefüllt mit enttäuschten Gesichtsausdrücken und vorwurfsvollen Gesprächen. Jedoch wiesen die Sätze meines Vaters während seines andauernden Rauschzustandes sowieso keinen Zusammenhang auf, da er nicht mehr in der Lage war, einen sinnvollen Gedankengang zustande zu bringen. Irgendwann blieb sein miserabler Zustand sogar meiner Mutter nicht mehr verborgen und so wurden die Vorwürfe an mich von einem Streit zwischen meinen Eltern abgelöst, der unendlich zu sein schien. Aussichtlos. »Wenn du so weitermachst wird nie etwas aus dir werden und dein Studium wirst du sowieso nicht schaffen.«, wirbelten die Worte meiner damaligen Professorin in meinem Kopf herum. Damals hatte ich auch nicht vor, ihr zu widersprechen – nicht einmal in meinem Gedanken – schließlich hatte ich gar keine Ziele mehr. All das Lernen schien wie eine unnötige Zeitverschwendung auf einem unendlich langen Weg, der nirgendwo hinführte.
Wir lernen für Prüfungen und erarbeiten Projekte, die benotet und daraufhin wieder verworfen werden. Kaum jemand wird die Ergebnisse je wieder betrachten oder ihnen Relevanz verleihen. Danach wird die Intelligenz des Students Nummer 24 in eine Skala eingeordnet und jeder Person ein Werte-Stempel verpasst.
Wir leben in einer Welt, in welcher der Wert eines Menschen der Höhe seines Bankkontos gleichgestellt wird – ist das nicht merkwürdig?
All die jahrelange harte Arbeit für etwas, das von Beginn an für deine Zukunft vorgeplant ist, bis du schließlich merkst, dass all dieser Schmerz – verhüllt durch stolze Anerkennung der Gesellschaft – dir langsam aber sicher die Haut unter deinen schön gebügelten Markenklamotten abbrennt. Das einzige, womit du zurückbleibst, sind eine Menge Dinge, die du nicht brauchst – und deine Hautfetzen neben dir.
Jedoch hatte meine Professorin mit ihrer Behauptung schlussendlich doch noch recht bekommen – ich hatte mein Publizistik-Studium nach einem Jahr abgebrochen, da ich es dort schließlich nicht mehr ausgehalten habe. Als mein Bruder verschwand hatte er all meine Lebenskraft mit sich genommen. All die abwertenden Blicke prallten an meiner Haut ab. Es interessierte mich nicht mehr. Die Hoffnung, meine verlorengegangene Lebensfreude wiederzuerlangen, war das einzige, was für mich noch Bedeutung hatte. Ich konnte nicht an demselben Ort heilen, an dem ich erkrankt war.
Nachdem ich die Universität nicht mehr besuchte brauchte ich natürlich eine andere Beschäftigung in meinem Leben, die all meiner neu gewonnenen Zeit einen Sinn verleihen sollte. Also begann ich in der Bar meines Vaters auszuhelfen. Der Job hatte sowohl negative als auch positive Seiten. Die permanente Anwesenheit betrunkener Menschen führte dazu, dass ich lange Zeit kein Glas Alkohol mehr anrühren wollte. Nicht selten konnte ich mir schlechte Anmachsprüche anhören – während ich die immerzu freundliche Kellnerin spielen musste. Ab und zu konnte ich auch Kotze aufwischen oder niveaulose Gespräche unfreiwillig mithören. Doch trotz all dieser negativen Aspekte ging es mir um einiges besser als in den letzten düsteren Monaten zuvor – dem Tiefpunkt meines Lebens. Ich verdiente etwas Geld, wurde selbstständiger und konnte mich auf mein kreatives Schreiben konzentrieren, ohne pausenlos von allen Seiten Vorwürfe an den Kopf geworfen zu bekommen.
Durch meinen Job lernte ich einige ›Alkohol-Sympathisanten‹ kennen, die diese unterschätzte Droge benötigten, um sich durch den Tag zu retten. Menschen die sich ähnlich fühlten, wie ich es damals tat. Anfangs empfand ich den Anblick dieser betrunkenen Gäste als widerwärtig, doch ich habe versucht, mich von jeglichen Vorurteilen frei zu machen, da mir nicht bekannt war, welche Tragödie diese Alkoholsucht ausgelöst hatte. Ist es wirklich notwendig, Negatives zu erleben, um sich von engstirnigen Denkweisen zu lösen?
Allerdings fand ich unter diesen dem Alkohol verfallenen Personen leider auch immer wieder unerträgliche Widerlinge, denen ich versuchte, aus dem Weg zu gehen. Ab und zu entpuppten sich einige dieser oftmals dubiosen Erscheinungen aber auch als sehr interessante Persönlichkeiten mit fesselnden Geschichten. Vor ein paar Monaten lernte ich Robert Barin kennen. Ein 31 Jahre alter Mann mit dunkelbraunem Haar und Bart, den er nicht mehr zu stutzen beschlossen hatte. Robert hatte bereits an seinem vierten Bier geschlürft als er begann, mir seine Geschichte zu erzählen – von seinem reichen gewalttätigen Vater, dessen Firma er übernehmen sollte. Er hatte all diese für ihn bereits vorgefertigten luxuriösen Pläne über Bord geworfen, um in einem Van, in der Nähe des Strandes, ein freies unspektakuläres Leben als Autor zu führen. »Am Ende ist der reichste Mensch nicht derjenige, der das meiste Geld oder den größten Erfolg hat – es ist der Mensch, der die längste Zeit seines Lebens glücklich gewesen ist.«, hatte Robert mir seine Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben. Er hat mich inspiriert.
Nach einiger Zeit schienen meine Eltern schließlich auch endlich einzusehen, dass ihr Verhalten nicht vorteilhaft gewesen war – weder für mich, noch für sie selbst. Eines Tages bat mich mein Vater während meiner Arbeitsstunden in unserer Bar – überraschend nüchtern – um ein Gespräch. Ein paar Minuten später standen wir uns wortlos im Abstellraum gegenüber, während ich hoffnungsvoll auf einen normalen Dialog wartete – so wie früher. Ich weiß noch, dass er einige Zeit brauchte, um die richtigen Worte zu finden. Dann sah er mir mit einem schuldbewussten Blick in die Augen und begann zu sprechen: »Kamilla, ich weiß, dass ich das letzte Jahr nicht so für dich da war, wie ich es hätte sein sollen. Als unser Sohn – dein Bruder – als er.« Er stockte und hatte beschlossen, den Satz nicht mehr zu beenden. »Deine Mutter und ich hatten ein sehr langes Gespräch über die jetzige Situation. Wir haben uns lange nicht mehr so intensiv unterhalten wie an diesem Abend und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Wir wissen, dass wir als Eltern die letzten Monate komplett versagt haben. Ich weiß, dass du keine einfache Zeit hattest und wir nicht für dich da waren, doch wir wollen es wieder gut machen. Ich werde damit beginnen, indem ich versuche, meinen Alkoholkonsum einzuschränken. Ich weiß, dass das was ich tue nicht mehr gesund ist, aber ich bemühe mich, es wieder in den Griff zu bekommen – und du sollst wissen, dass der Grund für diese Entscheidung allein du und deine Mutter sind. Ich liebe euch beide sehr, und ich weiß, dass eine schöne Zukunft vor dir liegen wird – egal ob du dein Studium nun abgeschlossen hast oder nicht. Du findest einen Weg und das weiß ich, weil ich dich kenne – du findest immer einen Weg. Bitte gib mir und deiner Mutter noch eine Chance, es wieder besser zu machen.« Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie verblüfft ich war. Die Unterstützung meiner Eltern hatte ich nicht mehr erwartet und plötzlich stand mein Vater nüchtern vor mir. Er wartete auf eine Antwort, während ich überlegte, ob ich all seinen Worten überhaupt Vertrauen schenken konnte. Was würde passieren, wenn ich mich an diesem Hoffnungsschimmer festklammern würde, doch nach all seinen schönen Versprechen schlussendlich doch keine Taten folgen würden? Nach kurzem Zögern fiel ich ihm in die Arme und drückte ihn fest. In diesem Moment konnte ich meinen Vater wiedererkennen – so wie er früher war – vor der Familientragödie. Also blieb mir schließlich nichts anderes übrig als darauf zu hoffen, dass ich mich auf seine Worte verlassen konnte. Als ich meinen Vater wieder losließ, konnte ich eine kleine Träne erkennen, die über seine Wange lief. »Danke, dass du mir noch eine Chance gibst.«, redete er weiter. An diesem Tag hatte ich etwas wiedergefunden, wonach ich mich schon so lange Zeit sehnte – Hoffnung, dass es für mich doch noch eine Zukunft geben würde.
Ich realisierte, dass ich mehr war als nur die Schwester eines verlorengegangen tragischen Schicksals. Ich war immer noch da und habe das Leben, wenn auch leider erst recht spät, wieder zu schätzen begonnen. Obwohl das Licht an der Oberfläche immer kleiner zu werden schien, habe ich nie aufgehört, nach oben zu blicken – bis der Lichtspalt Schließlich fast verblasst war, und die Angst meine letzte Hoffnung zu verlieren endlich größer wurde als mein Wunsch nach Kontrolle. Ich begann zu klettern – mit einer Last, die mir all die Zeit zu schwer erschien, um nur damit geradeaus zu gehen.
Ich denke, dass ich bereits genug Seiten mit Selbstmitleid gefüllt habe, also beende ich dieses Thema vorerst und erzähle etwas mehr über mich. Mein Name ist Kamilla Lorain und ich bin neunzehn Jahre alt. Ich habe langes braunes glattes Haar und haselnussbraune große Augen. Meine Haut ist blass und ich bin eher klein und zierlich – ein dem Klischee entsprechendes gut gelungenes Abbild eines schwachen und unsicheren Mädchens. Doch ich frage mich, warum sich Menschen überhaupt gegenseitig in Schubladen einordnen, ohne zu versuchen, sich zu verstehen. So wird der Schmerz unserer Schubladen-Gesellschaft weitergetragen, um mit der eigenen Unsicherheit klarzukommen – doch wohin soll die Trauer der letzten Schublade fließen? Würde es auf Dauer nicht weniger Schmerz verursachen, unsere Unsicherheiten offen preiszugeben und die gesellschaftlichen Mauern niederzureißen? War mein Bruder in dieser letzten Schublade angekommen?
Ich tendiere dazu mein Leben mehr zu träumen als es in der Wirklichkeit zu leben. Oft habe ich gar kein Interesse daran, ein Teil dieser realen Welt zu sein. Ich flüchte lieber in meine eigenen Fantasiewelten. Ich sitze im Zug, schaue aus dem Fenster und stelle mir vor, dass ich auf dem Weg in eine magische Welt bin, in der ich all meinen Problemen einfach entfliehen kann. Wäre es nicht schön, wenn es einen Zug gäbe, der dich von all deinen Ängsten befreit und dir eine zweite Chance ermöglicht? Vielleicht gibt es sogar so einen Zug – womöglich in einer ganz anderen Form – vielleicht war dieses Etwas sogar schon immer da, ohne dass du es bemerkt hast. Das einzige, was du tun musst ist dir selbst zu erlauben, dein Glück anzunehmen, wenn es da ist.
Falls du mir noch eine Chance gibst, schaffe ich es vielleicht noch, deinen ersten Eindruck von mir – dem traurigen Mädchen, dessen Bruder Selbstmord begangen hat – in etwas Schöneres zu verwandeln. Ich bin nämlich mehr als das – manchmal vergessen die Menschen das – manchmal vergesse ich es sogar selbst. Doch in dieser Geschichte soll es nicht um meinen Bruder gehen. Es soll auch nicht um mich gehen. Es soll um eine Person gehen, die mir dabei geholfen hat, aus meinem dunklen Loch zu klettern – und vielleicht ist es genau das, was auch du gerade in deinem Leben brauchst?