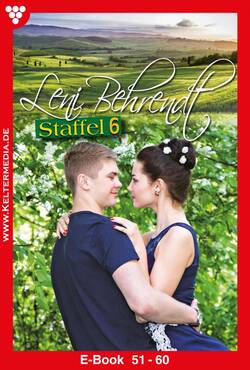Читать книгу Leni Behrendt Staffel 6 – Liebesroman - Leni Behrendt - Страница 5
ОглавлениеGemächlich tickte die Standuhr in die Stille des Gemachs, in dem das Ehepaar saß, so recht zufrieden mit seinem Geschick. Und dazu hatten sie auch allen Grund. Denn sie hatten alles, was ein Mensch sich wünschen kann. Ein sorgenloses Leben, ein behagliches Heim, zwei wohlgeratene Kinder und einen Schwiegersohn, der ihnen zusagte. Er war Arzt mit einer gutgehenden Praxis und konnte seine junge Frau nach der Hochzeitsreise in ein hübsches Haus führen, das komplett eingerichtet war. Und da der Rechtsanwalt und Notar Doktor Rudolf Danz seiner Tochter noch eine gute Mitgift geben konnte, war es ein festes Fundament, auf dem die Ehe gegründet wurde.
??Gestern hatte man die Hochzeit groß gefeiert im ersten Hotel der Stadt, und nach dem Festessen hatte das junge Paar sich heimlich entfernt, um sich auf die Hochzeitsreise zu begeben.
??Nun saßen die Eltern der jungen Frau beisammen und sprachen von dem Fest, auf dem alle so froh und leichtbeschwingt gewesen waren. Ihr Sohn, ein Bursche von sechzehn Jahren, hatte nach der ausgedehnten Feier noch nicht aus dem Bett finden können, und auch seine junge Base schlief noch in seliger Ruh.
Danz hatte das Bruderkind vor einer Woche aus dem Töchterheim geholt, wohin der Vater seine Tochter gegeben, nachdem seine Frau durch Leichtsinn ums Leben gekommen war, denn Leichtsinn war es, stark erhitzt vom hohen Sprungbrett kopfüber ins eiskalte Wasser zu springen. Dabei machte das durch Sport überanstrengte Herz nicht mehr mit, es tat seinen letzten Schlag.
Gleichgültig war das dem Gatten natürlich nicht, schnitt aber auch nicht ins Lebensmark. Auch die vierzehnjährige Tochter traf der Tod der Mutter nicht sehr, da die fanatische Sportlerin sich wenig um ihr einziges Kind gekümmert hatte. Der Vater befand sich viel auf Forschungsreisen, also blieb die Kleine bezahlten Kräften überlassen, die gewiß nicht liebevoll mit ihr umgingen. Da hatte sie es im Töchterheim schon besser, weil sie mit jungen Mädchen zusammenkam, während sie im Elternhaus einsam gewesen war.
Vor einem halben Jahr war nun auch der Vater durch ein bösartiges Fieber ums Leben gekommen, das er sich in den Tropen zugezogen hatte. In seinem Testament hatte er zum Vormund der Tochter seinen Bruder, den Notar Doktor Rudolf Danz, bestimmt. Ferner hatte er bestimmt, daß seine Tochter bis nach Absolvierung des Abiturs in dem Heim blieb, das dafür bekannt war, seinen Zöglingen eine tadellose Erziehung und vielseitige Ausbildung zu geben. Danach sollte der Vormund sein Mündel väterlich betreuen.
Was er denn auch tat, indem er sein Mündel nach Bestehen des Abiturs in sein Haus holte. Sie war ein entzückendes Menschenkind, die neunzehnjährige Ortrun Danz, dazu noch eine reiche Erbin. Was Wunder, wenn die Mitgiftjäger mobil wurden.
Der gefährlichste unter ihnen war der Baumeister Zerkel. Ein routinierter Schwerenöter, der sich gestern auffallend um Ortrun bemüht hatte. Darüber sprach soeben Frau Danz, was dem Gatten gewissermaßen die Galle hochgehen ließ.
»Ich wäre diesem aalglatten Laffen am liebsten an den Kragen gegangen«, brummte er verdrossen. »Das könnte ihm so passen, mit dem Geld Ortruns sein Geschäft zu sanieren, das über und über verschuldet ist. Wahrscheinlich nimmt er an, daß Ortrun bei der Heirat für mündig erklärt wird und somit über ihren Reichtum verfügen kann.«
»Und ist dem nicht so?«
»Nein. In dem Testament ist die gesetzliche Volljährigkeit ausdrücklich betont. Erst dann darf Ortrun über das Geld frei verfügen, was immerhin länger als ein Jahr dauert. Und so lange kann der Mann nicht warten, sonst geht er pleite.«
»Nun, dann ist ja keine Gefahr.«
»Meinst du, aber ich sehe da weiter. Nämlich, daß dieses junge, unerfahrene Kind, das so lange wohlbehütet im Töchterheim lebte, sich von dem schmeichlerischen Blender gestern das Köpfchen verdrehen ließ. Und damit Ortrun schleunigst aus der Nähe dieses gefährlichen Mitgiftjägers kommt, wirst du mit ihr auf Reisen gehen.«
»Aber bester Mann, wie denkst du dir das eigentlich. Ich kann doch unmöglich dich und den Jungen, überhaupt die ganze Wirtschaft im Stich lassen und auf unabsehbare Zeit in der Weltgeschichte herumgondeln. Ich habe euch viel zu sehr verwöhnt, als daß ihr ohne mich fertig werden könntet. Vielleicht kann man Ortrun bei Bekannten unterbringen.«
Und siehe da, schon trat diese Bekannte ein. Fräulein Frauke Gortz, dreiundzwanzigjährig, sehr hübsch und als guter, anständiger Mensch bekannt. Sie war nach dem Tode ihres Vaters, eines höheren Beamten, zu dessen Schwester gezogen, wo sie als besseres Dienstmädchen schuften mußte, zwei Jahre lang. Dann jedoch hatte das Schicksal mit der geplagten Frauke ein Einsehen und bescherte dieser eine Erbschaft, mit der sie nie gerechnet hatte. Zuerst hielt sie es für einen Witz, was ihr der seriöse Anwalt Danz da vorlas. Nämlich, daß ein Vetter ihres Vaters ihr nicht nur sein Haus nebst acht Morgen Land und zehntausend Mark, sondern auch noch eine monatliche Rente von vierhundert Mark vermacht hatte. Kein Wunder, daß die von den Verwandten geduckte Frauke soviel Glück zuerst nicht fassen konnte. Doch als sie endlich begriffen hatte, brach eine rührende Freude durch. Lachend und weinend zugleich fiel sie dem Notar um den Hals und dankte ihm, als wäre er der Geber all der Herrlichkeit.
Und nun trat sie ein, lachend über das ganze Gesicht.
»Hallo, Fräulein Frauke, Sie strahlen ja wie ein ganzer Weihnachtsbaum«, empfing der Hausherr sie schmunzelnd. »Und dabei müßten Sie doch ganz klein und häßlich sein.«
»Nanu, was hab ich denn verbrochen?«
»Sie sind nicht zur Hochzeitsfeier erschienen.«
»Um mich deshalb zu entschuldigen bin ich hier«, nahm sie dankend den ihr gebotenen Platz ein. »Ich mochte mit den Verwandten nicht mehr zusammentreffen, mit denen ich vorgestern eine ekelhafte Auseinandersetzung hatte.«
»Und wann soll die Reise losgehen?«
»Morgen, Herr Doktor.«
»Gleich mit Sack und Pack?«
»Ja.«
»Wäre es nicht ratsam, sich zuerst einmal den ererbten Besitz anzusehen?«
»Nein«, kam es mit Entschiedenheit zurück. »In welch einem Zustand sich auch das Anwesen befinden mag, ich werde auf jeden Fall meinen Wohnsitz dort nehmen.«
»Haben Sie denn nie daran gedacht, sich in fremdem Hause einen Posten zu verschaffen?« fragte Frau Danz. »Da hätten Sie bestimmt bei viel weniger Arbeit noch ein gutes Gehalt bezogen.«
»Und wie ich daran dachte. Habe mich immer wieder um Posten beworben, die meinen Kenntnissen entsprachen. Aber nirgends wollte man Hulda mit übernehmen, was für mich ausschlaggebend war. Denn das hat die treue Seele wahrlich nicht verdient, von einem Menschen im Stich gelassen zu werden, dem und dessen Familie sie zwei Jahrzehnte aufopfernd diente. Also blieb ich ihretwegen immer weiter bei den Verwandten.«
»So was nennt man Treue«, betrachtete Danz wohlgefällig das junge Mädchen, das da so hübsch und adrett vor ihm saß. Mittelgroß und schlank mit rundlichem Gesicht, in dessen Wangen beim Lachen zwei allerliebste Grübchen spielten. Die graugrün schillernden Augen waren von dichten dunklen Wimpern umsäumt. Das kastanienbraune Haar war gepflegt, wie überhaupt das ganze Mädchen, das etwas ungemein Klares, Sauberes ausstrahlte.
»Wissen Sie übrigens, Herr Doktor, daß der junge Zerkel scharf hinter Ihrer Nichte her ist?«
»Und wie ich das weiß«, nickte er grimmig. »Er benahm sich ja auffällig genug bei der Umgarnung des Goldfischchens. Ich machte schon meiner Frau den Vorschlag, mit der Kleinen so lange auf Reisen zu gehen, bis im Netz des üblen Fischers ein anderes Goldfischchen zappelt. Aber unser liebes Muttchen will ihren Pflichtenkreis nicht verlassen, was ja zu verstehen ist. Wohl könnte ich ohne weiteres für mein Mündel eine Reisedame verpflichten, aber weiß man, in wessen Hände es da käme? Und Verwandte oder gute Bekannte haben wir nicht, wo man die Kleine unterbringen könnte. Ich muß schon sagen, daß ich da ziemlich ratlos bin.«
»Geben Sie mir das Mädchen mit«, entschied Frauke spontan. »Bei mir wäre es bestimmt in guter Hut.«
»Ist das Ihr Ernst, Fräulein Frauke?«
»Na was denn sonst?« fragte sie erstaunt zurück. »Ihre Nichte tut mir leid, deshalb möchte ich sie schützen, gemeinsam mit Hulda, die ein guter Zerberus ist. Laß die Mitgiftjäger nur kommen. Ein Eimer kaltes Wasser übern Kopf gestülpt ist ihnen sicher«, schloß sie lachend, und amüsiert fiel das Ehepaar ein.
»Das traue ich Ihrer Hulda ohne weiteres zu«, sagte der Anwalt. »Also es gilt, Fräulein Frauke?«
»Es gilt, Herr Doktor. Fragt sich nur, ob Ihre Nichte damit einverstanden ist, was über ihren Kopf hinweg bestimmt wird.«
»Daran ist sie vom Töchterheim her gewöhnt. Da hatte sie nichts zu wollen, sondern widerspruchslos zu gehorchen. Also wird sie’s auch jetzt tun.«
Womit er recht hatte. Denn als die Nichte gleich darauf erschien und der Onkel ihr den Vorschlag unterbreitete, sah sie mit ihren leuchtendblauen Augen Frauke eingehend an, die lächelnd dem inquisitorischen Blick standhielt. Dann sagte das Mädchen mit einer Ernsthaftigkeit, die zu einer Neunzehnjährigen gar nicht passen wollte:
»Wenn du es für richtig hältst, Onkel Rudolf, dann gehe ich selbstverständlich mit Fräulein Gortz.«
»Auch gern, Ortrun?«
»Sehr gern. Schon deshalb, weil ich auf dem Lande leben möchte. In dieser großen Stadt ist es mir zu unruhig, zu laut, zu turbulent. Ich glaube kaum, daß ich mich hier wohl fühlen könnte«, bekannte sie freimütig, setzte dann jedoch verlegen werdend hinzu: »Das betrifft natürlich nur die Stadt, Onkel Rudolf, nicht dein Haus. Ich habe mich nur ungeschickt ausgedrückt, nicht wahr?«
»Nein, mein Kind«, beruhigte er sie, die ihn ängstlich ansah. »Ich weiß schon, wie du es meinst und kann es gut verstehen. Der Kontrast zwischen dem abgelegenen Töchterheim und der lärmenden Stadt ist eben zu groß. Daher ist es gut für dich, wenn du als Zwischenstation in ein Dorf kommst. Vorläufig jedenfalls, später sehen wir dann weiter.«
»Und jetzt laß das Kind erst einmal frühstücken«, schaltete sich die resolute Gattin ein. »Komm, mein Herzchen, lassen wir uns etwas servieren!«
Als sie gegangen waren, lachte Frauke kurz auf.
»Das könnte dem Zerkel so passen, sich dieses bezaubernde Menschenkind einzufangen samt seinem Geld.«
»Hm. Wir müssen noch die finanzielle Seite erörtern. Ich zahle Ihnen monatlich die gleiche Summe wie dem Internat.«
»Herr Doktor, Sie sind wohl nicht recht gescheit! So ein Institut – welches ist es überhaupt?«
»Das Elitetöchterheim. Ist Ihnen das ein Begriff?«
»Nein. Aber es hört sich schon so exquisit an.«
»Es ist das vornehmste in seiner Art.«
»Aha! Dementsprechend wird wohl auch die Bezahlung sein. Im übrigen sollten Sie nicht so vertrauensselig sein, als Jurist schon gar nicht. Wenn ich nun das viele Geld annehme und den größten Teil davon für mich verwende?«
»Dann hänge ich meinen Beruf an den Nagel«, bemerkte er trocken. »Denn ein Jurist mit einer so miserablen Menschenkenntnis soll lieber Filzschuhe wischen.«
»Dazu will ich Sie denn doch nicht degradieren«, lachte sie hell auf. »Da will ich lieber großmütig sein und ehrlich bleiben.«
»Na also«, schmunzelte er. »Dann sind wir uns ja einig. Hier haben Sie meine Hand, schlagen Sie ein. Schließen wir ein Schutz- und Trutzbündnis zu Heil und Frommen des Waisenkindes Ortrun Danz.«
*
Am nächsten Tag ging dann die Reise los. Der Rechtsanwalt, der die »Auswanderer« gern zur Bahn gebracht hätte, mußte davon absehen, da ein Prozeß ihn in Anspruch nahm. So mußte er denn zu Hause von der Nichte Abschied nehmen.
Die Ermahnungen, die er ihr mit auf den Weg gab, nahm sie schweigend hin. Sie war ja vom Töchterheim an derartige Sermone gewöhnt, sie machten ihr gar nichts mehr aus.
Ruhig sah sie den Mann an, der ihr so fremd war, wie jeder andere Mensch auch. Zwar hatte er sie jedes Jahr einmal im Internat besucht. Doch die wenigen Stunden, die er bei ihr verweilte, hatten nicht genügt, um ihn ihr vertraut zu machen. Daher fiel ihr auch jetzt der Abschied von ihm nicht schwer.
Und von der Tante schon gar nicht, die ihr das Geleit zum Bahnhof gab, wo man mit Frauke Gortz zusammentraf.
»Da bist du ja«, empfing Frauke sie freudig erregt. »Wir sagen gleich du zueinander, lassen ein Fremdsein erst gar nicht zwischen uns aufkommen. Das da ist unsere liebe Hulda, die dich bestimmt verwöhnen wird. Je mehr sie nämlich zum Verwöhnen hat, um so wohler fühlt sie sich.«
Schüchtern reichte Ortrun der ihr Vorgestellten die feine Hand, die in der verarbeiteten Rechten der großen, grobknochigen Person beinahe verschwand. Alles wirkte derb an ihr. Auch das Gesicht mit dem glatten, dunklen Scheitel.
Und doch fühlte Ortrun sich zu dem alten Mädchen sofort hingezogen.
Dann kam der Augenblick, den jeder nervöse Reisende kaum erwarten kann. Die Wagentüren knallten zu, der Mann mit der roten Mütze gab das Abfahrtszeichen, und langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Taschentücher flatterten, wurden ferner und ferner, kamen schließlich ganz außer Sicht. Die Reisenden verließen den Gang und suchten die Abteile auf, wo sie vorsorglich einen Platz belegt hatten. Was nicht schwierig ist, wenn der Zug auf der Station eingesetzt wird, was hier ja der Fall war.
So hatten denn die drei »Auswanderer« fürs erste sogar ein Abteil für sich, was sie natürlich begrüßten. Den einen Fensterplatz nahm Frauke ein, auf den zweiten wurde Ortrun von Hulda geschoben, obwohl sie dagegen protestierte:
»Aber der kommt mir als Jüngsten gar nicht zu.«
»Was heißt hier zukommen?« schnitt Hulda ihr das Wort ab. »Ich mach sowieso ein Nickerchen. Da ist es mir egal, wo ich sitze. Hauptsache, daß der Stuhl bequem ist.«
Sprachs, kuschelte sich in die Türecke und war vorläufig nicht mehr zu sprechen.
»Tja, das ist unsere Hulda«, lachte Frauke. »An ihre kurzangebundene Art wirst du dich schon gewöhnen müssen. Größtenteils brummt sie, weniger schmunzelt sie, und manchmal lacht sie sogar. Aber gut meint sie es immer, hat ein treues, warmes Herz. Mach es dir nur recht bequem, wir fahren mit diesem Zug drei Stunden.«
Ortrun fragte verlegen: »Wollen Sie mich, bitte, nicht duzen? Dann fühle ich mich nicht so fremd.«
»Na schön«, brummte Hulda. »Dann aber nur auf Gegenseitigkeit. Und nun wollen wir essen, solange wir noch allein sind. Kommen erst andere hinzu, sind wir nicht mehr so ungeniert.«
Womit sie rechtbehalten sollte. Denn kaum hatte sie den Koffer ins Netz zurückgelegt, als der Zug auf einer größeren Station hielt und eine Menge Reisende hinzustiegen. Die bisher nur mäßig besetzten Abteile füllten sich.
Neben Ortrun setzte sich ein älterer Herr mit strengem Gesicht, der so den Eindruck machte, als wäre nicht gut mit ihm Kirschen essen. Neben ihm nahm eine junge Frau Platz, zu der zwei Knaben gehörten, deren Erziehung alles zu wünschen übrig ließ. Hulda, die auf der andern Seite neben Frauke saß, bekam eine Nachbarin, die wie eine vom Tod vergessene Gouvernante anmutete in ihrem vorsintflutlichen Habit.
Denn sie trug tatsächlich noch eine Hemdbluse mit steifgestärktem Kragen nebst Krawatte, einen langen Rock und ein Pincenez, wie man es vor einem halben Jahrhundert von wegen der vornehmen Note trug. Selbst von solchen, die eine Brille nicht benötigten und Fensterglas in die bügellose, oft sogar goldene Fassung setzen ließen. Und da der Volksmund ja zu allen Zeiten solche Schwächen zu glossieren pflegte, so prägte er den Ausspruch: Ohne Brill’ ist nichts zu machen, ohne Pincenez kein Sonntag.
Der Zug hielt, ein Herr betrat das Abteil, der höflich grüßte, die Mitreisenden flüchtig musterte, dann Platz nahm und sich gleich hinter einer großen Zeitung verschanzte. Somit sah man nur seine langen Beine, die in einer tadellosen Hose steckten.
Die altmodische Dame machte ein Nickerchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn immer wieder nickte sie im Schlaf, wobei der Kneifer lustig mitwippte. Es war ein so drolliges Bild, daß Frauke ihre beiden Begleiterinnen darauf aufmerksam machte.
Sie hatten keine Ahnung, daß sie von dem andern Herrn über die Zeitung weg beobachtet wurden, da sie keine Notiz von ihm nahmen. Daher entging ihnen das stillvergnügte Schmunzeln, mit dem er alles ringsum in sich aufnahm.
Als der Zug wieder einmal seine Fahrt verlangsamte, warf Frauke einen Blick auf ihre Armbanduhr.«
»Ich glaube, wir sind am Ziel«, sagte sie hastig. »Halten wir uns bereit.«
Und damit taten sie recht. Denn kaum, daß sie in ihre Mäntel geschlüpft waren und nach dem Gepäck gegriffen hatten, hielt der Zug auf der Station, wo sie ihn verlassen mußten. Der erste Teil ihrer bestimmt nicht langweiligen Reise war geschafft.
*
Auf dem Bahnsteig bat Frauke einen Beamten, ihr den Weg zur Kleinbahn zu beschreiben. Dann schlossen sie sich dem Menschenstrom an, der zur Sperre strebte, dann durch die Bahnhofshalle dem Ausgang zu. Dort blieben sie zuerst einmal stehen und sahen sich das muntere Treiben an, das allen drei neu war, weil sie noch fast gar nicht gereist waren.
Auf dem weiten Platz standen Privatautos, Taxis und Omnibusse, zu denen die Menschen eilten. Alle hurtig, alle voll Hast. Ein Gefährt nach dem andern fuhr ab, bis der Platz leer war.
»So, denn wollen wir mal«, sagte Frauke vergnügt. »Wie hat der Beamte gesagt: durch das Bahnhofsportal auf die Straße, dort rechtsum und fünf Minuten lang der Nase nach. Tun wir also.«
So zogen sie denn los, frohgemut und mit leichtem Gepäck; denn das große hatten sie aufgegeben. Führten nur im Köfferchen das mit, was unbedingt notwendig war. Schon von weitem sahen sie den Zug, der bereits unter Dampf stand. Sie waren noch nie in so einem Bähnlein gefahren und freuten sich nun darauf, wie sie sich über alles und jedes freuten, in ihrer Unverwöhntheit. Wie war doch das alles so reizvoll und interessant.
Nachdem Frauke die Fahrkarten gelöst hatte, suchte man nach einem Abteil zweiter Klasse, welches man als einziges an diesem Züglein fand und das jetzt noch unbesetzt war. Frauke und Ortrun nahmen die Fensterplätze ein, Hulda placierte sich neben erstere, also saß man genauso wie vorher im D-Zug. Später bekam Ortrun eine Nachbarin, die für ihre Behäbigkeit soviel Platz brauchte, daß sie das grazielle Persönchen in die Ecke drückte. Ihr frisches Vollmondgesicht drückte dabei so viel Wohlwollen und Güte aus, daß man ihr nicht böse sein konnte.
Die noch Zusteigenden waren alle miteinander bekannt und unterhielten sich zwanglos. Immer wieder gingen ihre Blicke verstohlen zu den drei Fremdlingen hin, in denen sie Feriengäste vermuteten, obwohl Mitte März noch keiner das idyllische Dorf aufzusuchen pflegte. Warum diese es taten, hätten sie zwar brennend gern gewußt, aber man fragte natürlich nicht. Man hatte ja schließlich Erziehung – o bitte sehr!
Mit einem grellen Pfiff setzte sich das Bähnlein prustend und schnaubend in Bewegung.
Nachdem man eine knappe Stunde gefahren war, hielt der Zug nicht vor der üblichen Wellblechbude, wie kleine Stationen sie aufwiesen, sondern vor einem roten Backsteinhäuschen, und schon hörte man von draußen die Stimme des Schaffners:
»Grünergrund – Endstation!«
Es waren nicht mehr viele Passagiere, die ausstiegen, die meisten hatten den gutbesetzten Zug schon unterwegs verlassen. Zu Fuß verließ man den kleinen Bahnhof, nur die gewichtige Dame ging auf ein Gefährt zu, in dessen Deichsel ein wohlgenährter Brauner steckte. Doch unterwegs verhielt sie den Schritt und sah zu den drei Fremdlingen hin, die unschlüssig dastanden.
»Nanu, meine Damen, werden Sie nicht abgeholt?« fragte sie verwundert. »Der Friedrich von der ›Grünen Gans‹ pflegt doch sonst pünktlich zu sein.«
»Grüne Gans?« fragte Frauke lachend. »Die muß aber noch sehr jung sein.«
»O nein«, schmunzelte die Dicke. »Sie ist im Gegenteil schon recht betagt, aber ganz nett auf komfortabel zurechtgestutzt. Die ›Grüne Gans‹ ist nämlich das hübscheste Hotel in unserm grünen Dorf. Ja, ja, meine Damen, bei uns ist alles grün. Da kann es einem niemals schwarz vor den Augen werden.«
Jetzt lachte man ein fröhliches Quartett, und dann fragte Frauke nach dem Weg zum Gemeindeamt.
»Das ist hier ganz in der Nähe«, gab die stattliche Dame Auskunft, ihre Neugierde dabei heroisch unterdrückend. »Gehen Sie die Straße rechts hinunter bis zum Marktplatz, überqueren Sie ihn und marschieren Sie direkt in das große Haus, das zur Abwechslung weiß ist. Dann sind Sie am Ziel. Kapiert?«
»Auf Anhieb. Besser hätten Sie es gar nicht erklären können, gnädige Frau.«
»Das freut mich. Also dann alles Gute, meine Damen.«
Ihnen freundlich zunickend kugelte sie ab und stieg mit einer Behendigkeit in den Wagen, die für ihre Körperfülle erstaunlich war. Der Kutscher ließ die Peitschenschnur sacht über den blanken, breiten Rücken des Braunen spielen, der sich darob gemächlich in Bewegung setzte.
»Das nennt man Gemütlichkeit«, lachte Frauke. »Ich glaube, in diesem idyllischen grünen Dorf reißt sich keiner ein Beinchen aus. Und nun auf zum Herrn Gemeindevorsteher. Wollen wir uns von ihm überraschen lassen.«
So zog man denn vergnügt von dannen und nahm entzückt das schmucke Bild in sich auf. Das ganze Dorf war blitzsauber. Zusammengebaute Häuser gab es in dieser mit Bäumen umsäumten Straße nicht, die sehr lang zu sein schien, die rechts einen Bürgersteig, links einen Fahrradweg aufwies. Zwischendurch erstreckte sich eine glatte Asphaltstraße.
Jedes Haus war von einem Garten umschlossen, den ein grüner Staketenzaun von dem Nachbargrundstück trennte. Ein schmuckes Dorf, ein gepflegtes Dorf.
Der Marktplatz war im Viereck von Gebäuden abgeschlossen. In der Mitte plätscherte ein Springbrunnen, umrandet von Blumenbeeten. Die Bürgersteige säumten alte, prächtige Lindenbäume. Zwei davon standen vor dem Gemeindeamt wie stumme Wächter.
Die Gans war tatsächlich grün, die auf ein Schild gemalt war, das über dem Eingang des schmucken Hotels lustig baumelte. Geschäft reihte sich an Geschäft; denn der große Marktplatz war Zentrum.
Der Gemeindevorsteher, ein jovialer Herr mit kräftiger Gestalt, frischem Gesicht und angegrautem Borstenkopf ging den Eintretenden zögernd entgegen.
»Guten Tag. Wenn ich nicht irre, sind Sie die von dem Notar Doktor Danz avisierten Damen?«
»Stimmt«, entgegnete Frauke liebenswürdig. »Ich bin Frauke Gortz, das ist Fräulein Hulda Selk und das Fräulein Ortrun Danz.«
Nachdem die Begrüßung erfolgt war, nahm man an einem runden Tisch Platz, und ohne Aufforderung legten die Mädchen ihre Ausweise nebst einer polizeilichen Bestätigung vor. Der Gemeindevorsteher prüfte die Papiere sorgfältig und reichte sie dann mit verbindlichem Lächeln zurück.
»Danke, meine Damen, alles in Ordnung. Hm – ja, wollen Sie denn das ererbte Haus beziehen?«
»Warum denn nicht?« gegenfragte Frauke erstaunt. »Gibt es da etwa Schwierigkeiten?«
»Nicht was die Erbschaft selbst betrifft, da geht alles klar. Nur ist das Anwesen – nun, um es beim richtigen Namen zu nennen – verwahrlost. Um es in Ordnung zu bringen, werden Sie eine Menge Geld hineinstecken müssen, mein gnädiges Fräulein.«
»Das ist vorhanden«, erklärte Frauke kurz. »Jedenfalls soviel, um die größten Schäden zu beheben. Alles andere wird nach und nach erfolgen.«
»Das freut mich«, atmete der Mann sichtlich auf. »Denn das Anwesen war immer ein Schandfleck unseres schmucken Dorfes, das jährlich immer mehr Sommergäste anzieht. Ein Glück, daß dieses – na ja – nicht im Mittelpunkt, sondern an der Grenze liegt.«
»So daß die Dörfler es verleugnen können«, warf Frauke trocken ein, was den Mann verlegen machte. »Hat mein Onkel wenigstens ein anständiges Begräbnis gehabt?«
»Aber gewiß, gnädiges Fräulein«, beeilte er sich zu versichern. »Der Herr Professor hatte ja eigens dafür eine Summe bestimmt, die wir in einem versiegelten Umschlag auf dem Schreibtisch fanden. Ich habe alle Ausgaben gewissenhaft vermerkt und die Rechnungen beigefügt.«
Er stand auf und trat an den Geldschrank, dem er einen versiegelten Umschlag nebst einigen Schlüsseln entnahm. Mit einer Verbeugung überreichte er es Frauke, die es in die Handtasche gleiten ließ.
»Ich danke Ihnen, Herr Gemeindevorsteher, für die Mühe, die Sie mit meinem Onkel gehabt haben.«
»Aber bitte, gnädiges Fräulein, ich tat nur meine Pflicht. Wenn Sie meine Hilfe benötigen sollten, ich stehe Ihnen gern zu Diensten.«
»Danke. Welchen Weg müssen wir einschlagen, um zu dem Anwesen zu gelangen?«
»Über den Marktplatz, dann rechts ab und immer die Straße entlang bis zum letzten Haus linker Hand. Nun möchte ich die Damen in unserm grünen Dorf willkommen heißen und Ihnen alles Gute wünschen.«
»Phrasen«, sagte Frauke verächtlich, nachdem sie mit ihren Begleiterinnen das Amtszimmer verlassen hatte. »Der Mann machte so den Eindruck, als hätte er uns gern abgeschoben. Nichts da, mein Lieber, wir bleiben. Doch zuerst gehen wir in die ›Grüne Gans‹, um unseren Hunger zu stillen.«
*
Der Raum, den sie gleich darauf betraten, war niedrig und langgestreckt. Alles darin blitzte vor Sauberkeit. Sie nahmen an einem der breiten Fenster Platz, von dem aus sie den Marktplatz übersehen konnten. Und schon watschelte ein Dicker auf seine einzigen Gäste zu.
»Guten Tag, die Damen. Was ist gefällig?«
»Ein gutes und reichliches Mahl, Herr Wirt.«
»Die Damen werden zufrieden sein«, reichte er ihnen dienernd die Speisekarte hin. »Bitte zu wählen.«
Sie wählten alle drei dasselbe, das sich als reichlich und schmackhaft erwies. Kalbsschnitzel mit gemischtem Salat und als Dessert eingeweckte Kirschen. So richtig gesättigt legten sie sich in die bequemen Polsterstühle zurück, und Frauke griff zur Zigarette. Ein Laster, dem sie allerdings nur als sogenannte Sonntagsraucherin frönte. Hulda rauchte natürlich nicht und Ortrun als bisheriger Internatszögling schon gar nicht.«
»Nun laßt uns mal beraten, was wir beginnen sollen«, sprach Frauke leise, um von den gespitzten Ohren des Wirtes hinter Theke nicht gehört zu werden. »Am besten ist, wir belegen hier Zimmer. Denn in dem verwahrlosten Haus, wie es der Gemeindevorsteher so liebenswürdig betitelte, werden wir vorerst wohl nicht übernachten können. Was meint ihr zu meinem Vorschlag?«
»Für ein oder auch zwei Nächte ist er annehmbar«, brummte Hulda. »Aber länger nicht. Bedenke, daß so ein Hotel sündhaft teuer ist und daß wir sparen müssen. Denn nach den Andeutungen des Gemeindevorstehers zu schließen, muß deine ererbte Villa ja ein richtiges – na ja – sein, dessen Instandsetzung dein Portemonnaie auffressen wird.«
»Ganz Hulda«, lachte Frauke hell auf, was dem Wirt ein Schmunzeln entlockte. Na, die konnte vielleicht lachen! War überhaupt ein blitzsauberes Frauenzimmerchen, schien was Besseres zu sein.
Und die andere? Olala! Die war wie ein Mairöslein, so taufrisch und duftig. Augen so blau wie der Frühlingshimmel, Haare wie Sonnenstrahlen und ein Figürchen wie ein Elflein so zart und fein.
Und die dritte? Knochen wie ein Kürassierpferd und ein Gesicht wie eine bissige Dogge.
Diese Betrachtungen unterbrach ein Herr, der soeben eintrat. Wie Jung-Siegfried anzuschaun, so groß, so sehnig und so blond. Blaue Augen blitzten in einem kantigen Gesicht. Er trug eine Reithose, Stiefel und eine grüne Joppe, die ihm vorzüglich stand. Als er die drei Gäste bemerkte, stutzte er. Das waren doch seine Mitreisenden aus dem D-Zug. Wahrscheinlich die ersten Feriengäste.
»Guten Tag, Herr Doktor«, grüßte der Wirt wohlwollend. »Ein Bierchen gefällig?«
»Jawohl. Und ein kräftiges Mittagessen dazu«, entgegnete eine tiefe, wohllautende Stimme. »Bei meiner Wirtin bekomme ich heute nichts, die sitzt beim Zahnarzt.«
»Um sich den Speilzahn ziehen zu lassen?«
»Werden Sie hier nicht boshaft«, lachte der Gast, indem er Platz nahm. Der Wirt jedoch kugelte ab. Bestellte durch ein Klappfenster das Essen, füllte ein Seidel mit Bier, das er vor den Herrn stellte. Gern hätte er noch mit ihm ein Schwätzchen gemacht, doch dazu ließen ihm die Mittagsgäste keine Zeit, die rasch hintereinander eintraten. Frauke gelang gerade noch, für die Nacht Zimmer zu bestellen, dann tauchte der Wirt zwischen den Tischen unter, und die drei weiblichen Gäste entfleuchten.
»Puh!« Frauke blies draußen die Backen auf. »Es war das reinste Spießrutenlaufen durch das besetzte Lokal. Und alles Mannsleut. So viele auf einem Haufen hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Und nun kommt, damit wir den Schandfleck des grünen Dorfes in Augenschein nehmen.«
Hurtig schritten sie fürbaß. Die Köfferchen hatten sie mitgenommen, weil sich darin auch Schürzen befanden, die Hulda vorsorglich eingepackt hatte. Und wie notwendig die waren, sollte sich bald herausstellen.
Nachdem sie eine Strecke zurückgelegt hatten, bog die Straße in scharfer Kurve links ab und ein Schloß wurde sichtbar, das sich wie ein Wahrzeichen auf einer Anhöhe erhob, auf der saftiges Weidegras wuchs, das weithin leuchtete in seinem jungen Grün. Auf ebenem Grund jedoch standen Bäume so dicht, daß es von weitem aussah, als wären ihre Kronen zusammengewachsen.
»Wenn das da man nicht der Park ist, der unsere Villa umschließt«, brummte Hulda ahnungsvoll, und Frauke nickte bang.
»Scheint mir auch so. Na, machen wir uns auf alles gefaßt. Ärger als arg wird’s schon nicht werden.«
Und dann standen sie vor einem Anwesen, das man nicht nur mit verwahrlost sondern auch mit düster bezeichnen konnte. Hinter dem wackligen Zaun wucherten Bäume, durch die man sich schlängeln mußte, um zum Wohnhaus zu gelangen, das grau und böse dastand.
Wie drohend blickten die verschmutzten, gardinenlosen Fenster, deren Rahmen kaum noch Farbe aufwiesen. Schief hingen die Laden in den Angeln. Ein unheimliches Haus, an dem nur die feste Tür in Ordnung war, deren gutgeöltes Schloß sofort nachgab, als Frauke den großen Schlüssel herumdrehte.
Als sie den Vorraum betraten, schlug es ihnen wie Grabesluft entgegen, so kalt und feucht. Laut hallten ihre Schritte auf dem Steinboden wider.
»Scheußlich!« schauerte Frauke zusammen. »Wie in einer Gruft. Hast du Angst, Ortrun?«
»Warum denn, Frauke?« fragte sie verwundert zurück, und Hulda brummte:
»Vor dem Dreck natürlich. Der klebt an den Scheiben so dick, daß kein Sonnenstrahl durchbrechen kann. Und die Möbel erst. Die erkennt man vor Staub kaum. Sind die Flügeltüren nun schwarz oder weiß?«
»Das werden wir feststellen, wenn du sie mit Bürste und Seife geschrubbt hast«, lachte Frauke, obwohl ihr zum Lachen nicht zumute war. »Fassen wir uns ein Herz und gehen wir weiter.«
Langsam durchschritten sie die drei Räume, die alle möbliert, aber wahrscheinlich schon lange nicht mehr benutzt worden waren. Gut, daß die Polster Schonbezüge trugen und es stark nach Mottenpulver roch. Sonst hätten die Schädlinge gute Beute gehabt.
Nur ein Raum sah wohnlich aus. Und zwar die Bibliothek, wo der Professor sich wahrscheinlich ständig aufgehalten hatte. Auch die Küche war verhältnismäßig sauber, gleichfalls waren es Speise- und Vorratskammer. Von der Küche führte eine Tür hinaus auf einen krautverwachsenen Hof. Am Ende stand ein Stallgebäude, daneben ein Schuppen. Rechts lag Brachland, das erstmals wohl ein Gemüsegarten gewesen war.
»Na also«, brummte Hulda zufrieden. »Ist ja alles da. Hab es mir auf den ersten Blick noch schlimmer vorgestellt. Gehen wir nach oben.
Starrt natürlich auch vor Dreck«, stellte sie sachlich fest, als man die geschnitzte Treppe zum Obergeschoß hinaufstieg. »Diese Fetzen von Läufer hätten schon längst abgerissen werden müssen. Die sind doch weiß Gott keine Zierde.«
Der Gang wies rechts Fenster, links Flügeltüren auf, die an manchen Stellen noch weiß schimmerten. Es gab auf der Etage zwei geräumige, zusammenhängende und zwei kleinere, für sich abgeschlossene Zimmer.
Im zweiten Stock befand sich ein großes Mansardenzimmer, in dem ein starker Pfeifenraucher gehaust haben mußte. Denn es roch – oder besser stank – nach schlechtem Knaster. Die Fensterscheiben waren von einer nikotinbraunen Schicht überzogen. Die zweite Tür führte zum Boden und die dritte in eine Kammer, in der allerlei Gerümpel lag. Und mittendrin…
»Ja, ist es denn die Möglichkeit«, zerrte Hulda aus dem Chaos ein Ölbild in schwerem Goldrahmen hervor, das zweifellos von Künstlerhand gemalt war. Es zeigte einen Mann mit angegrautem Haar und einem klugen, durchgeistigten Gelehrtengesicht. Prüfend blickten die dunklen Augen den Beschauer an.
»Das ist bestimmt mein Onkel«, sagte Frauke leise. »Und dieses wunderbare Bild liegt zwischen Gerümpel. Warum denn nur?«
»Eine Frage, auf die du nie eine Antwort kriegen wirst«, brummte Hulda. »Kommt in die Küche, wo ich versuchen werde, einen Topf zu finden, der nicht vor Dreck starrt. Sogar einen elektrischen Kocher habe ich gesehen. Hoffentlich ist er nicht kaputt, so daß wir uns einen steifen Kaffee brühen können, den wir uns redlich verdient haben.«
»Und woher willst du die Bohnen dazu nehmen?« erkundigte sich Frauke.
»Aus der Büchse, die im Furagekoffer steckt. Ich konnte mir nämlich denken, daß wir hier nichts vorfinden werden. Das Bild nehmen wir doch mit nach unten?«
»Selbstverständlich. Das hängen wir nach Säuberung in der Bibliothek über den Kamin.«
In der Küche entnahm Hulda ihrem Koffer drei Kittelschürzen, von denen sie zwei den jungen Mädchen reichte.
»Zieht sie an, damit ihr euch nicht die Kleider schmutzig macht, wenn ihr euch setzt. Morgen nehme ich zuerst die Küche vor, damit wir wenigstens einen Raum haben, in dem wir uns unbesorgt aufhalten können. –
Na, der hat bestimmt schon Altertumswert«, griff sie mißtrauisch nach einem Wasserkessel, der auf einem Kocher stand. »Nur gut, daß er geschlossen ist und der Dreck nicht eindringen konnte. Wenn wir Glück haben, gibt es sogar Wasser.«
O ja, es gab außerdem noch Strom. Auch der Kocher war in Ordnung, auch eine Kanne, in der man den Kaffee brühen konnte. In dem Koffer, den Hulda auf den Tisch stellte, befanden sich außer Tubensahne noch genügend belegte Brote.
»Die erste Mahlzeit im eigenen Haus«, sagte Frauke andächtig. »Ein Jammer, daß ich dem Onkel nicht zeigen kann, wie dankbar ich ihm bin. Hätte er uns doch zu sich gerufen, Hulda, dann hätte er nicht so kümmerlich zu vegetieren brauchen.«
»Sicherlich wollte er es nicht anders haben«, meinte die Getreue achselzuckend. »Gelehrte Herren sind nicht wie andere Menschen, die haben allesamt einen Fimmel.
Großer Gott!« wich sie entsetzt zurück. »Was ist denn das für ein Ungeheuer?!«
Das Ungeheuer war ein prächtiger, besonders kräftiger Schäferhund, der einen Maulkorb trug und leise winselte. Hinter ihm wurde ein Mann sichtbar, lang, hager, mit einem Gesicht wie gegerbtes Leder.
»Entschuldigen Sie, meine Damen«, sagte er verlegen. »Aber ich konnte den Kerl beim besten Willen nicht länger halten.«
»Wem gehört denn der Hund?« fragte Frauke.
»Dem verstorbenen Herrn Professor.«
»Also haben Sie sich des Tieres angenommen, das ist lieb von Ihnen.«
»Na ja, was sollten wir schon machen, der arme Kerl tat uns leid. Malheur hatten wir nicht mit ihm, er lag größtenteils still unter der Ofenbank. Bis er Sie in diesem Haus witterte, da gab es kein halten.«
»Er ist wohl sehr scharf?«
»Und wie! Daher band ich ihm den Maulkorb um. Entschuldigen Sie, ich frage nicht aus Neugierde: Sind Sie die Erbin des Herrn Professors?«
»Die bin ich und heiße Frauke Gortz. Das da ist Fräulein Selk und das Fräulein Danz. Wir drei gedenken hier zu wohnen. Sind Sie vielleicht unser Nachbar?«
»Jawohl, gnädiges Fräulein«, machte er einen regelrechten Kratzfuß. »Ich bewohne mit einer Frau ein Häuschen, das dort in der Wiese steht.«
»So haben Sie meinen Onkel gekannt?«
»Direkt gekannt nicht, nur manchmal im Park gesehen. Er war nämlich ein Sonderling, der keinen Menschen um sich duldete. Aber was anderes: was wird nun aus dem Hund?«
»Den behalten wir natürlich«, entschied Frauke. »Das heißt, wenn er Ihnen nicht nachläuft.«
»I wo, das wird er schon nicht tun. Er kam ja nur mit mir, weil ich der einzige Mensch bin, der ihm bekannt war. Wo jetzt Menschen im Haus sind, wird er bestimmt hier bleiben.«
»Aber nicht vor morgen, Herr…«
»Michel heiße ich, gnädiges Fräulein. Bloß Michel allein.«
»Na schön, denn auch so. Also wir werden den Hund erst ab morgen behalten können, weil wir im Hotel übernachten müssen.«
»Uijeh –«, kratzte der Mann sich den borstigen Schädel. »Den werde ich wohl nicht mehr bändigen können. Sehen Sie doch, gnädiges Fräulein, er hat sich vor Ihre Füße gelegt und schaut Sie so aufmerksam und treu an. Den bekommt keiner mehr von Ihnen fort.«
»Ja, was machen wir denn da?« fragte Frauke ratlos. »Hier übernachten können wir nicht, wo alles so verschmutzt ist.«
»Ein Zimmer können wir schon herrichten«, brummte Hulda. »Das schaffen wir noch bis zum Dunkelwerden. Allerdings müßten wir alles das haben, wie Lappen, Bürsten und Seife.«
»Das wird Ihnen meine Frau gern leihen«, beeilte Michel sich zu versichern. »Sie ist eine Seele von Mensch und immer hilfsbereit. Soll ich sie holen?«
»Ja«, dehnte Frauke. »Aber versuche Sie mal erst, den Hund mit sich zu locken.«
Allein, als Michel ihn ans Halsband fassen wollte, knurrte er und drängte sich an Frauke, sie wie bittend anwinselnd. Als sie ihn streichelte, versuchte er, durch den Maulkorb hindurch ihre Hand zu lecken.
»Laßt das Tier in Ruhe!« brummte Hulda. »Ziehen Sie ab, Michel, und holen Sie Ihre Frau!«
*
»War das nicht leichtsinnig, Hulda?« fragte Frauke, nachdem der Mann gegangen war. »Wir kennen die Menschen doch nicht. Wenn sie nun Böses im Schilde führen?«
»Dann würde der da ihnen schon an die Gurgel springen«, zeigte sie auf den Hund, der aufmerksam zuhörte, als verstände er jedes Wort. »Komm mal her, mein Guter. Uns magst du doch leiden, nicht wahr?«
Wie zur Bestätigung legte das Tier ihr die dicke Pfote auf den Schoß, und Hulda lachte, was ja nun nicht oft geschah.
»So habe ich mir das doch gleich gedacht. Jetzt geh zu dem Frauchen da, das gehört nämlich auch zu uns.«
»Ja, komm!« lockte Ortrun ihn, der gehorsam folgte.
»Was bist du doch bloß für ein Prachtkerl. Der Maulkorb ist dir doch sicher unbequem, du Armer.«
Und schon zerrte er leise jaulend an der lästigen Fessel. Sah dabei die drei Frauchen so erwartungsvoll an, bis Hulda ihm kurzentschlossen das lästige Ding abstreifte. Er schüttelte sich, blaffte freudig auf und streckte sich dann mit einem tiefen Seufzer zu Fraukes Füßen. Rasch hielt sie ihm eine Brotschnitte hin, die er mit Behagen verspeiste und nach mehr schielte.
»Hör mal, mein Freund, das da ist unser Abendbrot«, zupfte sie lachend sein Ohr. »Wenn du das verspeist, müssen wir hungrig bleiben.«
In dem Moment klopfte es an die Außentür. Als Hulda sie öffnete, stand da der lange Michel und lachte über das ganze lederne Gesicht. Auch ein Handwagen stand da, beladen mit Holz, einem großen Eimer, Lappen, Schrubber, Besen, Seifenpulver und daneben schlunzelte etwas Druggeliches, dem die Gemütlichkeit sozusagen aus allen Nähten lugte. Die Backen waren rot und prall wie Äpfelchen, die dunklen Augen schauten verschmitzt in die Welt. Das gleichfalls dunkle Haar war kurzgeschnitten und lag dem Kopf fest an. Vierzig Jahre zählte sie, somit sieben weniger als ihr Mann.
»Das ist Bertchen, meine Frau«, stellte er stolz vor. »Sie kann arbeiten für zwei.«
»Wuuff!« machte der Hund wie zur Bestätigung, und Michel sah ihn dumm an. –
»Du hast den Maulkorb ab? Na, das ist ja allerhand. Hat er die Damen denn nicht gebissen?«
»O nein, er ist ein Kavalier«, lachte Ortrun fröhlich, dabei den Hals des Tieres furchtlos umschlingend. »Wie heißt er überhaupt?«
»Ajax«, gab die personifizierte Gemütlichkeit Antwort, nahm eine gefüllte Emailschüssel vom Wagen, stellte sie vor den Hund, der sich sofort mit Appetit darüber hermachte.
»Siehst du, Michel, jetzt frißt er endlich«, lachte sie ihr langes Ehegespons strahlend an. »Und nun wollen wir uns an die Arbeit machen, damit die Damen eine einigermaßen, gute Schlafstelle bekommen.«
So ging es los mit vereinten Kräften. Michel machte Feuer im Herd, stellte den großen Topf mit Wasser auf und riß dann man erst den zerfetzten Läufer von der Treppe, damit man sich bei dem Auf und Ab in den Löchern nicht verfing. Hinterher nahm er die Diele in Angriff, Bertchen die Küche, die drei andern Weiblichkeiten die beiden zusammenhängenden Zimmer im ersten Stock.
»Hoffentlich sind da nicht die Motten drin«, wiegte Hulda bedenklich den Kopf, als sie die Betten auf die weitgeöffneten Fenster legte. »Die kriegen wir dann nicht mehr raus und können den Plunder wegwerfen. Geh mir mal aus dem Weg, Ortrun. Was willst du überhaupt hier?«
»Helfen.«
»Du Porzellanpüppchen? Daß ich nicht lache!«
»Lach ruhig, aber laß mich arbeiten. Das habe ich nämlich im Töchterheim gelernt.«
»Dann zeig, was du kannst«, gab sie gutmütig nach und klopfte auf die Betten ein, daß die Staubwolken nur so wirbelten. Decken und Wände wurden gefegt, Möbel und Türen abgeseift, der Fußboden geschrubbt, die Fenster geputzt, so daß in gar nicht langer Zeit beide Räume blitzblank waren. Hinterher kam der Flur dran, die Treppe, und dann war von fünf hurtigen, fleißigen Menschen das Gröbste geschafft. In der Küche traf man zusammen, wo man sich jetzt dank Bertchens Scheuerwut unbesorgt hinsetzen konnte, um ein wenig zu verschnaufen.
»Na, das ging aber mal flott«, grinste Michel, behaglich sein Pfeifchen stopfend. »Hätte nicht gedacht, daß die Damen so zupacken könnten.«
»Der Not gehorchend«, lachte Frauke, dabei den Hund streichelnd, der sich zutraulich an ihr Knie schmiegte. »Soweit wäre nun alles klar, bis auf Bettwäsche. Zwar habe ich in dem einen Schrank eine ganze Menge davon entdeckt, aber die muß vor Gebrauch erst gewaschen werden. Was macht man da, Hulda?«
»Ins Dorf gehen und einkaufen. Das schaffst du noch bequem vor Ladenschluß.«
»Jawohl, Herr Feldwebel«, stand Frauke stramm. »Wenn ich nur wüßte, wo ich die einschlägigen Geschäfte finden kann.«
»Ich komm mit«, erbot sich Bertchen eifrig. »Ich zeige Ihnen, wo man am günstigsten einkauft, gnädiges Fräulein.«
»Das ist lieb von Ihnen, Frau…«
»Bertchen, bitte. Ich bin überall daran gewöhnt.«
»Danke, Bertchen. Machen wir uns also auf den Weg.«
»Ich hol nur rasch meinen Mantel.«
Weg war sie, und das Ehegespons sah ihr schmunzelnd nach.
»Ist wie auf Draht, mein Bertchen. Immer flink, dabei immer vergnügt. Was bin ich froh, so eine Frau zu haben, die mitverdienen hilft.
Sie hat nämlich eine Aufwartestelle«, erzählte er zutraulich weiter. »Und auch ich arbeite noch, so gut ich kann. Denn von der Rente allein könnten wir nicht einmal recht und schlecht leben.«
»Sind Sie für eine Rente nicht noch zu jung?« forschte Hulda, und er nickte bedächtig.
»Bin ich, noch nicht mal fünfzig. Aber ich hatte als Waldarbeiter einen Unfall, nach dem ich nicht mehr so ganz einsatzfähig bin, wie man so sagt. Da zahlt nun die Unfallversicherung mir monatlich hundertzwanzig Mark. Haben Sie noch gar nicht gemerkt, daß ich lahme?«
»Allerdings. Was ist mit dem Bein passiert?«
»Ein fallender Baum hat es böse gequetscht. Ich lag fast ein Jahr im Krankenhaus, wo man das Bein durchaus amputieren wollte. Aber dagegen sträubte ich mich mit aller Kraft. Na ja, und dann wurde es auch so besser. Ganz gut wird es ja nie werden, aber ich kann doch wenigstens auf zwei eigenen Beinen gehen.«
»Da haben Sie wohl oft Schmerzen, Sie Armer?« fragte Frauke mitleidig.
»Och, ab und zu so’n bißchen schon. Aber das läßt sich ertragen. Da bist du ja, Bertchen, und ganz außer Puste.«
»Es pressiert ja auch. Können wir aufbrechen, gnädiges Fräulein?«
»Sofort«, schlüpfte Frauke in den Mantel und griff nach der Handtasche, in der Geld steckte, mit dem sie sich reichlich versehen hatte. Ajax stand neben ihr, blaffte freudig auf.
»Was, du willst doch nicht etwa mit?«
»Wauwau!« machte er lustig, wobei sein Schwanz heftig wedelte.
»Der geht Ihnen nicht mehr von der Pelle«, schmunzelte Michel. »Streifen Sie ihm den Maulkorb über und nehmen Sie ihn mit. Weglaufen tut er bestimmt nicht.«
»Na, denn komm schon!« versah Frauke ihm mit der ledernen Sperre, was er sich geduldig gefallen ließ. »Und was willst du, Ortrun?«
»Nimmst du auch mich mit, Frauke?«
»Aber gern, mein Liebchen.«
So zogen sie denn frohgemut von dannen. Bertchen schob eine Karre vor sich her, die rundherum mit einem Drahtgeflecht und Gummireifen versehen war.
»Praktisch«, meinte Frauke. »So eine Karre müssen wir uns auch anschaffen, damit wir die Einkäufe nicht zu schleppen brauchen.«
Nach zwanzig Minuten war der Marktplatz erreicht, auf dem sich die Hauptgeschäfte des Dorfes befanden.
»Gehen Sie man da hinein, gnädiges Fräulein«, zeigte Bertchen auf einen Laden, in dessen Schaufenster Weißwaren ausgelegt waren. »Da werden Sie gut bedient. Ich warte hier auf Sie.«
»Danke, Bertchen. Und was ist mit dir, Ajax?«
Er saß neben der Karre, als wollte er sagen: Geh du nur, ich halte hier Wacht. Er rührte sich auch tatsächlich nicht, als die beiden Mädchen davongingen und einige Male zurückkamen, um ihren Einkauf im Karren unterzubringen.
An Wäsche kaufte Frauke nur soviel wie vorläufig benötigt wurde. Ferner kaufte sie allerlei Wirtschaftsartikel, Lebensmittel, bis die Karre voll und das Portemonnaie erheblich leerer war.
Als sie in der »Grünen Gans« die Zimmer abbestellte, war das dem Wirt aber auch gar nicht recht. Erst als Frauke trotzdem die Rechnung beglich, wurde er wieder devot und dienerte den »gnädigen Damen« nach. Dann trat er rasch ans Fenster und schaute hinter der Gardine stehend auf den Marktplatz. Und als er das bekannte Bertchen, den bekannten Hund und die vollgepackte Karre entdeckte, da wußte er Bescheid.
Olala! Das waren wohl die Erben des vertrottelten Professors, der sich um niemand und nichts gekümmert hatte und wohl gerade deshalb den Dorfbewohnern so interessant gewesen war. Wollten diese vornehmen jungen Damen etwa in dem verkommenen Eulennest hausen? Diese Neuigkeit mußte er gleich mal seiner Frau und später den hiesigen Gästen erzählen.
*
Indes gingen die Einkäufer die Straße entlang und erregten ziemliches Aufsehen. Man sah ihnen verstohlen nach, tuschelte hinter ihnen her und hatte für den Abend interessanten Gesprächsstoff.
Aus der Tür eines kleinen Hauses trat der große blonde Mann, der den beiden jungen Mädchen heute bereits zum dritten Mal begegnete. Doch auch jetzt achteten sie nicht auf ihn. Sahen nur verwundert auf, als er grüßend den Hut zog. Der Gruß galt allerdings Bertchen, die strahlend dankte und dann, als man außer Hörweite war, wichtig erklärte:
»Das war der Herr Doktor Gunder, der beste Tierarzt weit und breit. Ein feiner Mann, so anständig und so human. Ihm ist vor drei Jahren die Frau mit einem andern durchgegangen. Aber da sie nichts wert war, kann er froh sein, daß er sie auf eine so leichte Art los wurde. Natürlich ließ der Herr Doktor sich sofort scheiden und wohnt nun in dem Häuschen der Witwe Ließ, die ihn auch verpflegt. Seine Praxis hat er allerdings auf dem Markt, eingerichtet mit allen Schikanen. Na was, kann er sich ja auch leisten. Er verdient viel und ist außerdem noch von Hause aus vermögend. Sein Vater war hier Pfarrer«, schloß sie ihren Bericht, »und heiratete eine wohlhabende Gutsbesitzertochter.«
Im Hause hatten indessen die beiden segensreich gewirkt. Hatten den Schmutz aus Speise- und Frühstückszimmer entfernt.
»Das sieht ja hier schon ganz manierlich aus«, sah Frauke sich mit frohen Augen um. »Wenn das in dem Tempo weitergeht, haben wir das Haus bald sauber.«
»Wir wollen’s wünschen und Gott gäb’s«, brummte Hulda. »Raus ist mal erst der gröbste Dreck. Was hast du alles eingekauft?«
»Komm und sieh es dir an! Draußen steht die Karre.«
Nachdem Hulda alles in Augenschein genommen hatte, sagte sie mahnend:
»Jetzt laß es vorläufig genug sein, Herzchen. Was wir fürs erste brauchen, haben wir nun. Hauptsächlich anständige Töpfe, Eimer, Lappen und Seifenmaterial. Morgen sehen wir mal in den Schränken nach, was wir an Brauchbarem finden. Fehlendes kann immer noch angeschafft werden.«
»Ganz meine Meinung«, nahm Frauke dem Hund den Maulkorb ab und hielt ihm einen Kalbsknochen hin, über den er sich sofort hermachte. Es krachte nur so, und Michel meinte trocken:
»Zwischen dessen Zähne möchte ich nicht geraten. Wie ist es, meine Damen, wollen wir für heute Schluß machen?«
»Für heute?« fragte Frauke dagegen. »Wollen Sie uns denn morgen wieder helfen?«
»So oft und so lange Sie wollen, gnädiges Fräulein. Schwer arbeiten kann ich wohl nicht mehr, aber in Haus und Garten schaffe ich es spielend.«
»Ist gut, Michel«, erwiderte Frauke rasch entschlossen. »Sie arbeiten hier, und ich zahle Ihnen Stundenlohn.«
»Nu ne«, wehrte er ab. »Daraus wird nichts. Ich bin doch kein Halsabschneider. Über die Bezahlung können wir immer noch sprechen.«
»So haben Sie Dank«, reichte sie ihm die Hand, die er behutsam in seine derbe Faust nahm. »Wir werden uns bestimmt gut vertragen. Trinken Sie gern einen Schnaps?«
»Und wie! Am liebsten einen Weißen.«
»Als ob ich das nicht gewußt habe«, zog sie aus der Karre eine Flasche und drückte sie dem überraschten Mann in den Arm. »Die habe ich extra für Sie gekauft, trinken Sie sie auf unser Wohl. Und Sie, Bertchen, leckern doch gern, nicht wahr?«
Ehe die Frau antworten konnte, hielt sie unter einem Arm eine süße Schachtel, unter dem andern ein Fleischpaket, und in der Hand knisterte ein Zwanzigmarkschein, was für die sparsamen Menschen viel Geld bedeutete. Mit dieser noblen Geste hatte Frauke ein Ehepaar gewonnen, das ihr fortan mit rührender Treue anhing.
»Kleine Ursache, große Wirkung«, schmunzelte Hulda, nachdem die beiden zu Tränen gerührt abgezogen waren. »Dir machen die paar Mark nicht viel aus, aber denen da helfen sie gut mit. Bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst.«
»Danke für das Kompliment«, lachte Frauke. »Halt hier keine langen Reden, sondern sieh zu, daß wir Abendbrot kriegen. Gern hätte ich Speckeier, geht das?«
»Da du alles dafür Erforderliche mitgebracht hast, dürfen sich keine Schwierigkeiten ergeben. Sogar an eine Stielpfanne hast du gedacht; denn die hier vorhandene ist Bruch, wie die Töpfe auch. Morgen fliegt der ganze alte Krempel ’raus.
Komisch«, fuhr sie nachdenklich fort, Holz auf das brennende Feuer legend. »In der Küche ist alles so armselig wie bei den Ärmsten einer, und in den Zimmern liegen Werte achtlos herum. Sieh dir mal morgen an, was alles in dem Mordsding von Büfett steckt. Da wirst du Augen auf Stielchen bekommen, wie ich sie bereits bekam. Schweres altes Silber liegt da und ich möchte fast wetten, daß der Herr Professor mit einem Blechlöffel gegessen hat. Wo willst du denn hin?«
»Mir die Sachen ansehen.«
»Das würde ich dir nicht raten. Bedenke, daß du Licht machen mußt, und daß die Fenster weder Gardinen noch Laden haben.«
»Hast recht, Huldchen, verschiebe ich es auf morgen. Ich bin sowieso zum Umfallen müde, und wir müssen ja noch die Betten beziehen.«
»Das werden wir auch noch schaffen«, tat Hulda Speck in die Pfanne, die sie vorher ausgebrüht hatte. Lieblicher Duft durchzog die Küche, in den sich der des frischen Kaffees mischte. Mit bestem Appetit aß man, wusch rasch das Geschirr ab, verschloß sorgfältig die Türen und begab sich nach oben, wo man zuerst mit Laken, dem entdeckten Vorrat entnommen, die Fenster verhängte. Flink bezog man die Betten, während Ajax auf dem dicken Vorleger herumscharrte, der ihm wohl von jeher als Nachtlager gedient hatte, jedoch nicht an der richtigen Stelle lag. Erst als Frauchen ihn an ihr Bett trug, streckte das Tier sich zufrieden und sah aufmerksam zu, wie die lieben Frauen die Kleider abwarfen, in die Nachthemden schlüpften und sich dann niederlegten. Frauke ins Bett, Ortrun auf den Diwan, und im Nebenzimmer nahm Hulda das zweite Bett ein. Die Matratzen waren gut, die Zudecke wohl schwer, aber wenn man so richtig müde ist, merkt man es kaum. Man wünschte sich eine gute Nacht, knipste das Licht aus, legte sich auf die Seite und schlief fast augenblicklich ein.
*
Der lange Michel war einfach ein Genie. Denn es gab kaum etwas, das er nicht konnte.
Nachdem er wuchernde Bäume gefällt und die Stubben gerodet hatte, legte er um das Haus herum Rasen und Blumenbeete an, wozu Mitte März ja noch Zeit war. Den brachliegenden Gemüse- und Obstgarten brachte er wieder in Schwung, wie er sich ausdrückte, wobei alle fleißig mithalfen. Auch Bertchen, die ihre Aufwartestelle zwar behielt, aber trotzdem noch Zeit genug hatte, um in Haus und Garten kräftig zuzupacken. Für Verpflegung brauchte sie vorläufig nicht zu sorgen. Das tat Hulda so gut und reichlich, daß Michel behauptete, bereits einen Schmerbauch zu kriegen. Und als der Garten seiner Ansicht nach wie eine Putzstube aussah, nahm er die nächstdringende Arbeit in Angriff.
»Das Haus muß verputzt werden, solange das schöne Wetter noch anhält«, erklärte er kurz und bündig. »Wenn erst der April mit seinem Regen kommt, ist es zu spät.«
Also wurde das Haus verputzt, wozu er allerdings zwei Facharbeiter hinzuzog. Er selbst jedoch war mit dabei, nicht viel Worte machend, sondern fest zupackend.
Als dann die Mauern in blendendem Weiß erstrahlten, wurden die Helfer entlohnt. Am Dach war nichts auszubessern, das war erstaunlicherweise tadellos in Ordnung. Fensterrahmen und -laden strich Michel, wobei ihn Hulda mit fast fachmännischem Geschick unterstützte. Das leuchtende Grün zu dem schneeigen Weiß machte sich prächtig. Grün waren auch die Blumenkästen, die sich vor den oberen Flurfenstern hinzogen. Wenn erst die gepflanzten Geranien, Petunien und Hängenelken darin blühten, gab das ein lustigbuntes Bild.
Zuletzt kam die Haustür dran, die wie das Dach ohne Schaden war. Dazu aus bestem Eichenholz, mit dicken, geschliffenen Scheiben, die natürlich verschmutzt waren. Doch nachdem Hulda sie bearbeitet hatte, funkelten sie wie doll, nach ihrem Ausspruch, und Michel ließ es sich nicht nehmen, das Holz zu beizen, bis auch das »wie doll« glänzte.
»Na, das ist ja nun außen hui, aber noch immer von innen pfui«, stellte Huldchen fest, als das Haus in hellem Glanz erstrahlte. »Das muß bis Ostern anders werden.«
Und es wurde anders. Zehn geschickte Hände regten sich fleißig. Tapezierten, polierten, lackierten, und als die Osterglocken läuteten, war aus dem Schandfleck des Dorfes das schmuckste Haus geworden, über dessen Tür in großen goldenen Lettern stand: Haus im grünen Grund.
Diese Auferstehung hatten die Dorfbwohner mit brennendem Interesse verfolgt. So viele Menschen waren wohl noch nie an dem Anwesen vorübergegangen wie jetzt. Da stand jetzt kein Zaun mehr mit abgebröckeltem Sockel, verwaschenen Staketen und rostigem Tor, hier war verputzt, lackiert und bronziert worden. Auch was jetzt hinter dem schmucken Zaun lag, wie gern hätte man es aus der Nähe in Augenschein genommen. Aber hinter dieser Pforte befand sich ein verschlossenes Paradies – und der Erzengel davor war Ajax, der rassige Schäferhund. Zwar hielt er kein flammendes Schwert, aber er zeigte ein furchterregendes Gebiß.
Das alles wurde bestaunt, erörtert und beklatscht. An den Stammtischen, auf den Kaffeekränzchen und in den Geschäften. Das Haus im grünen Grund war ein Begriff geworden.
Was den Bewohnern übrigens höchst gleichgültig war. Sich um andere zu kümmern, dazu hatten sie von jeher keine Lust, und dann hatte ihnen in den vergangenen Wochen wahrlich die Zeit dazu gefehlt. Da hatten sie sich keine Ruhe gegönnt. Hatten geschuftet vom frühen Morgen bis zum späten Abend.
Doch jetzt kam ihrer Arbeit Lohn. Jetzt konnten sie sich an dem erfreuen, was sie rundum mit Ausdauer und Fleiß geschaffen hatten.
Den langen Michel schmiß es fast um, als Frauke ihm, nachdem hier alles so herrlich vollendet, mit reizendem Grübchenlächeln ein Bündel Scheine in die Hand schob, die zusammen eine vierstellige Zahl ausmachten. Direkt entsetzt starrte er auf diesen Segen.
»Gnädiges Fräulein, so was ist doch unerhört.«
»Nicht unerhört, lieber Michel«, sagte sie herzlich. »Ihre Hilfe ist uns so viel wert, daß wir sie eigentlich gar nicht bezahlen können. Bedenken Sie, wenn wir Handwerker im Hause gehabt hätten. Ach was, ziehen Sie ab!«
Das tat er denn auch und hatte dann zu Hause den Freudenausbruch seines Bertchens zu überstehen.
Und am Ostersonnabend, der fast sommerliche Wärme brachte, saßen die fleißigen Arbeiter treu vereint auf der Terrasse beim Nachmittagskaffee. Saßen in Gartensesseln, die sie selbst lackiert hatten, und schauten mit frohen Augen hinaus in den kleinen Park. Es waren noch Bäume genug da, die Michels Axt verschont hatte; denn sie hatte nur das erfaßt, was schmarotzte und verdüsterte. Auf den frischangelegten Rasenflächen, die schon erstaunlich grün waren, blühte Krokus lustigbunt.
Auch auf den Beeten zeigten sich Frühlingsblumen. Die Birken umwallte ein grüner Schleier, die Magnolien sahen aus, als hätte man zartrosa Watte darüber gestreut. Nichts Düsteres gab es mehr, alles war hell, licht und froh.
Stolzgeschwellt sah Michel auf sein Werk. Hatte sich zur Feier des Tages fein gemacht, wie sein Bertchen auch. So gehörte sich das, wenn man von der Herrschaft eingeladen war.
Plötzlich horchten alle auf. Glockentöne wehten zur Terrasse hin und zwar von dorther, wo sich das prächtige Schloß erhob. Fünf Augenpaare waren jetzt darauf gerichtet und sahen voller atemloser Spannung zu, wie auf dem hohen Hauptturm die Fahne auf Halbmast gehißt wurde.
»Die Baronin ist tot«, sagte Bertchen leise. »Gott hab sie selig.«
Ihr Ehegespons jedoch murmelte etwas, das die Frau entsetzt die Augen aufreißen ließ:
»Gott sei Dank, jetzt ist der arme Kerl endlich von seinem Kreuz erlöst!«
»Michel, schämst du dich gar nicht, so frevelhaft daherzureden?!«
»Was heißt hier frevelhaft«, knurrte er. »War nun die Baronin ein Kreuz für ihren Mann oder nicht?«
»Das schon«, mußte sie kleinlaut beigeben. »Aber nun ist sie tot. Und den Toten soll man Gutes nachsagen.«
»Selbstverständlich. Auch wenn sie in ihrem nichtsnutzigen Leben die Menschen gepeinigt haben bis aufs Blut.«
»Michel!«
»Na ja, ich bin schon still«, sah er verlegen in drei Augenpaare, die verständnislos an seinem Gesicht hingen. »Nichts für übel, meine Damen, aber bei allem, was man da hörte, konnte sich einem schon das Herz krümmen vor Jammer. Denn so ein leibhaftiger Teufel…«
»Halt den Mund, Michel, laß mich reden, ich werde bestimmt nicht so ausfallend wie du! Außerdem kenne ich die Verhältnisse im Schloß nicht nur vom Hören, sondern auch vom Sehen, weil ich öfter mal zur Aushilfe dort war und so manches mit angesehen habe. Also, meine Damen, das war so:
Der junge Baron heiratete ein reiches Mädchen, weil er Geld für seinen großen Besitz brauchte. Doch gleich nach der Hochzeit stellte sich heraus, daß ihn sein Schwiegervater geblufft hatte. Der war nämlich pleite, segelte ins Ausland ab. Nun hatte der arme, betrogene Mann eine Frau am Hals.«
»Aha!«
»Du sollst mich nicht unterbrechen, Michel, das rutschte mir nur so raus. Sage ich so: Er hatte nun eine Frau, die nicht Geld mitbrachte, sondern viel Geld verlangte, da sie an ein verschwenderisches Leben gewöhnt war. Eigentlich hätte der Herr Baron sich gleich scheiden lassen müssen, von wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen und so. Und vielleicht hätte er es auch getan, wenn seine Frau nicht bei ihrer verrückten Autoraserei verunglückt wäre. Dabei verletzte sie sich das Rückgrat so arg, daß es keine Hilfe mehr gab. Und da sie schon von Natur so ein…«
»Teufel«, half Michel aus.
»Wenn du jetzt nicht den Mund hältst, bekommst du von mir keinen Schnaps!«
»Damit kannst du mich nicht einschüchtern«, grinste er sie an. »Ich bekomme schon einen – oder gar mehrere.«
Da mußte das liebe, gute Bertchen lachen, fuhr dann aber ernstwerdend in ihrer Erzählung fort:
»Da die Baronin schon von Natur aus ein unruhiger Geist war, machte das Siechtum sie zur…«
»Kanaille!«
»Na schön, das will ich gelten lassen, sie war wirklich eine. Sie tyrannisierte nämlich das ganze Haus, am meisten aber ihren Mann und seine blutjunge Schwester. Aber sie sollen ihr Kreuz geduldig getragen haben, wovon der Heiland sie heute, vor seinem Auferstehungstag, erlöste.«
»Amen!« schloß der unverbesserliche Michel, was die andern lachen machte, ob sie wollten oder nicht. Was ging sie schließlich die Tragödie anderer Leute an? Wenn sie darüber weinen wollten, würden sie wohl kaum die Tränen stillen können, weil es ja auf der Welt der Tragödien so viele gibt. Und jeder muß damit fertig werden, ob so oder so.
»Jetzt trinken wir einen Schnaps«, ordnete Hulda an, was allgemeine Begeisterung fand. Und da es ja heißt: Vor dem Schnaps einen Schnaps, nach dem Schnaps noch ’nen Schnaps, mußte man sich daran halten. Wenigstens tat es das Ehepaar. Und als es später schied, Bertchen mit einem Korb am Arm, in dem sich Festtägliches befand, schwankten sie Hand in Hand beseligt über die Wiese ihrem Häuschen zu, in dem Liebe, Friede und Eintracht ihre Zepter schwangen.
*
Die Zurückbleibenden sahen belustigt dem schwankenden Paar nach, bis es im Haus verschwunden war.
»Die sind jetzt wohlverwahrt und aufgehoben«, lachte Frauke. »Das heißt, so arg war es mit Bertchen nicht, die konnte noch gut Balance halten. Aber schaut mal dort hinauf. Ist das nicht ein Mensch, der von dem Schloß her die Anhöhe hinabläuft?«
»Scheint mir auch so«, kniff Hulda die Augen zusammen, um besser sehen zu können. »Sieht wie ein junges Mädchen aus, das auf Michels Haus zuhält. Da steht übrigens Bertchen und winkt.«
Gespannt verfolgten sie den Vorgang weiter. Jetzt machte die Laufende vor Bertchen halt, die zuerst auf sie einsprach, sie dann bei der Hand nahm und über die Wiese auf das grüne Haus zukam. Einige Minuten später standen sie vor den drei erstaunten Menschen auf der Terrasse.
»Verzeihen Sie bitte, meine Damen«, sagte Bertchen verlegen. »Ich wollte mal fragen, ob Sie das Baroneßchen, das in ihrer Angst und Not zu uns flüchtete – ich meine, wir sind doch kein Umgang –, außerdem ist es bei uns so beengt.«
Hilflos sah sie Frauke an, die lächelnd sagte:
»Sie meinen, daß wir uns der jungen Dame annehmen sollen, nicht wahr?«
»So ist es, gnädiges Fräulein«, atmete Bertchen auf. »Hier ist das Baroneßchen doch unter Menschen, die zu ihm passen. Mein Gott, so’n junges Blut muß ja Angst kriegen, wo oben eine Leiche liegt und wo keiner jetzt Zeit hat, sich um es zu kümmern.«
»Ist schon gut, Bertchen«, winkte Frauke ab, mitleidig auf das junge Menschenkind schauend, das mit dickverweintem Gesichtchen ängstlich dastand.
»Wollen Sie bei uns bleiben, Baroneß?« fragte sie freundlich.
»Wenn ich darf und nicht störe, dann gerne.«
»Sie stören uns nicht. Weiß der Herr Baron denn, daß Sie das Schloß verlassen haben?«
»Nein«, entgegnete das Backfischchen schüchtern. »Mein Bruder hat jetzt keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Das hat überhaupt keiner. Und ich bin doch so allein, ich habe so große Angst! Meine Schwägerin hat vorher doch so entsetzlich geschrien – o mein Gott!«
»Nun, nun«, beschwichtigte Frauke, das nun wieder weinende, an allen Gliedern zitternde Mädchen liebevoll umfassend. »Setzen Sie sich zuerst einmal. So, und nun werde ich dem Herrn Baron telefonisch Bescheid sagen, wo sein Schwesterchen sich befindet. Wie ist die Rufnummer?«
»Dreimal zwei, gnädiges Fräulein.«
»Nun, das ›gnädige‹ wollen wir lassen. Ich bin Frauke Gortz, das ist Fräulein Hulda Selk und das Fräulein Ortrun Danz. Ich telefoniere jetzt und gebe dann Bescheid, was ich ausgerichtet habe.«
In der jetzt so schmucken Diele ging sie zum Telefon, wählte die Nummer und hörte gleich darauf eine Männerstimme:
»Hier Schloß Swidbörn.«
»Herr Baron persönlich?«
»Nein. Es spricht der Diener Niklas.«
»Danke. Könnte ich den Herrn Baron sprechen?«
»Dann müßte ich um den Namen bitten und worum es geht.«
»Es geht um die Baroneß, die sich augenblicklich in meinem Haus befindet – im Haus im grünen Grund.«
»Die Baroneß – o mein Gott!« kam es gepreßt vom andern Ende. »Bitte, sich einen Moment zu gedulden, gnädiges Fräulein. Ich sage dem Herrn Baron sofort Bescheid.«
Einige Minuten später sprach dann eine sonore, herrische Stimme:
»Swidbörn. Wie mir mein Diener sagte, befindet sich meine Schwester in Ihrem Hause, gnädiges Fräulein?«
»Ganz recht, Herr Baron.«
»Aber wie kommt die Kleine ausgerechnet zu Ihnen, Sie sind ihr doch ganz fremd.«
»Sie lief in ihrer Angst und Not zu Bertchen und Michel, falls die beiden Ihnen ein Begriff sind.«
»Doch, natürlich. Aber so bekannt sind sie meiner Schwester nun auch wieder nicht, als daß diese bei ihnen Schutz suchen könnte. Da gibt es hier doch die Gutsbeamtenfamilien, die ihr viel vertrauter sind. Also muß die Kleine in ihrer Verstörtheit das Köpfchen verloren haben. Und wie kam sie zu Ihnen, gnädiges Fräulein?«
»Bertchen brachte sie mir und meinen Lieben, weil sie in ihrer unbeholfenen Art mit dem verstörten Dinglein nichts anzufangen wußte.«
»Eine ziemliche Zumutung, fremde Menschen zu belästigen.«
»Bertchen ist mir nicht fremd.«
»Aber meine Schwester ist es.«
»Das wohl. Doch wenn ein Mensch Hilfe braucht, muß man sie ihm angedeihen lassen, ob er da fremd ist oder nicht. Oder würden Sie einem solchen Menschen Ihre Hilfe verweigern, Herr Baron?«
»Natürlich nicht.«
»Also! Nun kurz die Rede: Vertrauen Sie mir ihr Schwesterchen solange an, bis man in Ihrem Hause soweit ist, daß man sich um das verängstigte Kind wieder kümmern kann.«
»Darf ich Ihr hochherziges Angebot auch wirklich annehmen, gnädiges Fräulein?«
»Von Hochherzigkeit kann keine Rede sein, Herr Baron. Es ist weiter nichts als Menschenpflicht.«
»Das möchte ich bezweifeln, aber…«
»Kein aber, Herr Baron.«
»Dann danke ich Ihnen, gnädiges Fräulein. Ich kann mich in den nächsten Tagen um das arme Kind so gar nicht kümmern und meine Getreuen auch nicht.«
»Eben deshalb ist es bei uns gut aufgehoben. Übrigens, mein Beileid, Herr Baron.«
»Danke, gnädiges Fräulein. Ich werde mir erlauben, wenn hier alles vorüber ist, Ihnen meinen persönlichen Dank abzustatten.«
»Das freut mich. Ist nun alles klar?«
»Ja. Noch mal besten Dank!«
Damit war das Gespräch beendet, und Frauke ging zurück auf die Terrasse, wo der junge Gast ängstlich fragte:
»War mein Bruder böse?«
»Nein, Baroneß, nur verwundert.«
»Hat er mir erlaubt, hierzubleiben?«
»Ja. Und zwar für die nächsten Tage.«
»Na sehen Sie, Baroneßchen«, fuhr Bertchen unbeholfen über das Köpfchen mit den langen blonden Zöpfen. »Es sind gute Menschen, bei denen Sie sich befinden, sehr gute Menschen. Kann ich nun gehen? Sonst trinkt mein Michel womöglich die Flasche leer, die ich im Korb fand.«
»Denn aber schnell«, lachte Frauke, worauf Bertchen sich schleunigst in Bewegung setzte. Wie ein Wiesel lief sie durch den grünen Grund und verschwand in dem kleinen Haus.
»So, nun wollen wir uns mal um unseren Gast kümmern«, sagte Frauke fröhlich. »Aber aber, doch nicht ein so unglückliches Gesichtchen, Baroneß!«
»Bitte, wollen Sie mich nicht Oda nennen und die andern auch?« fragte die Kleine schüchtern.
»Wenn Sie es wünschen, dann gern. Sie gehen doch sicher noch zur Schule, nicht wahr?«
»Nein.«
»Dann unterrichtet Sie eine Hauslehrerin?«
»Auch nicht. Meine Schulzeit ist seit Ostern beendet.«
»Wie kommt denn das?« fragte Hulda verwundert. »Sind doch höchstens vierzehn Jahre.«
»Aber nein«, lachte es schon zaghaft in den großen blauen Augen auf. »Es machen die Zöpfe, daß man mich für jünger hält, als ich bin. Aber mein Bruder liebt sie so sehr und wünscht, daß ich sie bis achtzehn Jahre trage. Jetzt bin ich sechzehn vor einigen Tagen geworden. Und da ich in der Schule die mittlere Reife erlangt hatte, durfte ich abgehen.«
»Taten Sie es gern?«
»O ja, sehr gern.«
»Das kam aus tiefstem Herzensgrund«, schmunzelte Hulda. »Ich werde mich jetzt um das Abendessen kümmern. Nein, Ortrun, bleib du hier, Frauke kann mir helfen. Damit die Kleine schneller ihre Scheu verliert«, setzte sie in der Küche erklärend hinzu. »Dich scheint sie mehr als Respektsperson zu betrachten, während sie Ortrun als ihresgleichen ansieht.
Na ja, hätte mir auch nicht träumen lassen, daß wir so bald schon einen Gast bekommen würden – und einen so feinen noch dazu. Nur gut, daß im Haus alles in Ordnung ist. Wo wird die Kleine schlafen? Allein würde sie sich wahrscheinlich graulen, so verängstigt wie sie ist.«
»Das nehme ich auch an. Stellen wir den Diwan aus meinem in Ortruns Zimmer, dann sind die beiden jungen Mädchen unter sich.«
Frauke ging ins Eßzimmer und deckte den Tisch mit dem kostbaren Porzellan, das sie wie vieles andere hier in den Schränken vorgefunden hatte. Auch Silber und Tischwäsche, die verschmutzt an alle möglichen Stellen hineingestopft worden war. Mit allen anderen Sachen war es genauso. Nichts befand sich da, wo es hingehörte. Doch nun lag alles gewaschen und geordnet in Schränken und Schüben. Es war so viel, daß Frauke mit Wäsche aller Art versorgt war auf lange Zeit.
Die verschmutzten Mahagonimöbel hatte man so lange poliert, bis sie glänzten, die Beschläge geputzt. Die Polster und Teppiche, zum Teil echte Perser, geklopft, entfleckt und mit Salmiak aufgefrischt. Kurz und gut, man hatte alles so lange bearbeitet, bis es in neuem Glanz erstrahlte.
Selbst bei den Gardinen und Vorhängen, die durchweg gekauft werden mußten, hatte man den Dekorateur gespart, indem man sie selbst anbrachte. Jetzt besaß Frauke Gortz, die herumgestoßene Verwandte der Familie Zerkel, ein weit schöneres, größeres und feudaler möbliertes Haus als diese es hatte. Und während diese Schulden hatten bis über beide Ohren, nannte sie ein ganz nettes Bankkonto ihr eigen. Und das Schicksal nannte es ausgleichende Gerechtigkeit.
*
Als die beiden Mädchen bei Tisch erschienen, hatten sie sich bereits angefreundet. Die kleine Baroneß war wohl noch zurückhaltend, aber lange nicht mehr so scheu wie zu Anfang. Und als sie später zwei Glas Bowle getrunken hatte, war aller Kummer vergessen. Sie wurde richtig zutraulich. Beteuerte immer wieder, wie froh sie doch wäre, hier zu sein. Auch daß sie es nicht fassen könnte, was man aus der Räuberhöhle gemacht hätte.
»Von innen habe ich das Haus nie gesehen, wie ja überhaupt niemand Zutritt hatte«, erzählte sie in ihrer reizenden Art. »Aber schon von außen kam es mir so unheimlich vor, so unsagbar trostlos und traurig.
Sie müssen nämlich wissen, daß wir vom Schloß aus beobachten können, was im Tal vor sich geht«, verriet sie eifrig. »Nur hier hatten wir keinen Einblick, weil alles zu verwachsen war. Unsere Barbe nannte es das Gespensterhaus, in dem es nicht geheuer wäre. So richtig gruseln konnte man sich.«
»Darf man wissen, wer die Barbe ist?« fragte Frauke, die genauso wie Hulda und Ortrun amüsiert dem kindlichen Geplauder lauschte.
»Natürlich dürfen Sie das wissen. Barbe ist unsere gute Barbe, die als Kindermädchen meines Bruders zu uns kam. Als Winrich sie nicht mehr brauchte, wurde sie Beschließerin und heiratete der Einfachheit halber den Diener Niklas.«
»Der Einfachheit halber ist gut«, lachte Frauke, und vergnügt tat die allerliebste Kleine mit.
»Na ja, lieb haben sie sich außerdem auch noch«, bekannte sie treuherzig. »Und ich habe sie auch lieb, weil sie so gut und so treu sind und mich vergöttern, wie mein Bruder es nennt.«
»Haben Sie denn keine Eltern mehr?« fragte Frauke wie beiläufig.
»Nein, sie sind schon lange tot. Mir ist doch so komisch im Kopf, wie kommt das nur?«
»Ja, wie mag das wohl kommen«, wiederholte Hulda trocken. Und dann leise zu Frauke und Ortrun: »Nehmt sie untern Arm und bringt sie zu Bett.«
So zog man denn mit dem beschwipsten Persönchen ab. Durch die Diele, die Treppe hinauf, die jetzt ein neuer Läufer deckte, hinein in Ortruns Zimmer, dessen Einrichtung sie aus ihrer Tasche bezahlte. Zwar war das Frauke nicht recht, aber das Mädchen bettelte so lange, bis sie nachgab.
Es war ein allerliebstes Jungmädchenzimmer mit zartgrünen Schleiflackmöbeln, bunten Seidenpolstern, dickem Teppich, duftigen Gardinen und niedlichem Kleinkram. Ehe Oda sich so recht versah, lag sie auf dem Diwan und gähnte herzhaft. Legte sich auf die Seite und wechselte augenblicklich hinüber ins Traumland.
»Die ist versorgt«, lachte Frauke unterdrückt. »Mach es genauso, Herzchen, kriech ungewaschen und ungeplättet in dein nobles Bett. Die nötige Bettschwere haben wir alle; denn die Bowle hatte es in sich. Schlaf gut, mein Kleines!«
»Du auch, Fraukelein. Wie glücklich bin ich doch, daß es dich und Hulda gibt.«
Stürmisch wurde sie umhalst und geküßt. Gleichfalls Hulda, die leise eingetreten war.
»Dich hat es auch ganz nett erwischt«, schmunzelte sie. »Husch bloß ins Körbchen, damit du nicht noch die schlafende Baroneß überfällst. In deinem seligen Dusel ist dir das schon zuzutrauen.«
»Soll ich’s tun?« blitzte der Übermut sie an.
»Laß bloß das Kind in Frieden. Das hat den Schlaf weiß Gott nötig. Schlaft euch gut aus, gute Nacht!«
Sie ging in ihr Zimmer, das sie sich behaglich eingerichtet hatte, ebenso wie Frauke das ihre, das neben dem Ortruns lag. Auch hier war alles hell und licht. Angefangen von den schimmernden Rosenholzmöbeln, dem hellen, flauschigen Teppich, den duftigen Gardinen bis zur seidenglänzenden Daunendecke.
Zu allem hatte das Geld gelangt, es war sogar noch ganz nett etwas übriggeblieben. Außerdem hatte sie ihre Rente und das sehr reichliche Pensionsgeld Ortruns. Damit ließ sich gut auskommen.
Auch am nächsten Tag zeigte der April sich gnädig. Wenn die Luft auch kühl war, aber es schien die Sonne. Frauke und Hulda, die zeitig aufgestanden waren, um im Park die Eier zu verstecken, waren gerade fertig, als sie an der Küchentür den Mann entdeckten, den Ajax verbellte. Frauke rief ihn zu sich, befahl ihm, bei Fuß zu bleiben und trat auf den Fremden zu, der eine schlichte Livree trug.
»Guten Morgen!« grüßte er höflich. »Ich bin der Diener Niklas vom Schloß und bringe der Baroneß ein Köfferchen mit Kleidern und einen Karton von meiner Frau, der Barbe. Diese Blumen soll ich den Damen von Herrn Baron überreichen und Dank sagen für die freundliche Aufnahme, die Baroneß hier gefunden hat.«
Frauke nahm ihm die Blumen ab, während Hulda nach Koffer und Karton griff.
»Sagen Sie dem Herrn Baron, wir lassen für die Blumen danken. Er braucht sich um die Baroneß keine Sorgen zu machen, sie ist bei uns bestens aufgehoben. Wann ist die Beisetzung?«
»Übermorgen um fünfzehn Uhr, gnädiges Fräulein. Der Herr Baron sagt telefonisch Bescheid, wenn die Baroneß im Schloß erscheinen soll. Ich empfehle mich den Damen.«
Würdig schritt er davon und Hulda brummte, während sie mit Frauke in die Küche ging:
»Ziemlich hochnäsig, der Herr Diener. Na ja, wie der Herr, so das Gescherr!«
»Wie kannst du nur so reden, Hulda. Du kennst den Baron ja gar nicht. Und die Baroneß ist doch weiß Gott nicht hochnäsig.«
»Wird sich schon auf ihr blaues Blut besinnen, wenn sie die Kinderschuhe abgestreift hat. Sieh nach, was im Seidenpapier für Blumen sind.«
Als die freilagen, tippte sie der Reihe nach auf die Blüten.
»Wunderbar abgestuft. Für das ältere gnädige Fräulein Orchideen, für das jüngere gnädige Fräulein Lilien, für die Küchenfee Osterglocken.«
Vergnügt fiel sie in das hellklingende Lachen Fraukes ein, die Koffer nebst Karton ergriff und zu den beiden Mädchen ging, die in ihren Betten lagen und sich unterhielten.
»Frohe Ostern!« riefen sie der Eintretenden entgegen, die zu Oda trat und die beiden Sachen aufs Bett legte.
»Das hat der Diener Niklas für Sie abgegeben.«
»Niklas?« schnellte die Kleine wie ein Gummiball hoch. »Haben sie im Schloß doch an mich gedacht. Was mag da drin sein?«
»Sehen Sie nach, dann werden Sie es wissen.«
»O bitte!« bettelten die Blauaugen zu ihr hoch. »Nennen Sie mich doch du, als Ostergeschenk. Von Ortrun habe ich es bereits erhalten.«
»Na schön, dann aber nur auf Gegenseitigkeit.«
»Aber dann sind Sie – dann bist du – gar keine Respektsperson mehr für mich.«
»Darauf lege ich auch gar keinen Wert.«
Interessiert sah sie zu, wie Oda den Koffer öffnete, in dem außer Nachtzeug und Unterwäsche ein schwarzweißes Wollkleidchen, schwarze Strümpfe und schwarze Wildlederschuhe lagen. Fragend sah das Mädchen zu Frauke hoch, die leise sagte:
»Du hast Trauer, Oda.«
»Richtig«, senkte sie verlegen das blonde Köpfchen. »Wie lange muß ich die einhalten?«
»Das wird dein Bruder bestimmen.«
»Na ja, was sein muß, das muß nun mal sein«, sagte sie kläglich, klappte den Deckel zu und griff nach dem Karton, öffnete ihn. Und schon strahlten ihre Augen wieder.
»Oh, ist das mal hübsch bunt. Das hat sicher meine liebe Barbe mir geschickt; denn mein Bruder hat für so etwas jetzt bestimmt überhaupt keinen Sinn.
Oder doch?« zerrte sie aufgeregt ein großes Osterei aus dem Glitzerkram hervor, in dessen Schleife ein Kärtchen steckte. Rasch überflog sie die markige Schrift und sagte eifrig:
»Alles, was da so hübsch blitzert, ist von meinem Bruder. Paßt man auf, was er schreibt! Einen herzlichen Ostergruß, mein kleiner Zeisig. Verlerne nur das Zwitschern nicht, das dein großer Bruder immer nötig haben wird. Die gefärbten Eier schickt dir Barbe, die froh ist, ihren Liebling so gut aufgehoben zu wissen. Übermorgen auf Wiedersehen! – Winrich.«
Nun wurde alles einzeln aus der Schachtel genommen, beäugt, bestaunt. Dann begann sie den reichen Segen durch vier zu teilen, was Frauke ahnungsvoll fragen ließ:
»Was soll das geben?«
»Geteilte Freude, ist doppelte Freude. In diesem Fall sogar vierfache Freude.«
»Und du meinst, daß wir es annehmen werden?«
»Warum denn nicht? Ich nehme von euch ja noch viel mehr an!«
»Darüber werden wir unten debattieren. Jetzt macht, daß ihr euch anzieht, damit wir frühstücken können.«
Sie ging, und eine halbe Stunde später erschienen die beiden Mädchen. Odas Kleid war recht niedlich, nur die schwarzen Strümpfe störten. Ortrun, die sich eigens zum Osterfest ein entzückendes Kleidchen gekauft hatte, trug es nicht, sondern einen dunkelblauen Rock mit einer weißen Seidenbluse. Frauke und Hulda warfen sich einen verständnisvollen Blick zu, sie war eben taktvoll, ihre geliebte Kleine.
Nach dem Frühstück begann das Eiersuchen, wobei Oda immer wieder hellauf jauchzte. Sie blieb auch lustig und fidel, bis der Bruder Dienstag um die Mittagszeit anrief und die Schwester ins Schloß beorderte. Da zog sie wie ein begossenes Pudelchen ab, und mitleidig sahen die anderen ihr nach.
*
Obwohl die Baronin Swidbörn keine Sympathie besessen, hatte man sich zu ihrer Beisetzung zahlreich eingefunden. Man tat es ja auch wegen des Barons, der sich wiederum großer Beliebtheit erfreute. Und es gab unter den vielen Menschen nicht einen, der nicht das dachte, was Michel aussprach: Gott sei Dank, jetzt ist der arme Kerl endlich von seinem Kreuz erlöst.
Keiner machte Miene, dazubleiben, alle gingen sie still davon. Bis auf den einen, der den düsteren Gestalten nachsah und brummte:
»Taktvoll von den Leuten, nicht noch großartig einen Leichenschmaus zu verlangen. Danke Gott, Winrich, daß du all das Scheußliche hinter dir hast. Jetzt kannst du armer Kerl endlich aufatmen. Und nun kommt, damit ich endlich meinen Kognak kriege. Mir ist bei dem Zeremoniell mit allem Drum und Dran ganz schwiemelig um den Magen geworden.«
Sie stiegen die Freitreppe hinauf, durchquerten die riesige Halle, wo ihnen Niklas die Mäntel abnahm, und betraten ein kleines Gemach, dessen Einrichtung eigentlich nur aus Polstern und Teppichen bestand. Auf dem niederen Tisch zwischen der Sesselgruppe am Kamin summte die Kaffeemaschine, auf einer Platte lockten gute Happen und auf der beweglichen Bar standen vorzügliche Tropfen und Tabakwaren. Im Kamin prasselten die Scheite, deren lodernde Flammen mollige Wärme verströmten.
Mit einem Grunzer des Wohlbehagens ließ sich der Freund des Hausherrn in das weiche Polster sinken. Er bekam den ersehnten Kognak, den er hinunterkippte.
»Ah, das tut gut. Gib mir gleich noch einen, Winrich, damit ich das hubberige Gefühl los werde. Regnen mußte es natürlich auch noch. Na ja, bei so was mußte die Sonne sich wohl verkriechen.«
Nachdem man sich an den guten Happen und dem nicht minder guten Kaffee gelabt hatte, griffen die beiden Herren zur Pfeife, und Baroneßchen machte sich eifrig über das süße Gebäck her.
»Na, Fips, jetzt geht’s wieder, was?« besah sich der Freund des Hauses schmunzelnd das reizende Persönchen. »Standst in all der Düsternis so verängstigt da, wie ein verprügelter kleiner Hund.«
»Uwe, daß du es doch nicht lassen kannst, die Menschen mit Tieren zu vergleichen!« entrüstete sie sich, und er lachte.
»Dafür bin ich ja Viehdoktor, kleine Dame. Bei denen fängt der Mensch erst beim Tier an. Wie mir Winrich erzählte, bist du am Ostersonnabend ausgerückt und hast dich in dem Räubernest häuslich niedergelassen. Wie kamst du eigentlich dazu, fremde Menschen zu belästigen?«
Als er es wußte, sagte er kopfschüttelnd:
»Mädchen, du machst vielleicht Sachen. War es dir denn gar nicht peinlich, wildfremde Menschen einfach zu überfallen?«
»Schade, daß Hulda nicht da ist, die würde dir die passende Antwort geben.«
»Ist Hulda die Dienerin der beiden jungen Damen?«
»Dienerin? Laß das ja nicht Frauke hören. Hulda ist ihr das, was Barbe uns ist. Sie wird geliebt und verehrt, auch von Ortrun. Es sind alles liebe Menschen, die ich nicht angreifen lasse.«
»Wer sagt dir denn, daß ich es will, Baroneßchen?«
»Das tust du bei allen Frauen, weil du ein Frauenverächter bist.«
»Schau mal an, was das Küken nicht schon alles weiß, das noch die Eierschalen hinter den Öhrchen trägt.«
»Erlaube mal, ich bin sechzehn Jahre.«
»Respektables Alter. Nun sei mal nicht so grantig und erzähle uns von deinen neuen Freunden!«
»Pöh, du kennst sie ja gar nicht.«
»Früher als du.«
»Waaas?«
»Jetzt staunst du denn doch, nicht wahr?«
»Allerdings. Rasch, erzähle!«
Also erzählte er von der Begegnung im Bahnwagen, im Hotel, auf der Straße, wo die beiden jungen Damen in Begleitung des dorfbekannten Bertchens und des nicht minder dorfbekannten Hundes ihren Einkauf im Karren stolz nach Hause fuhren.
»Bis dahin hatte ich sie für frühe Feriengäste gehalten«, führte er weiter aus. »Doch als ich den Hund sah, da kam mir die Ahnung, daß es sich bei den jungen Damen nur um die Erbinnen des Professors handeln konnte. Kein gutes Erbe, das die Schwestern da angetreten haben.«
»Sie sind nicht Schwestern«, stellte Oda richtig. »Die Erbin ist Frauke allein. Sie nimmt sich Ortruns an, weil diese keine Eltern hat. Die Mutter bekam Herzschlag, als sie sehr erhitzt kopfüber ins eiskalte Wasser sprang, und da der Vater sich viel auf Reisen befand, löste er den Hausstand auf und gab seine einzige Tochter in das Elitetöchterheim, wo sie nach dem bestandenen Abitur entlassen wurde. Da nun indes auch ihr Vater gestorben war, kam sie in das Haus ihres Onkels und Vormunds, der sie nicht behalten konnte oder wollte. So nahm sich denn Frauke ihrer an. Das ist alles, was ich von Ortrun weiß. Höchstens noch, daß sie mit Nachnamen Danz heißt.«
»Danz?« horchte der Tierarzt auf. »Und er ist tot?«
»Ja. Wie mir Ortrun erzählte, wurde er in den Tropen von einem heimtückischen Fieber dahingerafft.«
»Dann kann es sich nur um den Mediziner Danz handeln, der sich um die ärztliche Wissenschaft sehr verdient gemacht hat. Sein Tod wurde äußerst bedauert und in den Tageszeitungen groß herausgebracht. Jetzt entsinne ich mich, daß auch der tragische Tod seiner Frau, einer fanatischen Sportlerin, erwähnt wurde. Gleichfalls seine Tochter, die sich in einem erstrangigen Institut befand.«
»Arme Ortrun«, sagte Oda mit schwankendem Stimmchen, und Uwe sah sie erstaunt an.
»Arm? Na, erlaube mal. Der muß ihr Vater einen gehörigen Batzen hinterlassen haben! Denn er galt allgemein für klotzig reich.«
»So meine ich das doch nicht«, winkte Baroneßchen ungeduldig ab. »Mit arm meinte ich, daß sie nicht viel von ihren Eltern gehabt hat, da die Mutter eine fanatische Sportlerin war und der Vater sich viel auf Reisen befand. Außerdem mußte sie mit vierzehn Jahren in ein strenges Internat.
Wieviel besser geht es dagegen mir, obwohl auch ich ein Waisenkind bin«, sprang sie spontan auf, hockte sie sich auf die Lehne des Sessels, in dem ihr Bruder saß und schmiegte ihr Blondköpfchen an sein gleichfalls blondes Haar. »Ich habe doch einen Bruder, der so lieb für mich sorgt.«
»Ist ja schon gut«, streichelte er zärtlich die weiche Wange. »Ich bin genauso froh, dich zu haben, mein kleiner Zeisig. Du hast mir in der schweren Zeit sehr geholfen.«
»Wirklich, Winrich? Das macht mich aber stolz. Ich bin doch nur ein dummes Ding.«
»Hört, hört!« schmunzelte der Tierarzt, der das Backfischchen doch gar zu gern neckte. »Da möchte ich fast den abgegriffenen Ausspruch von der Selbsterkenntnis anwenden.«
»Wenn dir nichts anderes einfällt, dann bitte sehr«, tat sie nonchalant ab. »Ich würde Winrich raten, sich einen andern Intimus anzuschaffen, da sein jetziger schon ziemlich abgegriffen ist.«
Da mußte selbst der ernste Bruder lachen, der bisher dem Gespräch sowie dem Geplänkel schweigend gefolgt war. Jetzt nahm er das Schwesterlein bei den rosigen Öhrchen.
»Mir scheint, Kleine, wir werden keck.«
»Uwe gegenüber auch angebracht. Ich muß mich doch meiner Haut wehren. Hulda sagt, man soll sich nie zuviel gefallen lassen, dann machen die Menschen mit einem, was sie wollen.«
»Diese Hulda scheint eine bemerkenswerte Persönlichkeit zu sein«, bemerkte der Bruder lächelnd, und die Schwester nickte eifrig.
»Ist sie auch. Alles, was sie sagt, hat Hand und Fuß.«
»Aha, Barbes Spezialausdruck.«
»Apropos Barbe! Ich muß ihr gleich von meinen Freundinnen ausführlich erzählen.«
Sie wippte ab, und Uwe sah forschend zu dem Freund hinüber, dessen Gesicht so hart und blaß war. Von der Nase bis zu den Mundwinkeln zogen sich tiefe Falten, die den Mann älter erscheinen ließen, als seine dreißig Jahre bedingten.
Die beiden Männer waren schon als Kinder unzertrennlich gewesen. Denn der Vater Uwe Gunders hatte als Pfarrer im Dorf amtiert, dessen Pfarrei unter dem Patronat des Baron von Swidbörn stand. Da nun Gunder seinem Sohn in den ersten Schuljahren Unterricht erteilte, bat ihn der Freiherr, es auch bei seinem Sohn zu tun, da die Knaben gleichaltrig waren.
Später kamen sie dann mit dem erforderlichen Wissen bestens ausgerüstet auf ein Gymnasium, wo sie das Abitur glänzend bestanden und danach studierten. Uwe wurde nicht Pfarrer, wie sein Vater es gern gesehen hätte, sondern Tierarzt, und Winrich absolvierte die landwirtschaftliche Hochschule. Dann kehrten die beiden Intimusse, die sich auch während der Studienzeit nie getrennt hatten, in die Heimat zurück, wo Winrich das Erbe seiner Väter verwaltete und Uwe nach der Approbation im Dorf die freiwerdende Tierarztpraxis übernahm. So blieben die Freunde nach wie vor unzertrennlich bis auf den heutigen Tag.
»Siehst miserabel aus«, brummte Uwe in die Stille hinein. »Pack deine Koffer, reise ab und laß man für eine Weile den lieben Gott einen guten Mann sein.«
»Aber nur, wenn du mitkommst«, entgegnete der Baron gelassen, was den andern hochgehen ließ.
»Ich, mitkommen? Ja, Menschenskind, wie denkst du dir das eigentlich. Ich kann doch unmöglich meine kranken Viecher so schnöde im Stich lassen.«
»Siehst du. Ich kann nämlich auch unmöglich das alles hier im Stich lassen. Zumal noch im Frühjahr, wo für den Landwirt die stramme Arbeit beginnt. Du weißt ganz genau, wie scharf ich auf Posten sein muß.«
»Da hast du auch wieder recht. Hm, ja, was ich noch sagen wollte – also Winrich, wenn du Geldschwierigkeiten hast, so will ich dir gern heraushelfen. Ich verdiene viel mehr, als ich bei meinem jetzt so bescheidenen Leben ausgeben kann. Außerdem waren meine Eltern nicht ganz mittellos, da mein Muttchen ein stattliches Heiratsgut mit in die Ehe bekam. Als sie ihre lieben Augen schloß, konnte sie ihrem Einzigen nett was hinterlassen. Wenn du also Geld brauchen solltest, es trifft ja keinen Armen.«
»Danke«, entgegnete der Freund einfach. »Ohne weiteres nehme ich deine Hilfe an, wenn es erforderlich sein sollte. Ich hoffe jedoch, daß ich auch ohne sie auskommen werde. Ich konnte in diesem Quartal glatt meinen Verpflichtungen gerecht werden, obgleich Olas Krankheit mir sehr teuer zu stehen kam.«
»Sei froh, daß du sie los bist«, knurrte der sonst so warmherzige Uwe. »Oder geht dir ihr Tod etwa nahe?«
»Ich würde heucheln, wollte ich diese Frage bejahen. Ich hätte mich jedoch lieber von einer gesunden Frau durch Scheidung getrennt. Dazu wäre ihr Tod wirklich nicht nötig gewesen.«
»Den sie selbst verschuldet hat«, blieb der Freund ungerührt. »Soviel ich weiß, hast du sie oft genug vor der verrückten Autoraserei gewarnt.«
»Daher brauche ich mir jetzt keinen Vorwurf zu machen. Ihr Schicksal hat sich erfüllt, dagegen ist der Mensch machtlos. Wer weiß, was es für uns noch alles in Bereitschaft hält.«
»Ja, das kann man nie wissen. Aber ich meine, daß wir beide durch unsere miserablen Ehen schon manches abgebüßt haben, da dürfte das liebe Geschick uns nicht mehr ganz so ungnädig sein. Nun gehab dich wohl, die Pflicht ruft. Mach’s gut, mein alter Kampf- und Streitgenosse. Bleib sitzen, brauchst mir nicht das Geleit zu geben. Ich bin ja hier zu Hause.«
Als er im Wagen Platz genommen hatte, kam Barbe durch die Anlagen, die das Schloß von dem riesigen Wirtschaftshof trennten. Ein zierliches Persönchen mit glattem Scheitel und freundlichem Gesicht. Eigentlich sah sie harmlos aus, aber es war nicht ratsam, die Harmlosigkeit durch ein Vergehen auf die Probe zu stellen. Der bekam ihr strenges Regiment, das sie im Schloß führte, empfindlich zu spüren. Wer seine Pflicht tat, der hatte es gut. Wer sie vernachlässigte, hatte keine Nachsicht zu erwarten.
Als die den Tierarzt bemerkte, strahlte sie über das ganze Gesicht und ging eilig auf das Auto zu. Natürlich zählte sie ihn ganz zur Familie, der schon als Knabe im Schloß ein und aus gegangen war.
»Jetzt ist endlich alles überstanden, Barbe«, sagte er leise. »War’s in der letzten Zeit sehr arg?«
»Es war immer arg«, verschwand das Lachen und machte einem verbissenen Ausdruck Platz. »Wie der Teufel den Herrn Baron und das Baroneßchen gepeinigt hat, das war nicht mehr menschenmöglich. Jetzt ist sie tot, und wir haben endlich Ruhe vor ihr. Sie werden doch oft nach meinem Herrn sehen, Herr Doktor?«
»Ehrensache, Barbe. Wo steckt übrigens Oda?«
»Sie ist nach unten gelaufen, wo man sich so liebreich ihrer annahm, als sich keiner um sie hier kümmern konnte. Mag das Kind da fröhlich sein; denn bei uns gibt es vorläufig noch nichts zu lachen. Und ich weiß nicht, ob es das hier überhaupt noch jemals geben wird.«
»Dafür laß nur den lieben Gott und den Uwe sorgen«, sagte er zuversichtlich, nickte ihr herzlich zu und fuhr ab. Den breiten Kiesweg entlang, durch das breite, schmiedeeiserne Tor, durch die Allee auf die Asphaltchaussee. Dort bog er rechts ab, fuhr eine kurze Strecke geradeaus und nahm dann vorsichtig die Kurve, die wieder rechtsab auf eine gutgehaltene Kiesstraße führte. Ein großes Schild machte darauf aufmerksam, daß es ein Privatweg wäre, der nur von Anliegern benutzt werden durfte. Er führte zum Ausgang des Dorfes und man ersparte auf ihm mindestens vier Kilometer.
Das Schloß war auf einem Plateau erbaut. Die Vorderfront lag zur ebenen Erde und war durch Anlagen von dem Gutshof getrennt, die Rückfront von einem herrlichen Park umschlossen. Wo er endete, begann sich der Boden allmählich zu senken bis hinab ins Tal. Der Abhang war mit üppigem Grün bewachsen, durch das sich ein Pfad schlängelte.
Es war ein prächtiger Bau, das Stammschloß der Reichsbarone von Swidbörn, fest gefügt, wie für die Ewigkeit erbaut. Der es tat, war der reichste Mann weit und breit gewesen. Konnte es sich daher leisten, das teuerste Material zu wählen und den berühmtesten Baumeister seiner Zeit zu beschäftigen, ebenso den besten Architekten. Die beiden Männer gaben ihr Bestes her, schufen innen wie außen Prunk und Glanz. Den Park legte der beste Gartenexperte an, also kein Wunder, daß hier wie da ein Meisterwerk entstand, das Jahrhunderte ehern überdauerte.
Auch die Nachfahren waren reich gewesen, hatten gut gelebt, ohne dabei zu verschwenden. Damit hätten erst die beiden vorletzten Swidbörn begonnen, was der Enkel und Sohn jetzt büßen mußte.
Selbst bei der Heirat, durch die er den gefährdeten Besitz zu sanieren gedachte. Statt dessen hatte er ihn immer mehr belasten müssen. Also hatte wieder einmal der Volksmund recht, der da sagte: Blinder, tu die Augen
auf, Heirat ist kein Pferdekauf.
*
Geschickt lenkte der Tierarzt seinen schmucken Wagen von dem Privatweg in die Dorfstraße und fuhr langsam an dem vom Herrn Gemeindevorsteher verächtlich bezeichneten Haus vorbei, das jetzt ein gepflegter Vorgarten von der Straße trennte. Gunder war in den vergangenen Wochen hier nicht vorbeigekommen. War, wenn er ins Schloß wollte, die andere Straße gefahren, weil er immer dort in der Nähe zu tun hatte. Nun staunte er nicht wenig, was aus dem düsteren, verwahrlosten Anwesen geworden war. Es sah direkt einladend aus. Schien dem Beschauer zu winken: Komm, tritt ein, bei mir wohnt der Frohsinn und das Lachen.
Und das stimmte, es wurde hier viel und herzlich gelacht. Warum auch nicht? Sie hatten ja nichts auszustehen, die hier wohnten. Hatten ein schönes Zuhause, ein gutes Auskommen, waren gesund und harmonierten prächtig miteinander. Aus der scheuen, verschlossenen Ortrun Danz war ein frischfröhliches Menschenkind geworden, das sich ein schöneres Leben gar nicht denken konnte.
Daher traf es sie wie ein grausamer Schlag, als an einem Sonntagvormittag das Ehepaar Danz mit Tochter nebst Schwiegersohn erschien, um Ortrun abzuholen. Todblaß, mit schreckgeweiteten Augen stand das Mädchen da. Wich wie entsetzt vor dem Onkel zurück, der es mit väterlicher Umarmung begrüßen wollte. Das nahm Ajax übel, der das liebe Frauchen bedroht glaubte und knurrend sein gefährliches Gebiß zeigte. Hulda nahm ihn beim Halsband, zog ihn in die Küche, und Ortrun lief einfach davon.
»Ja, was hat sie denn?« fragte Danz ärgerlich. »Warum läuft sie denn vor uns davon. Das ist doch keine Art für einen wohlerzogenen Menschen.«
»Kommen Sie bitte erst einmal weiter«, sagte Frauke, welcher der Auftritt peinlich war. »Dann werde ich Ihnen das sonderbare Benehmen Ortruns erklären.«
Sie führte die Gäste in den Salon, wo man in den brokatüberzogenen Sesseln Platz nahm, steif und reserviert, bis auf den Arzt. Eine mittelgroße, stämmige Erscheinung, mit einem offenen, gutmütigen Gesicht. Als Frauke fragte, ob sie eine Erfrischung anbieten dürfte, sagte er frei heraus:
»Einen Schnaps, gnädiges Fräulein, den ich als Fahrer nicht trinken durfte bei dem kleinen Imbiß, den wir unterwegs einnahmen. So bin ich denn satt aber durstig.«
»Den Durst können Sie gleich stillen, Herr Doktor«, entfernte sie sich, und Frau Danz sagte ärgerlich:
»Wenn ich gewußt hätte, daß Ortrun uns so empfangen würde, wäre ich gar nicht mitgekommen.«
»Ich auch nicht«, bekräftigte die Tochter, ein hübsches, etwas molliges Persönchen. »Am liebsten möchte ich gleich wieder aufbrechen.«
»Na, nun mal langsam!« sagte der Gatte pomadig. »Warten wir erst mal ab, bis die charmante junge Dame uns die Ungezogenheit des kleinen Mädchens erklärt hat.«
Was Frauke denn auch tat, nachdem sie die Gäste mit einer Erfrischung versorgt hatte. Sie gab sich gewissermaßen einen Ruck und sprach dann freiweg:
»Ich kann mir denken, wie befremdet Sie über Ortruns Betragen sind. Aber als sie hörte, daß sie mit Ihnen kommen sollte, ließ das sie kopfscheu werden.«
»Ja, warum denn in aller Welt«, entgegnete der Notar ungehalten. »Es war doch ausgemacht, daß Ortrun nur solange hier bleiben sollte, bis die Gefahr mit dem Zerkel vorüber war. Und die ist jetzt vorüber. Er hat sich vor ein paar Tagen verlobt, nachdem er von Ortrun nichts zu erwarten hatte. Das habe ich ihm ausdrücklich klargemacht, als er bei mir erschien, um bei mir um das Mädchen anzuhalten. Ich habe ihn ganz nett abgeblitzt. Weiß Ortrun übrigens, warum ich sie Ihnen damals mitgab, Fräulein Frauke?«
»Ja, Herr Doktor, ich habe es ihr kürzlich erzählt.«
»Und was sagte sie darauf?«
»Daß sie dem Zerkel dankbar wäre. Denn ohne ihn wäre sie nicht hierher gekommen, wo sie sich glücklich fühlt. Darum war sie so verstört, als Sie plötzlich erschienen, um sie abzuholen.«
»Ach so ist das«, brummte der Notar besänftigt. »Und was machen wir nun?«
»Sie hierlassen«, bemerkte der Schwiegersohn trocken. »Damit ersparst du dir Ärger und Verdruß.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Ganz einfach, Papa. Wenn du die Kleine zwingen würdest, in dein Haus zurückzukehren, würde sie dir wohl folgen, aber sehnsüchtig auf den Tag warten, wo sie mündig wird. In gleicher Stunde liefe sie dir dann davon an den Ort ihrer Sehnsucht. Habe ich recht, gnädiges Fräulein?«
»Und wie, Herr Doktor.«
»Na also. Ich kann das kleine Mädchen verstehen, daß es sich hier so wohlfühlt, ich täte es auch.«
Da mußte man lachen, prostete sich zu, und schon wurde es gemütlich. Frau Danz und ihre Tochter, die viel auf Äußerlichkeiten gaben, ließen immer wieder ihre Blicke verstohlen umherschweifen. Doch den Salon mit den kostbaren Möbeln und dem Stutzflügel in Weiß und Gold, durch die weitgeöffnete Flügeltür, die einen Teil des Speisezimmers freigab, während man durch die gegenüberliegende Tür in die Bibliothek schauen konnte. Doch während die beiden Damen das alles schweigend in sich aufnahmen, sprach der Notar das aus, was sie dachten:
»Ich muß schon sagen, Fräulein Frauke, daß ich mir Ihr geerbtes Haus denn doch anders vorstellte. Das ist ja wie ein Schmuckkästchen.«
»Jetzt, Herr Doktor. Aber als wir herkamen…«
Und sie erzählte, wie sie alles vorgefunden hatten. Wie sie sich keine Mühe verdrießen ließen, aus dem »Schandfleck« das schmuckste Anwesen des Dorfes zu machen. Immer wieder hob sie Michel lobend hervor, ohne den alles wohl nicht so gutgegangen wäre. Sie sprach auch über den Professor, seinen Diener, und höchst interessiert hörten die andern zu. Dann fragte der Notar:
»Und bei alledem hat Ortrun mitgeholfen?«
»O ja. Man kann schon sagen, daß sie mit Leib und Seele dabei war. Daher hängt sie ja auch an allem hier so sehr, fühlt sich hier glücklich und geborgen. Wenn sie fort müßte, ich glaube, ihr würde vor Jammer das Herz brechen.«
»Das will ich ja nun nicht«, zog der Notar unbehaglich die Schultern hoch. »Also mag sie weiter hier bleiben. Wer weiß, wozu das gut ist.«
*
Frauke erschien in der Küche, wo Ortrun saß und ihr aus dickverweinten Augen entgegensah. Hulda hantierte am Herd, und die Töpfe bekamen ihren Grimm zu spüren. Jetzt ließ sie davon ab, legte die Hände in die Hüften und legte los:
»Das sage ich dir, Frauke. Wenn du zuläßt, daß sie unser Kind mit sich schleifen, dann sind wir geschiedene Leute.«
»Ist dir nun wohler?«
»Schäm dich mal, über etwas zu lachen, worüber sich andere die Augen aus dem Kopf weinen. Das Kind bleibt hier!«
»Aber ja doch, Huldchen, da brauchst du doch nicht so zu schreien. Ortrun bleibt hier, und zwar mit Genehmigung ihres Vormunds.«
»Ist das auch wirklich wahr?«
»Wahr und wahrhaftig. Doktor Danz hat nämlich eingesehen, daß Ortrun hier schon mit allem viel zu fest verwachsen ist, als daß man sie losreißen könnte. Das würde nur Herzwunden geben und zu nichts weiter als zu gegenseitiger Erbitterung führen.«
»Dann ist ja alles in Ordnung«, wandte Hulda sich wieder ihren Töpfen zu, in denen es brodelte und brutzelte. »Kannst deine Gäste zu Mittag einladen, es ist genug von allem da.«
»Kann ich auch beruhigt sein, daß du nicht Arsenik in die Speisen mischst?« fragte Frauke lachend.
»Jetzt nicht mehr, jetzt ist die Gefahr vorüber.« Sprachs und hantierte hurtig weiter, während Frauke sich Ortrun zuwandte und weich über das wunderschöne Haar strich, das wie Bernstein gleißte und naturgewellt zwanglos über den Nacken fiel. Eine Zierde, die fast einmalig war.
»Du Dummes«, sagte Frauke zärtlich. »Wie kann man nur so das Köpfchen verlieren. Komm mit und entschuldige dich bei den Verwandten wegen deiner Ungezogenheit. Denn ungezogen war es, einfach davonzulaufen.«
»Darf ich auch wirklich hierbleiben, liebe Frauke?«
»Du darfst, mein Herzchen.«
»So will ich mich gern entschuldigen.«
Wenig später stand sie dann vor dem Vormund und sagte verlegen:
»Verzeihung, Onkel Rudolf, daß ich so ungezogen war.«
»Schon gut«, winkte er kurz ab. »Ich weiß ja jetzt, warum es geschah. Wenn du durchaus willst, dann bleib hier.«
»Danke!« strahlte es jetzt in den verweinten Augen auf, wie Sonnenschein durch eine Nebelschicht. »Jetzt bin ich wieder froh. Darf ich auch ein Glas Wein haben, Frauke, damit ich meine Verwandten in unserm lieben Haus willkommen heißen kann?«
»Da sehen Sie, meine Herrschaften, daß unser Kind, wie Hulda es nennt, auch höflich sein kann«, lachte Frauke. »Komm her, mein Schatz, proste mit mir zusammen auf unsere lieben Gäste.«
Die Gläser gaben guten Klang, und der Friede ward geschlossen. Nun konnte der Arzt auch auf das zu sprechen kommen, was ihm am Herzen lag.
»Sagen Sie mal, gnädiges Fräulein, ist Ihnen hier im Dorf ein Tierarzt Doktor Gunder bekannt?«
»Direkt bekannt nicht«, gab Frauke Antwort. »Ich bin ihm einmal auf der Dorfstraße begegnet und die Frau unseres Faktotums, die sich in meiner Begleitung befand, hat so allerlei von dem Herrn erzählt. Aber offen gestanden ging es in ein Ohr rein durchs andere raus. Tatsache jedoch ist, daß er im Dorf eine gutgehende Praxis hat.«
»Danke, gnädiges Fräulein, diese Antwort allein ist schon wertvoll für mich. Gunder ist nämlich mein Vetter zweiten Grades, mit dem ich öfter einmal zusammenkam, als unsere beiderseitigen Eltern noch lebten. Dann jedoch haben wir jahrelang nichts mehr voneinander gehört. Er sprach schon immer davon, in seinem Heimatdorf, an dem er sehr hängt, eine Praxis zu gründen, was er dann auch wahrmachte. Übrigens muß sein bester Freund, ein Baron von Swidbörn, in Ihrer Nähe wohnen, gnädiges Fräulein.«
»Das ist mein Bruder«, kam es von der Tür her, wo Oda stand, entzückend anzuschaun in dem lichtblauen Kleidchen und den langen blonden Zöpfen. Die blauen Augen hingen überrascht an den Gästen des Hauses.
»Ich hatte keine Ahnung, daß ihr Besuch habt«, sagte sie zögernd. »Da möchte ich nicht stören.«
»Seit wann bist du denn so ängstlich«, neckte Frauke. »Tritt nur tapfer näher und laß dich bekannt machen mit Ortruns Verwandten.«
Nachdem es geschehen war, nahm Oda in der Runde Platz und sagte artig zu dem Arzt:
»Verzeihung, Herr Doktor, darf ich wissen, warum Sie vorhin meinen Bruder erwähnten?«
»Gewiß, Baroneß. Es geschah im Zusammenhang mit dem Tierarzt Doktor Gunder.«
»Mit Uwe?« riß sie nun überrascht ihre ohnehin schon großen Augen auf. »Kennen Sie ihn denn?«
»Er ist ein Vetter von mir, den ich gern sprechen möchte.«
»Das kann ich vermitteln«, wurde die Kleine nun eifrig. »Er befindet sich gerade bei uns. Soll ich ihm telefonisch Bescheid sagen, Herr Doktor?«
»Das wäre lieb, Baroneß. Mag er einen Ort bestimmen, wo wir uns treffen können.«
»Aber nicht vor dem Essen«, schaltete Frauke sich ein und ließ den Protest der Gäste nicht gelten.
»Aber meine Herrschaften, wer soll das alles wohl essen, was Hulda mit Eifer vorbereitet.«
»Wenn es so ist, denn ja«, schmunzelte der Arzt. »Dann werden Sie mich aber vor zwei Uhr nicht los, gnädiges Fräulein. Ich bin es nämlich gewohnt, nach dem Essen in Beschaulichkeit meinen Mokka zu trinken.«
»Sollen Sie auch hier tun. Was soll die Baroneß nun Doktor Gunder bestellen?«
»Daß ich ihn um zwei Uhr in einem Lokal, das er bestimmt, sprechen möchte.«
Und dann wurden sie Ohrenzeuge eines Gesprächs, das sie durchweg schmunzeln ließ. In der Diele telefonierte Oda und zwar so lebhaft, daß man im Salon jedes Wort verstand.
»Ach du bist es, Niklas. Beordere möglichst schnell Doktor Gunder an den Apparat.«
Einige Minuten Stille und dann ein entrüstetes Stimmchen:
»Du, werde hier gefälligst nicht frech! Es gibt Wichtigeres, als dir eine Liebeserklärung zu machen. Lach nicht, hör lieber gut zu! Doktor Folbe, ist dir das ein Begriff, ja? Das ist gut, da brauche ich nicht erst lange Vorreden zu halten. Der Herr Doktor ist hier und möchte dich sprechen. Wo er ist? Bei Frauke natürlich, wo denn sonst? Gib einen Ort an, wo ihr euch treffen könnt. Aber doch nicht mit Frauke, mit Herrn Doktor Folbe. Die ›Grüne Gans‹, ja, die ist anständig, da kannst du mit ihm hingehen. Also Uwe, wenn du jetzt immer noch so albern lachst, dann… Ach, ich weiß auch nicht. Aber nicht vor zwei Uhr, hörst du? Herr Doktor Folbe muß erst noch mittagessen. Jawohl, hier. Weil Frauke die ›Grüne Gans‹… Du, jetzt wird es mir aber zu bunt, jetzt mach ich Schluß!«
Damit legte sie den Hörer unsanft ab und ging in den Salon zurück, wo man sich vor Lachen schüttelte.
»Ja, was ist denn hier los?« fragte Baroneßchen kopfschüttelnd. »Was gibt’s denn hier so unbändig zu lachen?«
»Über dein Telefongespräch«, wischte Frauke sich die Augen. »Nett von dir, mich als grüne Gans zu bezeichnen.«
»Dich? Na hör mal, Frauke…«
»Ist ja schon gut, mein Firlefänzchen. Hoffentlich ist Herr Doktor Gunder aus deiner Bestellung klug geworden.«
»Nun, ich habe mich doch wohl klar genug ausgedrückt. Horch mal, Ortrun, ich glaube, Hulda morst.«
Sie lauschten dem Klopfzeichen, das sich dreimal wiederholte, worauf Ortrun ins Speisezimmer eilte, wo sie in einem andern Rhythmus an die Durchreiche pochte, während Oda die Flügeltür schloß.
»Ja, ja, die Mädchen sind von Hulda gut gedrillt«, lachte Frauke. »Was sie da morste, bedeutet: Tischdecken – und was Ortrun zurückmorste: Verstanden.«
»Dabei macht die Baroneß immer mit?« fragte Frau Danz ungläubig.
»Gern sogar. Sie weilt oft bei uns, weil sie hier alles findet, was so ein junges Menschenkind braucht: Frohsinn und Lachen. Denn oben im Schloß…«
Sie schilderte die Verhältnisse dort und auch, wie Oda ins grüne Haus kam.
»Dann hat Baron Swidbörn in seiner Ehe genauso ein Fiasko erlitten wie sein Intimus Uwe Gunder«, sagte der Arzt. »Nur daß letzterer wahrscheinlich nicht lange fackelte, sondern seinen ›Reinfall‹ zum roten Kuckuck jagte, während erster ihn am Hals behalten mußte, bis der Tod Einsehen mit ihm hatte. Klingt für Damenohren herzlos, nicht wahr? Aber Papa und ich, die mit solchen Kanaillen zu tun haben, wissen ein Liedchen von ihnen zu singen.«
»Kann man wohl sagen«, bestätigte der Notar. »Es gongt, Fräulein Frauke. Wollen Sie uns nun wirklich…?«
»Um nein zu sagen, dafür ist es zu spät«, ließ sie ihre Grübchen spielen. »Ich versichere Ihnen, daß wir alle satt werden.«
Und wie satt sie wurden, denn das Mahl war gut und reichlich. Den Mokka trank man in der Bibliothek, die von dem Kaminfeuer wohlig durchwärmt wurde. Auf dem Sims tickte klingend eine alte Uhr. Darüber hing ein Porträt in schwerem Goldrahmen, das sofort die Blicke auf sich zog.
»Das ist Professor Gortz«, erklärte Frauke leise. »Mein Wohltäter. Diese Bezeichnung verdient er zu Recht. Denn alles, was ich jetzt bin und habe, geschah durch ihn. Wir fanden dieses wundervolle Bild in einer Kammer, verstaubt und verschmutzt. Es hat Mühe gemacht, es aufzufrischen. Aber seinem Bild einen Ehrenplatz zu geben, sowie sein und seines treuen Dieners Grab zu pflegen, ist ja leider alles, was ich tun kann. Außerdem noch Grabmäler setzen lassen.
Übrigens fällt mir jetzt wieder ein, worum ich Sie befragen wollte, Herr Doktor Danz. Doch zuerst bitte ich, es sich bequem zu machen.«
Das tat man in den tiefen, weichen Sesseln am Kamin. Und während die beiden Mädchen die Mokkatäßchen füllten, trat Frauke an den wuchtigen Schreibtisch, der dieselbe Schnitzerei aufwies wie der große Schrank. Zwei Wände deckten hohe Regale, die mit Büchern aller Art vollgestopft waren. Der helle Teppich, die duftigen Gardinen und einige bunte Bilder sorgten dafür, daß dieses Gemach mit den dunklen Möbeln nicht zu düster wirkte.
Das Schreiben, das Frauke der Schreibtischschublade entnahm, reichte sie dem Notar.
»Wollen Sie bitte das da mal lesen, Herr Doktor.«
Als er es getan hatte, sagte er sachlich:
»Den Brief überlassen Sie am besten zur Beantwortung mir, Fräulein Frauke. Denn was dieses Fräulein Jadwiga von Schlössen von Ihnen so höflich erbittet, ist wohl menschlich verständlich, jedoch gesetzlich unzulässig. Als sie der Gattin des Professors fünftausend Mark ließ, die sie nie zurückbekam, ging den Herrn das nichts mehr an, da er bereits geschieden war. Daß sie das Geld, welches er ihr schroff abschlug, nun von seiner Erbin haben möchte, zeugt entweder von Naivität oder Unverfrorenheit. Nun, ich werde diese peinliche Angelegenheit für Sie schon in Ordnung bringen, Fräulein Frauke.«
»Danke, Herr Doktor, da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen.«
Das Schrillen des Fernsprechers ließ sie innehalten. Hulda, die sich gerade in der Diele befand, nahm das Gespräch entgegen und erschien gleich darauf in der Bibliothek.
»Herr Doktor Gunder läßt Herrn Doktor Folbe sagen, daß er in der »Grünen Gans« auf ihn wartet. Er möchte viel Zeit und viel Durst mitbringen.«
»Danke, Fräulein Hulda«, nickte der Arzt ihr zu und erhob sich von seinem behaglichen Sitz. »Bitte mich zu entschuldigen, ich bin bald wieder da.«
»Hoffentlich«, entgegnete der Schwiegervater skeptisch. »Tu es ja nicht, was der Viehdoktor von dir verlangte. Denn du hast keine Zeit, und Durst darfst du nicht haben. Wir wollen nämlich, wie vereinbart, heute noch nach Hause fahren.«
»Worauf du duch verlassen kannst, verehrter Schwiegerpapa. Also denn auf bald!«
*
Doktor Folbe schien ein Mann von Wort zu sein. Denn zwei Stunden später kam er zurück und fand noch Anschluß am gemütlichen Kaffeeplausch. Dankend nahm er die Tasse aus Fraukes Hand und sagte vergnügt:
»Ein Segen, daß es für den Autolenker wenigstens etwas Trinkbares gibt, das ihm schmeckt. Zwar meinte Uwe, daß ein Kognak nicht schaden könnte, aber ich habe ihn mir lieber verkniffen.«
»Wie war die Begegnung mit deinem Vetter?« erkundigte sich der Schwiegervater. »Hat sie dich enttäuscht, was ja oft der Fall ist, wenn man sich nach Jahren wiedersieht, in denen der Mensch sich zu verändern pflegt?«
»Uwe aber nicht. Er ist der liebe, nette Kerl geblieben. Wie eine Frau einem so herzensguten Mann davonlaufen kann, ist einfach ein Rätsel.«
»Hat ihn das sehr verbittert und womöglich zum Frauenverächter gemacht?«
»Zwei Fragen in einem Satz, Papachen. Unrentabel für einen Anwalt, der sich jeden Satz einzeln bezahlen läßt.«
»Sei bloß still, du Schlingel. Die Herren Ärzte sind nämlich auch nicht so ohne.«
»Na schön, streiten wir uns nicht«, meinte er friedfertig. »Komme ich zur Beantwortung deiner ersten Frage: Nein, Uwe ist gar nicht verbittert. Er betrachtet diese Ehe als Episode, die nicht bis ans Herz reichte. Zum Frauenverächter ist er auch nicht geworden. Er erklärte in seiner vergnügten Art: Wenn ein paar Äppel faul sind, braucht es nicht gleich der ganze Äppelkahn zu sein.«
»Bravo«, schmunzelte Danz. »So ist er nicht abgeneigt, eine zweite Ehe einzugehen?«
»Nein. Er wird jedoch, wie er sagte, bei der zweiten Wahl nicht blindverliebt die Augen zukneifen, sondern sie weit aufreißen. Wird das Trommelfell nicht verkleben, sondern wachsam die Ohren spitzen.«
»Scheint ein prachtvoller Mensch zu sein«, meinte Frau Danz. »Schade, daß ich ihn nicht auch kennengelernt habe.«
»Das wirst du schon noch, Muttchen.« Wir haben nämlich vereinbart, uns nicht wieder aus den Augen zu verlieren. Er mußte mir versprechen, jedesmal bei uns einzukehren, wenn er in der Stadt zu tun hat, was gar nicht mal selten der Fall ist. Er hat zur Zeit keine eigene Wohnung. Hat nach der Scheidung sein Haus in Bausch und Bogen verkauft und nur die Sachen behalten, die ihm von seinem Elternhause lieb und wert sind. Den andern Kram, wie er sich ausdrückte, mochte er nicht mehr sehen, weil er ihn an seine ›Selige‹ erinnerte. Jetzt wohnt er in dem kleinen Haus einer Witwe, wo er zwei Zimmer mit den ihm lieben Sachen möbliert hat. Seine Praxis befindet sich auf dem Marktplatz, also im Zentrum des Dorfes.«
»Geht die Praxis gut?«
»Ja, Papa, sehr gut sogar, Uwe hat so viel zu tun, daß es ihm leid tat, als der Tierarzt, der sich im Dorf als zweiter niederließ, schon nach wenigen Monaten seine Praxis aufgab, weil er so gut wie nichts zu tun hatte. Die Leute aus dem Dorf und des weitverzweigten Kreises wollten keinen für ihre erkrankten Tiere haben als ›Pfarrersch Jung‹, wie er allgemein genannt wird. Die Alten haben ihn aufwachsen sehen, die Gleichaltrigen sind mit ihm großgeworden, und die Jüngeren hören sein Loblied singen. Die Landbevölkerung ist eben konservativer als die Stadtbevölkerung, die andern hängen am Althergebrachten.
Und nun, meine Lieben, so gemütlich es hier auch ist, wir müssen dennoch aufbrechen, damit wir nicht zu spät nach Hause kommen. Außerdem wird die Dame des Hauses froh sein, die Invasion loszuwerden.«
»Meinen Sie?« ließ Frauke ihre Grübchen sehen, die der Arzt reizend fand. Überhaupt die ganze charmante Persönlichkeit. Da wird wohl ihr schmuckes Heim nicht lange unbemannt bleiben. Denn die Herren der Schöpfung haben ja Augen im Kopf und ein Herz unter der Weste. Mit herzlichem Dank schieden die Gäste, und die Zurückbleibenden winkten dem abfahrenden Auto nach.
»Schade, daß sie fort sind«, seufzte Oda. »Ich habe mich in den Arzt verliebt.«
»Mädchen, du bist wohl nicht recht gescheit!« war Frauke denn doch verblüfft über das freimütige Geständnis. »Der Mann ist verheiratet, und du trägst noch die Eierschalen hinter den Öhrchen.«
»Na wenn schon«, winkte die Kleine nonchalant ab und zitierte pathetisch: »Ist denn Liebe ein Verbrechen, darf man denn nicht zärtlich sein? Wenn ich nur wüßte, was Liebe ist.«
»O du Kindskopf!« lachte Frauke hell heraus. »Das weiß ich ja noch nicht einmal, obwohl ich sieben Jahre älter bin als du.«
Und damit sprach sie die Wahrheit. Noch war ihr Herz unberührt geblieben von der vielgepriesenen Liebe. Von dem Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Aber locker saß Amors Pfeil. Verschmitzt lachte der listige Bursche in sich hinein.
Warte nur, balde…
*
Am Sonntag darauf erschien Baron von Swidbörn in Begleitung Odas im grünen Haus, um sich für die herzliche Gastfreundschaft zu bedanken, die man seiner Schwester angedeihen ließ. Er wirkte direkt einschüchternd, als er so dastand, sehr ernst, sehr vornehm. Man hatte den Eindruck, als ob
der hartgeschnittene, herrische Mund sich zu keinem freundlichen Lächeln verziehen könnte, höchstens zu einem verächtlichen, sarkastischen, als ob die sehr hellen blauen Augen nie lachend aufblitzen könnten. Ein blendend aussehender Mann, aber einer, dem man gern aus dem Wege ging. Nur Oda tat das nicht. Sie zog den distinguierten Herrn von der Schwelle fort in das Zimmer hinein und sagte lachend:
»Mir scheint fast so, als ob du Angst hättest, Win.«
»Wahrscheinlich, du Frechdachs«, schwang die Stimme jetzt wie eine dunkeltönende Glocke, die aber auch anders klingen konnte, hart wie klirrendes Metall. Wen die traf, dem war bestimmt nicht wohl in seiner Haut.
»Das ist mein Bruder Winrich«, sagte Oda stolz. »Und das sind Frauke und Ortrun.«
»Darfst du die jungen Damen denn so vorstellen?« fragte er mahnend, und da lief das Gesichtchen rot an.
»Verzeihung. Also, dann so: Baron von Swidbörn – Fräulein Gortz – Fräulein Danz. Und das ist Ajax, der Schäferhund. Gibst du dem Herrchen eine Gutentagpfote? Tatsächlich, er gibt. Darauf kannst du dir etwas einbilden, Winrich.«
»Bist du nun endlich fertig, du kleine Plaudertasche? Ja? So kann ich denn endlich die Damen begrüßen. Gnädiges Fräulein, wie ist es nur möglich, daß Sie diese kleine Plappermühle so viel um sich haben können. Fällt sie Ihnen denn nicht auf die Nerven?«
»Keineswegs, Herr Baron«, entgegnete Frauke lachend. »Unsere Mühlen sind auch ganz nett in Betrieb. Wollen Sie nicht Platz nehmen?«
»Wenn ich darf, gern.«
Odas Zünglein war heute ganz besonders flink. Es regte sich hurtig, plapperte und schwatzte, und als der Bruder endlich zu Wort kommen konnte, bedankte er sich für die herzliche Aufnahme, die seine Schwester in diesem Hause fand. Sprach jedoch auch die Befürchtung aus, daß ihre täglichen Besuche auf die Dauer lästig fallen könnten.
»Das wird nie geschehen, Herr Baron«, beruhigte Frauke ihn. »Wir mögen Oda gern, betrachten sie als zu uns gehörig.«
»Na also«, triumphierte die Kleine. »Das habe ich dir doch immer wieder gesagt, aber du willst nie auf mich hören. Und dabei bin ich für meine Jahre viel zu verständig, sagt Barbe. findest du das nicht auch, Frauke?«
»Aber natürlich. Denn alles, was Barbe sagt, hat Hand und Fuß«, entgegnete sie ernsthaft, während ihre Augen lachten und die Grübchen schelmten. Überhaupt ihre ganze Art hatte etwas ungemein Gewinnendes, Herzliches, was den Besucher sofort für sie einnahm. Jetzt konnte er auch verstehen, daß seine Schwester an ihr hing. Daß es sie hinzog aus der prunkhaften Kälte des Schlosses in die Traulichkeit dieses Hauses, das eine Seele hatte, wie man so sagt. Und diese Seele konnten ihm nur die Bewohner geben.
Aus diesem Gedankengang heraus sagte der Mann mit leichtem Lächeln:
»Es ist kaum zu fassen, was Sie aus diesem Gespensterhaus, wie unser Barbe es bezeichnete, gemacht haben, gnädiges Fräulein. Jedesmal, wenn ich hier vorüberkam, um ins Dorf zu gelangen, empfand ich ein Gruseln, zumal die Bewohner in mysteriöser Abgeschiedenheit lebten. Das heißt, als der Professor das Anwesen erwarb, machte es nicht den düsteren Eindruck. Da brachten zwei lebenslustige Menschen, Mutter und Tochter, Lachen und Frohsinn hinein. Als das entschwand, nahm es mit sich das Herz des Mannes.«
»Bitte nicht«, schwankte ein Stimmchen dazwischen. »Sonst muß ich weinen. Und das tu ich doch so ungern.«
»Das tut wohl keiner gern, du Schäfchen«, streichelte er leicht über das gesenkte Blondköpfchen. »Gehen wir, ich habe meinen Besuch schon über Gebühr ausgedehnt. Nochmals Dank, gnädiges Fräulein, daß Sie sich so lieb Odas annehmen. Ich kann Sie leider nicht um Ihren Besuch bitten, da mein Haus ohne Repräsentantin ist. Daher kann ich mich für die Gastfreundschaft, die Sie meiner Schwester so großherzig gewähren, nicht revanchieren.«
»Das ist auch nicht erforderlich, Herr Baron. Es muß ja nicht immer alles gleich auf ›Abgeben‹ bedacht sein. Ich betone nochmals, daß Oda uns lieb ist, nicht wahr, mein Mädchen?«
»Und wie, Frauke! Wir lieben uns alle hier auf Gegenseitigkeit.«
Zufrieden, daß die beiden Mädchen über sie lachten und sogar der Bruder leicht schmunzelte, ging sie mit ihm davon. Bald darauf wurden sie auf dem Wiesenpfad sichtbar, der in allmählicher Steigung zum Schloß emporführte. Ortrun, zu denen sich auch Hulda gesellt hatte, den Geschwistern nach, die Hand in Hand gingen, wie zwei Menschen, die sich hilfesuchend aneinanderklammern. Hulda wischte sich die Augen und brummte:
»So ein armer Kerl. Bis in die tiefste Seele hinein kann er einen erbarmen. Der hat zuviel mitmachen müssen mit dem elendiglichen Weib. Ein Jammer, daß es gerade immer die besten Männer sind, die an so was geraten.«
»Wie weißt du denn, daß er einer von den besten ist?« fragte Frauke. »Du hast ihn heute doch zum ersten Mal und dabei nur flüchtig gesehen. Das genügt nun wahrlich nicht, die Wesensart eines Menschen zu erkennen.«
»Brauch ich gar nicht, ich verlaß mich da auf meinen Instinkt. Und der sagt mir, daß der Baron ein guter, vornehmer Mensch ist.«
Das letzte kam schon von der Tür her, durch die Hulda eiligst entschwand, damit nicht der Sonntagsbraten anbrannte, der gar lieblich in der Pfanne brutzelte. Frauke deckte den Tisch, und Ortrun hielt immer noch den Blick auf den Pfad gerichtet, bis die Geschwister im Park verschwunden waren. Doch immer noch sah Ortrun vor sich das stolze, von Trauer überschüttete Männerantlitz, hörte immer noch die dunkeltönende Stimme. Also ein Zeichen, daß der Mann sie fasziniert, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hatte.
Was gewiß kein Wunder war. Denn Männer seiner Art faszinierten selbst die anspruchsvollsten Frauen, geschweige denn ein zwanzigjähriges Mädchen, das in der Abgeschiedenheit eines Töchterheims herangewachsen war. Wo es außer dem alten Gärtner und dem gleichfalls nicht mehr jungen Faktotum keinen Mann gab.
Wohl hatte das Heim ein eigenes Kino, wo die Filme eigens für die behüteten Mädchen zurechtgeschnitten wurden. Zu der Tanzstunde der Siebzehnjährigen und den anschließenden Tanzabenden wurden nur gleichaltrige Jünglinge geladen. Somit hatte ein Mädchen wie Ortrun Danz, das bereits mit vierzehn Jahren ins Internat gekommen war, keine Gelegenheit gehabt, einen so außergewöhnlichen Mann wie Baron Swidbörn kennenzulernen.
Jedenfalls bot das Heim ein sicheres Unterkommen für heranwachsende Mädchen, die entweder elternlos waren oder deren Eltern sich um ihre Töchter nicht kümmern konnten, ihnen aber eine tadellose Erziehung angedeihen lassen wollten. Denn tadellos erzogen wurden die Mädchen; sie lernten alles, was für ihr späteres Leben von Wert war. Sie erhielten eine sorgfältige Schulausbildung bis zum Abitur, wurden in allen wirtschaftlichen Dingen unterwiesen, bekamen Musik- sowie Tanzunterricht, wer Lust hatte, konnte reiten lernen, mit achtzehn Jahren den Führerschein machen – nur allein ausgehen durfte man nicht, da wurden die Zöglinge immer von einer Lehrerin begleitet. Wem das nicht paßte, der mußte das Institut verlassen, was natürlich auch vorkam. Doch im allgemeinen fügten die Mädchen sich den Gesetzen, was ihnen später zustatten kam. Denn Zöglinge des Elitetöchterheims gewesen zu sein, war ein Freibrief, der ihnen überall die Türen öffnete.
Also hatte Doktor Danz schon gewußt, wohin er die Tochter nach dem Tod seiner Frau gab, zumal er sich als Forscher nicht um sein Kind kümmern konnte. Wenn es jedoch mit neunzehn Jahren dem Heim entwachsen sein würde, dann wollte er es auf seinen Reisen mitnehmen, soweit diese ungefährlich waren.
Allein, das sollte der Mann nicht mehr erleben. Viel zu früh ereilte ihn der Tod, und er mußte sein einziges Kind zurücklassen, das von Glück sagen konnte, ein so trauliches Zuhause zu finden. Sonst wäre es um das arme reiche Mädchen traurig bestellt gewesen.
*
»Die Finken schlagen, der Lenz ist da und keiner kann sagen, wie es geschah. Er ist gekommen so über Nacht«, klang es jubelnd aus dem Salon des grünen Hauses, wo
Ortrun vor dem weißen Stutzflügel saß und den Lenz besang, der wirklich gekommen war so über Nacht. Denn gestern abend noch hatte es geregnet und gestürmt und morgens war er da, der Götterknabe Mai, der nun sein rosenumwundenes Zepter schwang. Die Vögel jubilierten, die Bäume prangten in ihrem jungen Grün, die Rasen leuchteten, und die Blumen verströmten ihren süßen Duft.
Der einstige Schandfleck des Dorfes war jetzt ein kleines Paradies, das Ajax treu bewachte und der lange Michel ebenso treu umsorgte. Unermüdlich werkte er herum, mit fast unnachahmlichem Geschick. Er hatte es tatsächlich fertiggekriegt, aus dem Schuppen einen erstklassigen Geflügelstall zu zimmern. Nun krähte, gackerte, schnatterte, piepste es auf dem Hof an allen Ecken und Enden.
Im Gemüsegarten gedieh alles prächtig, der Park war sorgfältig gepflegt. Und wenn die drei Weiblichkeiten auch überall herzhaft zupackten, so war das doch alles nur »Nuschtwerk«, wie Hulda es bezeichnete. Der Arbeitsheld war und blieb Michel, in nimmermüder Kraft.
Jetzt bastelte er auf dem Hof an einem Drahtgestell für die Küken herum und pfiff dabei stillvergnügt die Melodie vor sich hin, die durch die geöffneten Fenster zu ihm drang. Er traf dabei wohl nicht immer den richtigen Ton, aber das machte ihm gar nichts aus.
Schade, daß das Konzert im Haus so plötzlich abbrach, war doch zu schön gewesen. Das fand wohl auch Frauke, aber sie mußte die Sängerin stören, weil sie ein Schreiben durch den Notar Danz erhalten hatte, das sie wenig später Hulda und Ortrun vorlas:
Sehr geehrter Herr Doktor Danz!
Ihr Schreiben hat mich beschämt. Denn Sie nehmen bestimmt an, daß ich eine Erpresserin bin. Das stimmt aber nicht. Ich habe nur in Unkenntnis gehandelt, als ich Fräulein Gortz den Brief schrieb. Ich glaubte mich im Recht, als ich die fünftausend Mark von ihr erbat, die ich vor Jahren der Frau des Professors leihweise überließ. Daß sie damals bereits von ihrem Mann geschieden war, verschwieg sie mir.
Haben Sie bitte die Güte, Herr Doktor, Fräulein Gortz zu schreiben und sie in meinem Namen um Entschuldigung zu bitten. Ich persönlich wage es nach dem beschämenden Brief nicht mehr.
Falls Sie noch ein Anliegen an mich haben sollten, lassen Sie es mich sofort wissen, damit Ihr Schreiben mich noch erreicht. Denn das Stift, in dem ich seit sechs Jahren lebe, wird aufgelöst, da es nicht mehr tragbar ist. Die meisten Damen werden auf andere Stifte verteilt. Doch zu den Glücklichen gehöre ich nicht, für mich ist nirgends Platz.
Hochachtungsvoll
Jadwiga von Schlössen.
»Für mich ist nirgends Platz«, murmelte Frauke, als sie den Brief sinken ließ. »Wie unsagbar traurig.«
»Ein Skandal ist das«, knurrte Hulda böse. »Einfach das Stift schließen und die armen Stiftsdamen auf die Straße setzen. Und das läßt unser Herrgott zu. Also müssen Menschen barmherziger sein.«
»Und sie werden es sein«, entschied Frauke spontan. »Platz haben wir genug, und zum Sattessen für eine Person wird es auch noch reichen. Was sagt ihr dazu?«
»Mich brauchst du erst gar nicht zu fragen«, wischte Hulda hastig ein Tränchen fort, und Ortrun nickte eifrig.
»Bitte, Frauke, laß die Dame herkommen. Du mußt dann eben mehr Pensionsgeld von mir nehmen. Und wenn das nicht reicht, muß Onkel Rudolf mehr Geld für meinen Unterhalt bewilligen.«
»Halt ein!« stoppte Frauke den Eifer. »Fräulein von Schlössen wird doch nicht so ein Vielfraß sein, daß wir sie nicht sattkriegen können. Deinen Vormund laß mal ganz aus dem Spiel. Ich glaube, er hat mich ohnehin im Verdacht, daß ich dir dein Fellchen über die Ohren ziehe.«
»Ist ja gar nicht wahr. Er findet es im Gegenteil zu wenig, was du mir abnimmst.«
»Also hat er dich doch darum befragt.«
»Das hat er nicht. Ich habe davon angefangen, als du mit den beiden Damen nach oben gingst, um ihnen dort die Räume zu zeigen. Da erzählte ich Onkel Rudolf von meinem Zimmer, dessen Einrichtung ich gekauft habe, was dir gar nicht recht war. Ferner erzählte ich, daß du zur Instandsetzung deines Besitzes kein Geld von mir nahmst, obwohl ich es dir immer wieder anbot. Ich klagte ihm auch, daß bei dem mäßigen Pensionspreis von dem Monatswechsel immer soviel übrig bleibt und ich gar nicht weiß, was ich mit dem Geld anfangen soll. Da lachte er und meinte, was für Sorgen wir reichen Mädchen doch hätten. Und nun schreibe gleich an Fräulein von Schlössen, daß sie hier ein Zuhause finden kann.«
»Na, nun mal langsam, mein Herzchen. So leichtsinnig wollen wir wiederum auch nicht sein. Wollen uns zuerst das Stiftsfräulein einmal ansehen, ob man mit ihr überhaupt auskommen kann. Also werde ich ihr schreiben, daß sie, wenn sie Lust hätte, uns besuchen möchte. Dann werden wir ja sehen, wie sie darauf reagiert. Zeigt sie uns die kalte Schulter, auch gut. Wir jedenfalls haben dann einem einsamen Menschen gegenüber unsere Pflicht und Schuldigkeit getan.«
*
Es war einige Tage später, als Frauke durch die Haustür gehen wollte – und dann wie erstarrt zwischen Tür und Angel verharrte; denn vor ihr stand die Dame aus dem D-Zug. Sehr vornehm, sehr altmodisch, mit Pincenez, vorsintflutlichem Hut, konservativer Reisetasche und schüchternem Lächeln, das um irgend etwas um Verzeihung zu bitten schien. Dann die unsichere Frage:
»Wohnt hier ein Fräulein Frauke Gortz?«
»Das bin ich.«
»Und ich bin Jadwiga von Schlössen.« Na, da schlag einer lang hin! wäre Frauke beinahe die beliebte Redewendung Michels entfahren. Doch der hilflose, bittende Blick der Besucherin gab dem gewandten Mädchen rasch die Fassung wieder.
»Seien Sie mir herzlich willkommen«, entgegnete sie liebenswürdig. »Wir sind uns nicht mehr ganz fremd, nicht wahr?«
»Nein, wir sahen uns damals im Zug… Mein Gott, der Hund, er wird mir doch nichts tun?« wich sie entsetzt vor Ajax zurück, der plötzlich aufgetaucht war und sie kritisch musterte.
»I bewahre«, beruhigte Frauke. »Du wirst doch wohl nicht liebe Gäste anfallen, du Schlingel.«
»Wauwau!« machte er lustig. Das beruhigte die ängstliche Dame, die Frauke nun in die Diele führte und ihr dort Tasche, Mantel nebst Hut abnahm. Auf der Terrasse bat sie den Gast, Platz zu nehmen, der ängstlich fragte:
»Ich komme Ihnen doch nicht ungelegen, Fräulein Gortz?«
»Durchaus nicht, Fräulein von Schlössen. Ich habe Sie doch eingeladen.«
»Wofür ich Ihnen von ganzem Herzen danke. Ich hätte sonst gar nicht gewußt, wohin ich sollte. Ich bin ja so allein.«
»Jetzt nicht mehr«, versicherte Frauke, die dieses arme, verschüchterte Wesen in tiefster Seele erbarmte. »Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.«
»Nehmen Sie auch den Hund mit?«
»Wenn er Sie geniert, selbstverständlich. Komm, Ajax!«
Willig folgte er ihr zur Küche, wo Hulda und Ortrun mit der Vorbereitung des Abendessens beschäftigt waren. Eine hielt eine Schüssel mit geschlagenen Eiern in der Hand, die andere eine Kanne mit Milch, was Frauke bei der Nachricht, die sie übermitteln wollte, denn doch zu gefährlich schien. Daher sagte sie leise:
»Stellt mal die Sachen auf den Tisch, damit sie euch nicht vor Überraschung aus den Händen fallen. So, nun will ich euch schnell was sagen, dann muß ich wieder zu unserm Gast zurück. Und dieser Gast heißt Jadwiga von Schlössen.«
»Na, das ist mal eine Überraschung!«
»Aber noch nicht die größte, Hulda. Besinnst du dich auf die altmodische Dame im D-Zug? Die ist mit unserm Gast identisch.«
»Gott in deine Hände!« sagte Hulda verblüfft. »Ist doch bloß gut, daß du mich vorher warntest. Ich hätte bestimmt die Schüssel fallenlassen.«
»Und ich den Topf«, lachte Ortrun. »Frauke, was werden wir bloß mit dem komischen Kruckchen anfangen?«
»Nett zu ihr sein, sie ist ja so arg verschüchtert. Ich muß jetzt gehen. Vergiß nicht, ein Gedeck mehr aufzulegen, Ortrun.«
Sie eilte zu Jadwiga zurück, nahm Platz und sagte munter:
»So, nun stehe ich Ihnen zur Verfügung, Fräulein von Schlössen. Gefällt es Ihnen hier?«
»Sehr. Es ist hier alles so harmonisch, so friedlich, so wie in Sonne getaucht.«
»Jetzt ja«, nickte Frauke und erzählte dann, wie düster und unwirtlich es vorher gewesen war. Sie hatte ihren Bericht gerade beendet, als Ortrun erschien und von Jadwiga überrascht gemustert wurde.
»Dieser jungen Dame bin ich doch auch im Zug damals begegnet.«
»Sie gehört ja auch zu mir«, erklärte Frauke und übernahm die Vorstellung. Dann ging man ins Speisezimmer, wo bereits das Abendessen stand. Rührei mit Schinken, Aufschnitt, Butter, Käse, Brot und Milch.
»Nun greifen Sie tüchtig zu, Fräulein von Schlössen«, forderte Frauke auf, nachdem man am Tisch Platz genommen hatte. »Wir sind Landbewohner, die nicht nippen, sondern essen, bis sie satt sind. Wenn Sie Milch nicht mögen, können Sie auch ein anderes Getränk bekommen.«
»Nein, danke, ich trinke Milch gern. Dann möchte ich Ihnen keine Umstände machen und Ihnen damit zur Last fallen. Ich will auch nicht lange bleiben.«
»Darüber sprechen wir später«, winkte Frauke ab und bemerkte dann mit Genugtuung, wie gut es dem Gast schmeckte. Warum, das sollten die beiden Mädchen erfahren, als man später in der Bibliothek bei einem Glas Wein saß.
»Sie werden sich über meinen Appetit gewundert haben«, sagte Jadwiga verlegen. »Aber ich hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Bin dann in der Stadt herumgelaufen, um ein möbliertes Zimmer zu finden. Aber erstens sind sie rar und dann für meine Verhältnisse zu teuer. Ich kam nun her, um Sie zu fragen, ob Sie vielleicht jemand im Dorf wüßten, bei dem ich unterkommen könnte.«
»Da werden Sie gewiß sehr enttäuscht sein, daß wir Ihnen keine Auskunft geben können«, bedauerte Frauke. »Wir sind auch erst von Mitte März hier und so gar nicht mit den Verhältnissen im Dorf vertraut. Nur so viel wissen wir, daß vom Frühsommer bis Herbst Feriengäste herkommen, die zum Teil Privatquartier beziehen müssen, weil die Hotels und Gasthäuser überfüllt sind. Also werden die möblierten Zimmer nicht nur knapp, sondern auch sehr teuer sein, wenigstens während der Saison.«
»Dann weiß ich nicht, was ich machen soll«, sagte Jadwiga niedergeschlagen. »Aus dem Stift, das sechs Jahre mein Zuhause war, mußte ich fort, weil es aufgelöst wurde. Und irgendwo muß ich doch bleiben.«
»Natürlich müssen Sie das«, sagte Frauke herzlich. »Und zwar bei uns. Wir haben noch ein Zimmer frei, das wir Ihnen gern zur Verfügung stellen. Wenn es Ihnen zusagt, können Sie so lange darin wohnen, bis Sie eine andere Unterkunft gefunden haben.«
»Wenn es mir zusagt«, murmelte Jadwiga. »Mir sagt jedes Zimmer zu, auch wenn es noch so primitiv wäre. Wochenlang suche ich schon danach, bin deshalb in Städten und Dörfern gewesen, doch mich wollte keiner haben. Und nun komme ich hierher und finde Menschen. Daß es überhaupt solche gibt, das läßt mich wieder an einen Herrgott glauben.«
Es war so erschütternd gesagt, daß den beiden Mädchen die Tränen in die Augen stiegen. Sie sahen nicht mehr die altmodische Kleidung, nicht mehr das lächerliche Pincenez, sahen nur einen bitter einsamen, vom Leben schlecht behandelten und vom Glück vergessenen Menschen. Frauke mußte erst einige Male schlucken, bevor sie sprechen konnte:
»Dann seien Sie uns als Hausgenossin herzlich willkommen, Fräulein von Schlössen. Ah, da kommt ja die liebe Hulda, die Dritte in unserm Bunde. Sie ist hier Haus- und Hofmeister, dem sich alle beugen müssen.«
»Was auch ganz in Ordnung ist«, brummte Huldchen herzhaft die Hand drückend, die sich ihr zur Begrüßung entgegenstreckte. Die Obersttochter wußte sofort, wie sie diese robuste Person einzustufen hatte. Daß sie eine der treuen Dienerinnen war, die langsam zur Legende werden.
»Fräulein von Schlössen wird bei uns wohnen«, erklärte Frauke. »Wir müssen das blaue Zimmer in Ordnung bringen.«
»Ist schon längst geschehen, mein Herzchen. Gelüftet, abgestaubt, das Bett überzogen. Dürfte ich um Ihren Koffer bitten, gnädiges Fräulein?«
»Ich habe keinen mit«, gestand Jadwiga verlegen. »Nur Nachtzeug, das sich in der Tasche befindet, die ich in der Diele abstellte. Ich konnte ja nicht ahnen, daß man mich hier nicht nur so lieb aufnehmen, sondern sogar hierbehalten würde. Nur Toilettensachen steckte ich ein, weil ich im Dorf zu übernachten gedachte.«
»Und wo befindet sich Ihr großes Gepäck?« fragte Frauke.
»Ich habe es in dem Gasthaus untergestellt, das in der Nähe des Stiftes liegt. Es ist ja nicht viel. Drei Koffer bergen meine ganze Habe.«
»Die wir schon herkriegen werden«, brummte Hulda. »Gute Nacht, ich gehe jetzt zu Bett.«
Als sie gegangen war, fragte Jadwiga:
»Wohl eine Getreue Ihrer Familie, nicht wahr, Fräulein Gortz?«
»Ja. Als ich zwei Jahre alt war, kam sie in unser Haus und hat sich auch nach dem Tode meiner Eltern nicht von mir getrennt. Trotz ihrer brummigen Art ist Hulda eine Seele von Mensch, dazu von unerschütterlicher Treue. Ich hätte nicht gewußt, und wüßte auch heute noch nicht, was ich ohne sie anfangen sollte.
Sie hat natürlich auch ihre Eigenheiten, die man ihr nachsehen muß. Ich möchte zum Beispiel gern, daß sie mit uns zusammen die Mahlzeiten einnimmt, weil sie doch ohnehin ganz zur Familie zählt. Aber dazu ist sie nicht zu bewegen. Sie sagt, in der Küchenschürze kann sie nicht an den Tisch kommen, und sich ein paarmal am Tag umzukleiden, dazu hat sie keine Zeit und keine Lust – basta! Und nun werde ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen; denn Sie scheinen recht müde zu sein.«
»Das bin ich«, gab Jadwiga unumwunden zu. »Ich habe in den letzten Nächten aus Angst, was aus mir werden soll, kaum geschlafen. Dann bin ich heute stundenlang in der Stadt auf Zimmersuche gewesen. Ich glaube, ich werde nach wochenlangem Hangen und Bangen zum erstenmal wieder richtig schlafen können.«
»Ist doch unerhört, ein Stift aufzulösen, bevor die Damen nicht restlos anderweitig untergebracht sind«, empörte Frauke sich. »Und bei der Überweisung in andere Stifte werden die maßgebenden Persönlichkeiten auch nicht gerecht verfahren sein, habe ich recht, Fräulein von Schlössen?«
»Ja. Die Oberin, Gräfin Warl, sorgte mal erst für die Damen vom titulierten Adel –«
»Aha!« warf Frauke erbost ein. »Und wieviel Damen waren nicht ›tituliert‹?«
»Außer mir noch zwei.«
»Und die wurden einfach auf die Straße gesetzt mit der Begründung, daß leider in den in Frage kommenden Stiften momentan alle Plätze belegt wären. Doch sobald einer frei wäre, würde man selbstverständlich dafür sorgen, daß die liebe… und weiterer Phrasen mehr. War das nicht so, Fräulein von Schlössen?«
»Genauso«, entgegnete Jadwiga verblüfft. »Woher wissen Sie das denn, Fräulein Gortz?«
»Wissen nicht, ich kann es mir nur denken. Und was wurde aus den anderen beiden ›nichttitulierten‹ Damen?«
»Die konnten bei Verwandten unterkommen. Nur ich habe keine, wenigstens nicht solche, die mich aufnehmen würden. Ich stehe ganz allein im Leben.«
»Hm. Und in welches Stift hat sich die gnädigste Frau Oberin begeben?«
»Vorläufig in keins. Sie will abwarten, bis wieder eine Oberinstelle frei wird.«
»Na, hoffentlich leben diese Damen, die ja nicht durchweg – na ja – sein werden, über hundert Jahre. Und wo will denn die Allergnädigste auf den Tod einer Oberin warten?«
»Zuerst unterzieht sie sich einer Kur und wird sich anschließend zu einem Neffen begeben«, erwiderte Jadwiga, eingeschüchtert durch Fraukes beißende Bemerkungen. »Und zwar zu einem Baron von Swidbörn.«
»Waaas?« wurde Frauke jetzt hellhörig. »Gehört dem Baron etwa die Herrschaft Grünehöh?«
»Ja.«
»Na, da schlag einer lang hin«, gebrauchte Frauke nun doch Michels Spezialausdruck, und Ortrun, die bisher dem Gespräch schweigend gefolgt war, fuhr auf.
»Frauke, das müssen wir Oda erzählen«, sagte sie aufgeregt, wozu die andere bekräftigend nickte.
»Worauf du dich verlassen kannst. Wissen Sie eigentlich, wo Grünehöh liegt, Fräulein von Schlössen?«
»Nein. Doch wie die Oberin sagte, soll es ein sehr großer, feudaler Besitz sein.«
»Ist es auch. Sie können von der Terrasse aus das Schloß sehen.«
»Das ist mir bereits aufgefallen, als ich vor dem Abendessen auf der Terrasse saß«, war es nun an Jadwiga, aufgeregt zu sein. »Und das gehört dem Baron von Swidbörn, einem der feudalsten Adligen im Land?«
»Ganz recht. Sie können, wenn die gnädigste Oberin dort weilt, gegenseitig winkewinke machen. Und nun hören Sie mal zu, Fräulein von Schlössen…«
Sie erzählte, wie sie zuerst die Baroneß und später deren Bruder kennenlernte, und Jadwiga faltete die Hände wie zum Gebet.
»Ist das nun Zufall oder Vorsehung?«
»Es ist letzteres, Fräulein von Schlössen. Doch darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, wir wollen schlafen gehen. Morgen ist auch ein Tag.«
In dem Zimmer, das sie kurz darauf betraten, war die Einrichtung wohl zusammengewürfelt, gab jedoch dem Raum Behaglichkeit. Das breite Holzbett war weiß, der Schrank braun, die Kommode mahagoni, der zierliche Schreibtisch mit dem Aufsatz hell Birke, der Teppich rot, die Tapete blau, die Bilder bunt, die Gardinen duftig zart. Das alles zusammen war wohl nicht stilvoll, aber lustig. Es schien zu sagen: Komm, tritt ein, bei mir bist du geborgen.
»Ich glaube, das Zimmer hat Seele«, stellte Jadwiga fest, und Frauke lachte.
»Es ist wohl eine bunte Seele, aber besser als eine Schwarze.«
»Wie soll ich Ihnen nur danken.«
»Gar nicht. Sie sollen sich hier wohl fühlen. Sollen mit dem Gefühl zur Ruhe gehen, daß Sie nicht mehr allein sind. Gute Nacht!«
*
Als man am nächsten Morgen auf der Terrasse beim Frühstück saß, sprang Oda die Stufen hinauf. Doch dann blieb sie wie festgwachsen stehen und starrte mit offenem Mäulchen auf Jadwiga, die wie eine Gouvernante anmutete, die mit ihren Zöglingen das Frühstück einnimmt. Es hätte nur noch der erhobene Zeigefinger gefehlt.
»Nun komm schon weiter!« ermunterte Frauke, ein amüsiertes Lächeln unterdrückend. »Begrüße unsere neue Hausgenossin. Das ist die Baroneß von Swidbörn«, stellte sie vor, als diese neben ihr stand. »Und das ist Fräulein von Schlössen.«
Und siehe da, Baroneßchen machte einen artigen Knicks und setzte sich dann an Ortruns Seite. Viele Fragen brannten ihr auf der Zunge, die sie natürlich nicht stellte. Erst als Jadwiga nach oben ging, platzte die Kleine heraus:
»Ja, sagt mal, seit wann braucht ihr denn ein Gouvernante?«
»Pppssst!« legte Frauke warnend den Finger auf den Mund. »Die Tür steht offen.«
»Ich bin doch so neugierig.«
»Dann komm mit nach der Küche, wo wir das Geschirr spülen müssen, weil Hulda schwer beschäftigt ist. Sie streicht Gartenstühle, die sie in der Laube aufgestöbert hat. Deck den Tisch ab, ich gehe schon vor.«
Fünf Minuten später bekam dann Oda etwas zu hören, das ihr weiches Herzchen arg bedrängte. Doch als sie von der hochfahrenden Oberin hörte, da blitzten ihre Augen vor Empörung.
»Und die will zu uns kommen? Das laß sie ja nicht wagen! Einen Menschen zurücksetzen, weil er nicht tituliert ist, das hat mein Bruder gern – und ich auch. Übrigens hatte ich gar keine Ahnung, daß wir so eine Nebelkrähe…«
»Oda!«
»Ist doch wahr«, brummte sie mit rotem Köpfchen. »Trotzdem will ich mich benehmen. Also ich hatte keine Ahnung, daß wir eine Gräfin… Wie heißt sie?«
»Warl.«
»Aha, so hieß auch meine Mutter. Somit komme ich der Sache schon näher. Das wird wohl so eine Verwandtschaft xten Grades sein, die Winrich mir auseinanderposementieren muß. Die Fragen brennen mir förmlich auf der Zunge. Gehabt euch wohl, ich bin bald wieder da.«
Sie wirbelte ab, durch den grünen Grund, die grüne Anhöhe hinauf, durch den Park, auf die Terrasse, wo sie erst einmal Uwe Gunder herzhaft auf die Füße trat, der sich nächst dem Freund im Liegestuhl einer Ruhepause hingab.
»Hoppla, meine Piedestale! Mädchen, ich hab die doch nicht in der Lotterie gewonnen.«
»Dann streck sie nicht vor, damit man darüber stolpern muß. Laß mich jetzt in Ruhe, ich muß Winrich ganz was Wichtiges erzählen.«
Und dann plätscherte das Zünglein wie ein Wasserfall. Das Stimmchen schwankte, hob sich, empörte sich, bis alles gesagt war. Dann sah sie den Bruder vorwurfsvoll an, der schmunzelnd fragte:
»Sag mal, Kleine, hast du das alles etwa auswendig gelernt?«
»Du bist abscheulich! Aber das sage ich dir, wenn du diese – na ja –, wenn du die aufnimmst, dann laufe ich davon!«
»Wohin?«
»Ins grüne Haus natürlich.«
»Wo du gleich die Gouvernante findest, die dir manchmal noch fehlt«, sagte Uwe pomadig. »Denn wie ich deiner plätschernden Rede entnehmen konnte, sind die jungen Damen ihrer neuen Hausgenossin bereits im Abteil des D-Zuges begegnet, in dem auch ich mich befand. Somit kann es sich nur um die Dame mit dem lächerlichen Pincenez handeln.«
»Das stimmt, Fräulein von Schlössen trägt eins. Und das paßt zu ihr. Wie sind wir mit Gräfin Warl verwandt, Winrich. Ist sie tatsächlich unsere Tante?«
»Zweiten Grades. Eine Base von Mutter, mit der sie nur zu den Familientagen zusammentraf, vor denen ich mich bis auf einen drücken konnte.«
»War die Oberin auch dabei?«
»Ja. Eine stattliche Dame in einem hochgeschlossenen schwarzen Kleid, mit Johanniterkreuz, hochmütigem Gesicht und dunklem Scheitel. Sie mißfiel mir gründlich, was bei den andern auch der Fall zu sein schien; denn sie gingen in großem Bogen um sie herum. Ich kann mir vorstellen, daß sie keine angenehme Oberin gewesen ist.«
»Und die will ausgerechnet zu uns kommen«, sagte Oda aufgebracht. »Warum bloß. Die hat doch bestimmt noch andere Verwandte, die ihr dem Grad nach näher stehen als wir. Hat sie dich übrigens schon darum gebeten, daß du sie aufnehmen sollst?«
»Mein liebes Kind, die Oberin Gräfin Warl bittet nicht, die läßt sich herab. Wir müssen es uns als Ehre anrechnen, wenn sie geruht, ihr Domizil bei uns aufzuschlagen.«
»Ach du lieber Gott! Hat sie etwa schon geruht, ihr Erscheinen kundzutun?«
»Sie hat. Gestern erhielt ich einen Brief von ihr, der mich vor die vollendete Tatsache stellt, daß die gnädige Frau Tante in absehbarer Zeit hier einzutreffen gedenkt.«
»Warum hast du mir von dem Brief nichts gesagt?«
»Weil ich es vergaß.«
»Was wirst du antworten?«
»Nichts, da ich die Anschrift nicht weiß.«
»Dann kommt sie also her?«
»Wahrscheinlich.«
»Dabei kannst du so ruhig sein?«
»Warum nicht? Aufregen kann ich mich immer noch, wenn es etwas zum Aufregen gibt.«
»Dafür werde ich schon sorgen!« funkelte sie ihn an, der wie die personifizierte Gelassenheit im Liegestuhl ruhte. »Ich benehme mich der Oberin gegenüber rüpelhaft. Und dann werde ich doch mal sehen, ob mein Herr Bruder, dem schlechterzogenen Menschen ein Greuel sind, sich über seine ungezogene Schwester nicht aufregen wird.«
»Das glaube ich nicht«, meinte Uwe pomadig. »Der Herr Baron von Swidbörn bleibt auch dann noch gelassen, wenn er die ungezogene Baroneß von Swidbörn übers Knie legt. Vielleicht überläßt er das sogar mit Nonchalance seinem guten Freund. Und wo der hinhaut, da wächst bestimmt kein Gras.«
»Scheusal!«
»Danke. Ist dir jetzt wohler?«
»Nein, ich fühle mich unverstanden.«
»Herrje, schon so früh?«
Da mußte sie lachen, und der Friede war wiederhergestellt. Sie zog an den Liegestuhl ein Sitzkissen, kauerte sich darauf, legte das Blondköpfchen auf des Bruders Arm und sagte leise:
»Ich habe Angst.«
»Etwa vor der Oberin?«
»Ja. Sie wird sich hier einnisten und alle beherrschen wollen.«
»Wollen vielleicht, aber erst können«, umfaßte er das Schwesterlein und zog es dicht zu sich heran. »Habe ich mich schon jemals von einem Menschen beherrschen lassen?«
»Nein, nicht einmal von deiner herrschsüchtigen Frau. Da nahmst du wohl auf ihre Krankheit Rücksicht, aber beherrschen ließest du dich dennoch nicht.«
»Siehst du. Ich werde der impertinenten Dame gegenüber schon den richtigen Ton finden. Übrigens hat sie sich eingehend nach dem Dorothea-Stift erkundigt. Sie hätte gehört, daß die Oberin dort recht leidend wäre. Merkst du was, Schwesterlein?«
»Und wie!« wurde Oda jetzt mobil. Sie setzte sich auf und blinzelte den Bruder an.
»Daher weht der Wind. Sie reflektiert auf den Posten, den du als Patronatsherr zu vergeben hast. Da muß man schon mit Hulda sagen: Die ist nicht dumm auch nicht nuscht. Denn das Dorothea-Stift ist eine fette Pfründe.«
Was auch stimmte. Das Stift war seinerzeit von einem der reichsten Männer Preußens, dem Reichsbaron Desider von Swidbörn gegründet worden. Es besaß ein festgefügtes, gutmöbliertes Haus, ein stattliches Vermögen und eine Landwirtschaft, welche die zwei Dutzend Damen nebst Personal reichlich versorgen konnte. Die meisten der Insassinnen waren so gestellt, daß sie einen guten Pensionspreis zahlen und damit die Minderbemittelten durchschleusen konnten, so daß nie der Etat überschritten wurde, sondern im Gegenteil man noch sparen konnte.
Die Schutzherren waren von jeher die Barone von Swidbörn gewesen, die wie kleine Könige auf ihrem herrlichen Besitz regierten. Der Stammsitz war Grünehöh und alles was einen »grünen« Namen hatte, gehörte dazu. Grüneberg, Grünetal, Grüneau, Grünewald und Grüneheide. Grünegrund hatte ein Vorfahre einst an die Gemeinde verkauft, wo dann so nach und nach das Dorf Grünergrund entstand.
Die Stelle der Oberin war jetzt von einer Gräfin Attbach besetzt, einer geborenen Baroneß von Swidbörn. Als ihr Gatte, ein hoher Militär, starb, betreute ihr Bruder sie mit der Stiftsstelle, die damals gerade frei war. Winrich und Oda hingen sehr an dieser Tante, die sie oft besuchten, da das Stift in der Nähe lag.
Nun war die Oberin im Winter ernstlich krank gewesen, hatte sich jedoch wieder prächtig erholt. Also standen die Chancen schlecht für die Gräfin Warl. Denn erstens konnte die jetzt sechzigjährige Oberin noch gut zwei Jahrzehnte leben und dann hätte der Patronatsherr nach einem so wertvollen Menschen nie einen so minderwertigen wie die Gräfin Warl als Oberin gewählt.
*
Jadwiga von Schlössen war emsig dabei, die Blumen zu gießen, die in den grünen Kästen auf der Balustrade der Terrasse so üppig blühten. Zwischendurch rankten Kletterrosen, die dick voll Knospen waren, von denen hier und da bereits eine aufsprang. Wenn sie alle richtig blühten, würde hier eine wahre Rosenpracht das Auge entzücken.
Ajax hatte sich auf den Fliesenboden gestreckt und sah aufmerksam zu, was das Frauchen da machte, dem er schon längst Daseinsberechtigung hier zubilligte.
Jadwiga war glücklich. Wie im Paradies fühlte sie sich, nach dem trostlosen Dasein vergangener Jahre. Hier durfte sie ein Mensch unter Menschen sein, kein geducktes, bespötteltes Wesen. Hier wurde sie als vollwertiges Familienmitglied betrachtet. War die Tante Jadwiga, sogar für die Baroneß.
Man hätte sie auch bestimmt behalten, wenn sie ganz mittellos gewesen wäre. Doch sie bekam eine monatliche Rente von zweihundert Mark, von denen Frauke ihr nur die Hälfte abnahm, die andere mußte sie behalten. Viel Geld für einen Menschen, der bisher mit einem Taschengeld von dreißig Mark hatte auskommen müssen.
Jadwiga durfte auch in der Wirtschaft leichte Arbeiten verrichten, die ihr das Gefühl gaben, doch wenigstens zu etwas nütze zu sein. Sie hatte sich in den beiden Wochen, die sie hier weilte, gut herausgemacht. Sie war voller geworden, das vergrämte Gesicht hatte sich gestrafft, die Augen hatten den scheuen Blick verloren. Sie konnte sogar schon lachen, was sie lange nicht mehr getan hatte, weil es für sie nichts zu lachen gab.
Eben erschien Ortrun, entzückend anzuschaun in dem schicken Frühjahrskleidchen. Die Augen strahlten, als spiegelte sich darin die Sonne, das wunderbare Haar gleißte wie das Gold des Meeres. Ein junges Menschenkind von bezaubernder, jungfrischer Schönheit.
Aber auch Frauke war reizend, die soeben sichtbar wurde. Nicht ganz so grazil wie Ortrun, aber immerhin schlank. Das Haar wie reife Kastanien und wunderbar gepflegt, die Augen opalisierten wie Perlmutt.
Und dann die allerliebsten Grübchen, die redeten eine gar eindringliche Sprache.
Wenn die beiden Mädchen durch das Dorf gingen, wie jetzt, so richtig leichtbeschwingt und unbeschwert, gab es wohl keinen Mann, der ihnen nicht nachschmunzelte. Das tat nun der Gemeindevorsteher, der mit dem Domänenpächter Schölt in der »Grünen Gans« am Fenster saß und auf den Marktplatz schaute.
»Sehen Sie sich das mal an!« zeigte er mit einer Kopfbewegung nach draußen, wo zwei junge Mädchen sichtbar wurden. »Donner noch eins, da kann es einem heiß ums Herz werden. Es blühen zwei köstliche Blumen im Garten vom grünen Land. Der berauschende Duft dürfte so mancher Herrlichkeit in die Nase steigen.
Olala, da naht ja auch unser aller Stolz hoch zu Roß nebst Schwesterlein. Wem winkt es da so lebhaft zu? Natürlich den jungen Damen, die lachend zurückwinken. Sie sollen ja miteinander ein Herz und eine Seele sein.
Die Damen leben sehr zurückgezogen, und ihr Faktotum ist nebst seinem Bertchen verschwiegen wie ein Trappistenmönch, wenn es ums grüne Haus geht. Mir ist alles, was damit zusammenhängt, äußerst interessant.«
Menschlich verständlich. Denn Menschen in exquisiter Stellung sind nun mal interessant, werden scharf beobachtet, bekrittelt und beklatscht. Und je zurückgezogener solche Menschen leben, um so größer ist die Neugierde.
Nun, diese ließ die vier Menschen kalt, die sich soeben begrüßten. Allerdings nur durch Zuwinken, weil die Reiter es eilig hatten. Oda rief den beiden Mädchen noch zu, daß die Oberin eingetroffen wäre, dann tänzelten die Pferde vorüber, um hinterher in einen muntern Trab überzugehen.
»Eigentlich sonderbar, daß wir die Geschwister heute zum ersten Mal im Sattel sehen«, sagte Frauke. »Daß der Baron reitet, ist ja selbstverständlich, doch daß es auch Oda tut, ist mir neu. Sie hat es doch nie erwähnt.«
»Weil sie es des Erwähnens nicht für wert findet«, zuckte Ortrun die Achsel. »Denn bei den Landfräulein ist das Reiten so selbstverständlich wie bei den Landherren. Sie haben schon als Kind ihr Pony und später ein Damenpferd. Das weiß ich von den Mädchen, die ins Töchterheim kamen. Dort konnten sie das Reiten fortsetzen, da das Institut einen eigenen Reitstall unterhielt. Sie mußten sich allerdings mit einem abgegrenzten Gelände begnügen, dazu noch unter Aufsicht einer Reitlehrerin. Mir als Anfängerin machte das nichts aus, doch die Perfekten maulten oft über die Freiheitsberaubung, wie sie es nannten. Warum siehst du mich so erstaunt an?«
»Weil ich zum ersten Mal höre, daß auch du eine Reiterin bist. Bei dir erfährt man überhaupt nur durch Zufall, was du kannst. Daß du ausgezeichnet Klavier und Geige spielst, dazu auch noch singst, erfuhr ich unlängst durch Zufall, daß du den Führerschein hast, gestern, und daß du reitest, heute.«
»Aber Fraukelein, das ist doch alles so unwichtig. Viel wichtiger ist, daß ich in Haus und Garten helfen kann. Was ist denn schon ein Reiter ohne Pferd und ein Autofahrer ohne Auto. Ich hatte vor beiden Angst, als ich mit der Lehre begann. Aber mein Vater hatte gewünscht, daß ich alles mitzunehmen hätte, was das exklusive Heim nur bieten konnte. Daran hielt sich die Oberin nun streng, und gegen die gab es kein Auflehnen, nur ein Gehorchen.«
Mittlerweile hatten sie das grüne Haus erreicht, wo im Vorgarten Ajax ihnen auf drei Beinen entgegenhumpelte.
»Was hast du denn?« fragte Frauke bestürzt, worauf das Tier ihr leise winselnd die Pfote entgegenstreckte, von der Blut tropfte. Als die Mädchen näher hinsahen, bemerkten sie den Glasscherben, der zwischen den Zehen hervorragte.
»Das sieht ja böse aus«, sagte Frauke erschrocken. »Der Scherben muß raus, das steht nun mal fest. Und da ich mich nicht heranwage, muß der Tierarzt her. Hol rasch eine Binde, Ortrun, damit wir einen Notverband anlegen können.«
Als das geschehen war, nahmen die Mädchen den Hund beim Halsband und führten ihn auf die Terrasse, wo Jadwiga beim Anblick der blutdurchtränkten Binde aufschrie und damit nicht nur Hulda sondern auch Michel herbeilockte, die nun betroffen auf das winselnde Tier schauten.
»Er hat sich einen Scherben in die Pfote getreten«, erklärte Ortrun, während Frauke zum Fernsprecher eilte, um den Tierarzt anzurufen. Nachdem sie im Verzeichnis die Nummer gefunden hatte, wählte sie und hörte gleich darauf eine dunkle Stimme:
»Doktor Gunder.«
»Herr Doktor, kommen Sie bitte sofort zu unserm Hund«, sprach Frauke aufgeregt in die Muschel. »Er hat sich eine Scherbe in den Fuß getreten, die ich nicht entfernen kann. Werden Sie kommen?«
»Wenn ich wüßte wohin, dann gern.«
»Zum Haus im grünen Grund natürlich«, sagte sie ungeduldig, und er lachte.
»Das muß einem Dummen doch gesagt werden. Es gibt ja schließlich eine ganze Menge Hunde im Dorf und in der Umgebung.«
»Entschuldigen Sie bitte, ich bin so aufgeregt.«
»Wer?«
»Frauke.«
»Danke, jetzt weiß ich Bescheid. Eine Frauke ist hier einmalig. In zehn Minuten bin ich da.«
*
Als Doktor Gunder die Terrasse betrat, konnte er nur mit Mühe ein Schmunzeln unterdrücken bei dem malerischen Bild, das sich ihm bot. Frauke saß auf einem Fußkissen und hielt im Schoß den Kopf des Hundes, der sich eng an sie geschmiegt hatte. An seiner Seite kauerte Ortrun, Hulda und Michel hockten auf der obersten Treppenstufe, und mittendrin saß Jadwiga im Gartensessel, mit verstörtem Blick und wackelndem Pincenez. Ein lebendes Bild, wie es malerischer nicht gestellt werden konnte. In das auch kaum Bewegung kam, als der Arzt sich vorstellte und dann die ihm von Frauke Vorgestellten mit einer Verbeugung begrüßte. Man konnte hier den Spruch anwenden: Aller Augen warten auf dich, Herr, denn fünf Augenpaare waren in ängstlicher Erwartung auf ihn gerichtet.
»Dann wollen wir uns doch mal die kranke Pfote ansehen«, trat er furchtlos auf den Hund zu, was Frauke hastig abwehrte.
»Bitte nicht, Herr Doktor. Ajax ist sehr scharf, er wird Sie beißen.«
»Er denkt gar nicht daran«, ließ der Mann sich seelenruhig auf die Knie nieder und fuhr liebkosend über den Kopf des prächtigen Rüden, was dieser sich nicht nur gefallen ließ, sondern sogar mit einem zärtlichen Handlecken belohnte.
»Na also, du kluger Kerl. Du weißt ganz genau, daß ich dir helfen will«, sprach die Männerstimme beruhigend auf den Hund ein. Sie hatte etwas ungemein Tröstendes, klang tief und weich wie ein Ton in Moll. Mit behutsamen Händen tat er die Binde ab, besah sich die Pfote und meinte zuversichtlich:
»Halb so schlimm, das werden wir gleich haben.«
Dann kramte er in der Medikamententasche herum, zog einen Wattebausch hervor, träufelte Äther darauf und reichte den Bausch Frauke hin.
»Den drücken Sie Ajax auf die Nase, gnädiges Fräulein, das wird ihn leicht einschläfern. Außerdem werde ich noch die Pfote unempfindlich machen. Ich sehe gar nicht ein, warum man den Tieren nicht Schmerzen ersparen soll, soweit es möglich ist. Sie sind ja schließlich auch ein Mensch«, setzte er mit dem warmen Lachen hinzu, das diesen Mann so liebenswert machte.
Und schon zog der listige Amor, der schon längst auf der Lauer lag, den Bogen straff. Und um ein so lange behütetes Herz war es geschehen.
Vorläufig merkte es jedoch davon noch nichts. Vorläufig war es noch mit Sorge erfüllt um Ajax, den treuen Kameraden. Die Hand zitterte, welche die Watte auf die Hundenase drückte, bis der Arzt Einhalt gebot:
»Genug, gnädiges Fräulein, werfen Sie den Bausch weit fort.«
Und dann war alles so einfach. Das Glasstück wurde geschickt entfernt, die Wunde desinfiziert, der Verband angelegt, und schon begann der Hund sich zu regen.
»Na also«, nickte sein Helfer zufrieden. »Die kleine Betäubung hat gerade gereicht, die Augen sind wieder klar, die Rute setzt sich in Bewegung, der erste Krankenbesuch naht auch bereits, mehr kann man doch nun wirklich nicht verlangen.«
Da war der »Krankenbesuch« auch schon herangewirbelt. Nahm mit Vehemenz die Treppe, um dann verdutzt vor Hulda und Michel zu verharren. Bevor jedoch Oda ihrem Erstaunen darüber noch Ausdruck geben konnte, hatte sie auf der Terrasse erspäht, worüber sie noch mehr staunen mußte. Frauke auf dem Fußkissen, der Hund mit der verbundenen Pfote, daneben die kauernde Ortrun, die steif dasitzende Jadwiga mit dem hilflosen Blick – und einen Mann, der nicht hierher gehörte.
»Ja, Uwe, was machst du denn hier?« fragte die Kleine, nachdem sie sich von ihrer Überraschung erholt hatte, und er zwinkerte ihr vergnügt zu.
»Baroneßchen, hast du aber eine lange Leitung. Sieh dir Ajax an und bedenke, daß ich Tierarzt bin.«
Da hatte Oda endlich begriffen. Sie zwängte sich an Hulda und Michel vorbei und stand vor dem Hund, ihn angstvoll betrachtend.
»Was hat er denn? Etwa ein Bein gebrochen?«
»Nein«, gab der Arzt Auskunft. »Er trat sich in die Pfote eine Scherbe, die ich entfernte.«
»Na so was.« Baroneßchen schüttelte den Kopf. »Da bin ich mal einen Tag nicht hier, und schon passieren die tollsten Sachen. Macht bloß nicht so betrübte Gesichter. Das habt ihr nicht nötig, wenn Uwe da ist. Komm, setz dich hin! Dann hörst du gleich mit, was ich zu berichten habe. Er darf das doch, Frauke, nicht wahr?«
»Selbstverständlich«, beeilte sie sich zu versichern. »Doch zuerst wird sich der Herr Doktor die Hände waschen.«
»Besten Dank, gnädiges Fräulein, das ist nun wirklich notwendig.«
Frauke führte ihn zum Waschraum, und als er zurückkehrte, nahm er dankend den ihm gebotenen Platz. Als er aus der indes herbeigeholten Bar seine Wahl treffen sollte, erklärte er kategorisch:
»Aber nur, wenn die Damen mithalten, auf daß die blassen Wänglein Farbe kriegen.«
»Meine auch?« fragte Oda erwartungsvoll, und er besah sich schmunzelnd das reizende Persönchen.
»Zwar glühen deine Wänglein rosenrot, aber mitgefangen, mitgehangen.«
Die fünf Menschen – Hulda und Michael hatten sich bereits entfernt – trafen nun ihre Wahl und prosteten sich zu. Den Mann empfand man gar nicht als fremd. Man hatte das Gefühl, als kenne man sich schon lange.
Bevor man mit einer Unterhaltung beginnen konnte, platzte Oda mit ihrer Neuigkeit heraus:
»Die Oberin ist da, gestern gegen Abend eingetroffen. Na, das ist vielleicht eine…«
»Ei, Oda!«
»Ja, was hast du denn, Uwe?« legte sie das Köpfchen schief und blinzelte ihn erstaunt an. »Ich darf doch wohl sagen, daß die Frau Oberin eine – hm, ja – hoheitsvolle Dame ist, in deren werten Adern schon mehr dunkellila Blut sehr vornehm fließt. Ihr Morgen- und Abendgebet beginnt bestimmt mit den Worten des Pharisäers: Lieber Gott, ich danke dir, daß ich nicht so bin wie andere. Und damit hat sie sogar recht.«
Vergnügt fiel sie in das Lachen der andern ein und ließ dann ihrem Zünglein weiter freien Lauf:
»Nachdem sie von der Feudalität ringsum Kenntnis genommen und befriedigt festgestellt hatte, daß es der richtige Rahmen für ihre hochnoble Person wäre, beanstandete sie meine Zöpfe. Meinte, daß sie keine Frisur für eine junge Dame von Stand wären. Beim Abendessen mißbilligte sie meinen glänzenden Appetit und saß dann hinterher wie eine drohende Düsternis da in ihrem hochgeschlossenen Kleid, auf dessen Schwärze das Johanniterkreuz bösartig funkelte.
Mich ließ sie gottlob in Ruhe, doch der ›liebe Junge‹ mußte mit anhören, was die Dame alles zu beanstanden hätte. Aber das beeindruckte ihn absolut nicht. In seiner uns so gut bekannten Gelassenheit saß er da, rauchte mit Genuß seine Pfeife und warf ab und zu gelangweilt etwas dazwischen wie: So – sieh doch mal an – tatsächlich – kann ich gar nicht finden. Als er sich eine Stunde später erhob, wollte sie ihn mit der Bemerkung zurückhalten, daß es für sie noch viel zu früh wäre, zu Bett zu gehen, sie könne ohnehin so schlecht schlafen. Was er zwar höflich bedauerte, dabei jedoch hinzufügte, daß für ihn stets die Nacht zu kurz wäre, da er frühmorgens aus den Federn müßte und dann einen anstrengenden Arbeitstag vor sich hätte. Ein freundliches: Gute Nacht, schlaf wohl, dann zwinkerte er mir zu, und wir zogen vergnügt von dannen.«
»Und was tat die Frau Oberin?« erkundigte sich Uwe, der wie alle andern dem anschaulichen Bericht amüsiert gefolgt war.
»Die soll, wie Barbe mir erzählte, Sturm geklingelt haben, worauf dann Niklas bei ihr erschien, den sie ganz unvornehm anfauchte mit der Frage, ob es denn hier üblich wäre, einfach loszugehen und die Gäste sitzenzulassen. Wahrscheinlich müßte man allen hier Manieren und Räson beibringen. Dann rauschte sie zornentbrannt ab und verfügte sich in ihr Appartement, welches in diesem Fall aus einem Zimmer besteht, das nicht zu den besten gehört.
Das bekam am nächsten Vormittag Barbe zu hören, als sie durch ein Sturmzeichen zu der ungnädigen Gnädigen befohlen wurde, von der sie wissen wollte, ob hier allen Gästen nur ein Zimmer zur Verfügung gestellt würde, was Barbe bejahte. Darauf verlangte die Frau Oberin ihr Frühstück ans Bett, worauf diese Kreatur von Dienerin sich erdreistete, den Wunsch abzuschlagen. Leider könnte man das hier nicht machen, da die wenige Dienerschaft mit Arbeit überlastet wäre. Nun tobte die Frau Oberin los, sie würde sich beim Herrn Baron über die Unbotmäßigkeit seiner Dienerin beschweren, was diese Dienerin mit stoischem Gleichmut hinnahm. Sie sagte noch, daß das Frühstück bis zehn Uhr bereit stehe und machte dann die Tür von draußen zu.«
»Das ist ja köstlich«, lachte Uwe. »Hat dann etwa die Frau Oberin ihre schlechte Laune an dir ausgelassen?«
»Ich war ja gar nicht da«, lachte Oda schadenfroh. »Ich war mit Winrich zur Försterei geritten, wo ich mir aus dem Wurf junger Dackel den schönsten aussuchen durfte. Doch jetzt muß ich eilen, damit ich zum Mittagessen nicht zu spät komme. Du weißt ja, daß Winrich Unpünktlichkeit verhaßt ist. Also dann adieuchen, ich kehr bald wieder.«
Sie wirbelte ab, und der Tierarzt sah die Damen der Reihe nach an, die betretene Gesichter machten.
»Was Sie denken, das weiß ich«, lächelte er. »Nämlich, daß mein Freund Winrich ein unmanierlicher Mensch und ein miserabler Gastgeber wäre. Dem ist aber nicht so. Ich kenne im Gegenteil nicht viele Männer, die über so tadellose Umgangsformen verfügen und so ritterlich sind wie er. Doch dieser anmaßenden Oberin gegenüber muß er schon zu rigorosen Maßnahmen greifen, sonst ist er bald nicht mehr Herr in seinem Haus. Wahrscheinlich gedenkt sie sich da einzunisten.«
»Das stimmt«, nickte Jadwiga so eifrig, daß ihr Pincenez wackelte. »Das hat sie im Stift ausdrücklich betont. Auch daß sie den frauenlosen Haushalt straff am Zügel nehmen wird.«
»Eine despotische Dame«, bemerkte Uwe. »Da haben Sie und Ihre Stiftsschwestern wohl sehr unter der Despotie zu leiden gehabt, gnädiges Fräulein?«
»O ja. Das heißt, die ersten vier Jahre ihrer fünfjährigen Herrschaft war es immerhin noch erträglich. Da gab es den Patronatsherrn, der die Oberin scharf in ihre Schranken wies, wenn Beschwerden bei ihm einliefen. Doch als er starb und das Stift bald darauf zur Auflösung kam, wurde es arg, zumal man der Oberin die Auflösung überließ. Diejenigen, die sie zu umschmeicheln verstanden, hatten es gut. Doch die, die es nicht konnten, für die wurde es ein bitterböses Jahr, hauptsächlich für mich«, schloß sie leise, und der Arzt sagte grimmig:
»Das soll sie büßen. Mein Freund wird schon dafür sorgen, daß diese Menschenschinderin keinen Oberinposten mehr kriegt, überhaupt in keinem Stift mehr unterkommt. Er ist nämlich der Präses der Verbindung und hat daher eine Menge zu sagen. Im Schloß wird ihres Bleibens auch nicht lange sein, bei den andern Verwandten hat sie sich durch ihr hochfahrendes Wesen wahrscheinlich schon längst unbeliebt gemacht, also wird sie alleinstehen und von ihrer Rente leben müssen, mit der sie bestimmt keine großen Sprünge machen kann, wie man so sagt. Und nun dürfen Sie mich hinauswerfen, meine Damen. Ich habe hier nichts mehr zu suchen, da mein Patient mobil ist. Morgen sehe ich wieder nach ihm. Bis dahin: Auf Wiedersehen.«
*
Oda hatte es gerade noch geschafft. Allerdings mit Barbes Hilfe, die ihr beim Umkleiden half und die Zöpfe frisch flocht. Denn unordentliche Menschen waren dem Schloßherrn, der selbst auf tadellose Kleidung hielt, ein Greuel, schon ganz und gar bei Tisch. Und was er verlangte, dem hatte man sich unterzuordnen, da gab es selbst für das zärtlich geliebte Schwesterchen kein Pardon.
Also betrat Oda wie frischgewaschen und geplättet das Speisezimmer. Nachdem auch die andern beiden sich eingefunden hatten, nahm man am Tisch Platz, und Niklas servierte die Suppe, über die sich die Baroneß mit Appetit hermachte, während die Gräfin sie ablehnte.
»Suppe macht dick«, erklärte sie. »Du solltest auch darauf verzichten, Oda.«
»Warum denn? Bin ich etwa zu dick?«
»Noch nicht. Aber wenn du immer weiter so drauflos ißt, wirst du deine zierliche Figur bald einbüßen. Und dann solltest du deine Zöpfe abschneiden lassen.«
»Mitnichten«, warf der Bruder ein. »Odas prächtige Zöpfe sind mein ganzer Stolz. Und über ihren Appetit freu ich mich. Ein Zeichen, daß sie gesund ist.«
»Wo warst du überhaupt heute den ganzen Vormittag, Oda?« wechselte die Dame rasch das Thema, und artig gab die Kleine Auskunft:
»Ich ritt morgens mit Winrich zur Försterei, wo ich mir einen Dackel aussuchen durfte, anschließend ging ich dann ins grüne Haus. Zu meiner Überraschung fand ich Uwe dort«, richtete sie jetzt das Wort an den Bruder. »Ajax hatte sich eine Scherbe in die Pfote getreten, die Uwe entfernte.«
»Alles gutgegangen?«
»Das kannst du dir doch denken, wenn Uwe etwas in die Hand nimmt, daß es gut wird.«
»Wer ist denn dieser Uwe?« wollte die Gräfin wissen.
»Mein bester Freund.«
»Aristokrat und Landwirt?«
»Nein, ein bürgerlicher Tierarzt.«
»Und wer ist Ajax?«
»Ein Schäferhund.«
»Und wer wohnt in dem grünen Haus?«
»Zwei junge Damen nebst einer langjährigen Angestellten. Außerdem befindet sich seit ungefähr drei Wochen dort eine Hausgenossin, die dir gut bekannt ist, weil sie sich mit dir in demselben Stift befand.«
»Was, etwa die Schlössen?«
»Jawohl, die Schlössen«, wiederholte er mit unverkennbarer Ironie, was die Frau Oberin noch nervöser werden ließ, als sie es ohnehin schon war. »Die bedauernswerte Dame wußte nämlich nicht wohin, nachdem das Stift aufgelöst wurde, und da hat die Besitzerin des Hauses im grünen Grund sich liebreich ihrer angenommen.«
»Da kann diese was erleben!« lachte die Gräfin auf, es klang wie das Krächzen einer bösen Krähe. Ihr gelbliches Gesicht wurde weiß vor unterdrückter Wut, die Stimme war kehlig, die nun sprach:
»Die Schlössen ist ein ganz minderwertiger Mensch. Du tätest gut, Winrich, dafür zu sorgen, daß sie das Haus verläßt.«
»Ich?« fragte der Mann so erstaunt, als hätte er nicht recht gehört. »Wie käme ich denn dazu, einen fremden Menschen aus einem fremden Haus zu weisen. Da würde die Eigentümerin wohl von ihrem Hausrecht Gebrauch machen.
Und dann gestatte, daß ich dich korrigiere. Fräulein von Schlössen ist kein minderwertiger Mensch, sondern ein feiner, vornehmer. Ist eine liebe Tante nicht nur für die beiden jungen Damen, sondern auch für Oda.«
»Aber Winrich, als Beschützer deiner Schwester darfst du das doch nicht zulassen«, zeichneten sich zwei kreisrunde rote Flecke auf den leicht hervorstehenden Backenknochen der erregten Dame. »Du mußt das junge Kind doch vor jedem schlechten Einfluß bewahren.«
»Das laß nur meine Sorge sein. Wie kommt es übrigens, daß man bei den andern Damen, die das Stift verlassen mußten, vorher für Unterkunft gesorgt hatte, nur allein für Fräulein von Schlössen nicht? Ich muß mich deswegen doch mal an den Verband wenden, dessen Präses ich bin, wie du wohl weißt. Ich fürchte, daß man bei der Auflösung des Stifts nicht korrekt vorgegangen ist. Jedenfalls werde ich die Sache gründlich untersuchen lassen. Gesegnete Mahlzeit.«
Damit hob er die Tafel auf, eine frostige Verbeugung, dann ging er mit Oda davon, die sich in seinen Arm gehängt hatte. In der Halle fiel sie ihm um den Hals und küßte ihn stürmisch.
»Winrich, was bist du doch bloß für ein feiner Kerl! Hast du gesehen, wie grün ihr Gesicht wurde, als du sagtest, du würdest die Sache gründlich untersuchen lassen? Wie Angst in ihren Augen aufsprang und ihre Hände flatterten? Das alles muß ich denen im grünen Haus mal gleich erzählen.«
Weg war sie, und der Bruder sah ihr lächelnd nach. Kleiner lieber Sonnenstrahl, dachte er zärtlich, du erhellst meine einsamen, düsteren Tage.
Aber auch derjenige, der soeben hereingelacht kam, war so ein richtiger Sorgenbrecher.
»Na, unsere Oda war nicht wenig in Fahrt«, schmunzelte er. »Das Mäulchen sprudelte förmlich über, bei all dem so schrecklich Wichtigen, was es zu erzählen gab. So richtig klug bin ich daraus nicht geworden, da mußt du schon ergänzend eingreifen.«
Er unterbrach sich und machte eine Verbeugung zu der Gestalt hin, die durch die hohe Flügeltür in die Halle trat.
Wie eine Kassandra wirkend in dem düsteren Gewand, dem auffallend bleichen Gesicht, den flackernden Augen und dem verkniffenen Mund. Bevor die beiden Herren sich noch regen konnten, war die Gestalt wie ein Schemen verschwunden. Man sah noch den Zipfel ihres Gewandes auf der Treppe, dann war der Spuk vorbei, und der Baron zog den wie erstarrten Freund in sein Arbeitszimmer. Dort fragte er, ob ein Schnaps genehm wäre.
»Her damit!« schüttelte Gunder sich wie ein nasser Hund. »Den kann ich gebrauchen nach dem Schreck. Gott in deine Hände! Mann, da hast du dir aber mal eine prima Ahnfrau zugelegt. Die schwarze Frau von Grünehöh – klingt apart. Gib mir noch einen Schnaps – so, jetzt wird mir langsam wohler.«
Sie sahen sich an wie zwei lustige Verschwörer und nahmen dann in den tiefen Sesseln am Kamin Platz. Es war ein hohes, weites Gemach mit schweren, dunklen Möbeln, dem der rote, sehr kostbare Smyrna eine lebhafte Note gab. Der mächtige, reichgeschnitzte Schreibtisch war mit Kontobüchern und Papieren bedeckt, ein Zeichen, daß an ihm ernsthaft gearbeitet wurde.
Nachdem die Herren ihre Pfeifen gestopft und angesteckt hatten, gab Swidbörn die Ergänzung zu dem, was dem Freund bei der sprudelnden Erzählung Odas entgangen war, und dieser sagte pomadig:
»Schmeiß sie raus, das ist der einzige Rat, den ich dir geben kann. Aber da du dafür zu vornehm bist, überlaß es mir, ich erledige es mit Vehemenz. Die Frau ist ja von einer bodenlosen Gemeinheit. Nicht genug, daß sie das bedauernswerte Fräulein von Schlössen im Stift geknechtet und es hinterher ihrem Schicksal überlassen hat, versucht sie jetzt auch noch gegen es zu intrigieren und gute, warmherzige Menschen anzugreifen. Laß sie das ja nicht in meiner Gegenwart tun, dann hat’s aber gebumst. Denn wenn ich empört bin, dann bin ich nicht fein.«
»Hm«, schmunzelte der Freund. »Die aus dem Haus im grünen Grund scheinen dir ja sehr ans Herz gewachsen zu sein. Wer am meisten?«
»Die Frauke«, gab er unumwunden zu. »Sie hat so entzückende Grübchen, wenn sie lacht. Man könnte diese immerzu küssen.«
»Dann sieh zu, daß dir bald das Recht dazu gegeben wird«, riet Winrich, und der andere seufzte.
»So einfach ist das nicht. Man muß die Mädchen im grünen Haus mit einem andern Maßstab messen als die meisten. Sie sind wie ein Kräutlein Rührmichnichtan.«
»Also Mimosen«, bemerkte der Freund trocken. »Dann wirst du Draufgänger wohl dein Herz in beide Hände nehmen und deine Frauke erst umwerben müssen. Denn wie eine reife Frucht fällt dir das zurückhaltende Mädchen bestimmt nicht zu.«
»Würde ich mir auch ernstlich verbitten«, brummte Uwe. »So reife Früchte werden bald matschig, das haben wir beide ja erfahren müssen.«
»Kann man wohl sagen. Eigentlich bist du zu beneiden, daß du als gebranntes Kind nicht das Feuer scheust.«
»Ein Zeichen, daß die Flamme nicht gebrannt, sondern nur so ein bißchen gesengt hat. Aber ich habe ja auch nicht das ausgestanden, was du armer Kerl hast ausstehen müssen.«
»Was aber nur auf die Nerven ging und nicht aufs Herz.«
»Na, Gott sei Dank! Wohl selten hinterläßt ein Verstorbener so wenig oder gar keine Spuren wie deine Selige. Nichts, aber auch gar nichts erinnert hier mehr an sie. Versunken und vergessen, mehr hat die Megäre ja auch nicht verdient.
Aber wenden wir uns wieder erfreulicheren Dingen zu. Wie gefällt dir die Frauke?«
»Gut. Ihre Grübchen sind wirklich bezaubernd.«
»Aber küssen möchtest du sie nicht?«
»Nein. So weit geht mein Wohlgefallen nun auch wieder nicht.«
»Gut so, wenn auch unbegreiflich. Denn ein Mädchen wie Frauke muß doch jeden Mann betören.«
»Er ist verliebt, laßt ihn gewähren«, lachte Winrich, und Uwe sah ihn entrüstet an.
»Lach nicht, die Sache ist mir verflixt ernst. Mit Verliebtheit hat das nichts zu tun. Und nun enteile ich, damit du mir nicht noch immer tiefer den Dolch deines Spottes ins blutende Herz stoßest.«
Lachend sahen sie sich in die Augen und trennten sich mit warmem Händedruck. Ein Freund des andern gewiß, in unwandelbarer, oft erprobter Treue.
*
Am nächsten Vormittag fand sich der Tierarzt ein, um nach seinem maladen Patienten zu sehen, der ihn freundlich begrüßte. Gutwillig ließ er sich den Verband abnehmen und die Wunde pinseln, die sich fast schon geschlossen hatte. natürlich standen alle herum, einschließlich Oda. Selbst Bertchen hatte sich eingefunden. Und alle strahlten, als der Arzt die Wunde für so gut wie geheilt erklärte.
Was dem guten, sonst so fürsorglichen Tierarzt gar nicht recht war. Aber wenn er nicht mehr benötigt wurde, dann hatte er keinen Grund mehr, hierher zu kommen, was sein liebeheißes Herz betrübte. Wenn jedoch das Schicksal zwei Menschen füreinander bestimmt hat, dann sorgt es auch dafür, daß diese zueinander finden können. Und dazu gehört, daß sie sich begegnen, je öfter, je besser.
Als der Arzt nun den letzten Besuch bei seinem vierbeinigen Patienten gemacht hatte und so von Herzen traurig das Haus verließ, in dem es ihm doch so gut gefiel, stand am Gartentor eine Frau, die ihn aufgeregt empfing.
»Herr Doktor, ist bloß gut, daß ich Sie hier antreffe. Schon zweimal rief ich in der Praxis an. Kommen Sie schnell, unsere Kuh ist krank!«
»Wo wohnen Sie denn?« fragte er, dabei nach der Haustür schielend, in der Frauke stand.
»Schräg gegenüber, jenseits des Baches«, zeigte sie auf ein unweites Gehöft. »Wenn wir den Pfad durch den Wiesengrund nehmen, kürzen wir uns den Weg erheblich ab. Den Wagen können Sie doch hier stehen lassen, nicht wahr?«
»Selbstverständlich«, entgegnete Frauke, die jetzt am Gartentor stand. »Gehen Sie nur, Herr Doktor, auf Ihren Wagen passen wir schon auf.«
»Herzlichen Dank, gnädiges Fräulein. Ich melde mich dann wieder zur Stelle.«
Was eine Stunde später der Fall war. Und da man gerade den Nachmittagskaffee trank, mußte Frauke ihn höflichkeitshalber dazu einladen, versteht sich. Dankend nahm er die Tasse aus der Hand, die er am liebsten festgehalten und an die Lippen gedrückt hätte, was natürlich nicht anging. Schon gar nicht in Jadwigas und Ortruns Gegenwart. Ergo unterdrückte er sein heiß’ Verlangen und benahm sich so artig, wie es einem guterzogenen jungen Mann geziemt.
»Was fehlt denn der Kuh?« erkundigte sich Frauke, ihm den Teller zuschiebend, auf dem Napfkuchenstücke lagen, reichlich mit Mandeln und Rosinen gespickt. Genauso, wie seine Mutter ihn gebacken hatte, und Grübchen hatte sie auch gehabt. Was Wunder, wenn des Mannes Herz heiß und immer heißer wurde, daß ihn die Traulichkeit, die ihn an sein Elternhaus erinnerte, immer fester umspann.
»Herr Doktor, träumen Sie?« klang ein lustiges Lachen auf. »Ich habe gefragt, was der Kuh fehlt.«
»Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein«, lachte nun auch er, wenn auch verlegen. »Ich habe wirklich geträumt, bin jetzt aber wieder beieinander. Die Kuh, ja, die muß etwas eingefressen haben. Zum Glück hatte der Bauer ein Gegenmittel zur Hand, das seine Wirkung tat. Hoffentlich ist die Sache damit behoben.«
Sie war aber nicht behoben. Denn kurz nachdem der Arzt in seiner Praxis den letzten Vierbeiner abgefertigt hatte, rief der Bauer ihn telefonisch zu der kranken Kuh. Und was der noch sagte, klang wie Musik in den Ohren des Verliebten.
»Herr Doktor, Sie müssen aber wieder den Weg durch den Wiesengrund nehmen. Denn die Straße, die zu uns führt, ist stellenweise aufgerissen. Da kommen Sie mit dem Wagen nur langsam voran, und Eile tut not.«
So konnte es kommen, daß der bekannte Wagen wieder vor dem Haus im grünen Grund hielt, wo Hulda im Vorgarten die Blumen goß.
»Nanu, Herr Doktor, schon wieder hier –?« dehnte sie befremdet, wurde jedoch wieder freundlich, als der Mann ihr das Warum auseinandersetzte.
»Das ist ja was anderes. Dann gehen Sie man mit Gott für das arme Vieh und vergessen Sie nicht, uns Bericht zu erstatten.«
»Mit dem größten Vergnügen«, lachte er sie so strahlend an, daß sie stutzig wurde. Und als sie dann Frauke heiß erröten sah, als sie ihr von der Begegnung erzählte, da wußte sie Bescheid.
Sieh mal einer die Frauke an, schmunzelte sie in sich hinein. Da muß ich schon sagen: Die ist nicht dumm und nicht nuscht. Denn einen besseren Mann als den Viehdoktor könnte sie ja gar nicht kriegen – und er keine bessere Frau.
Aber was wird dann aus Jadwiga und Ortrun? grübelte sie weiter, als sie das Abendessen zubereitete. Daß sie hierbleiben, damit wird Gunder wohl nicht einverstanden sein. Arme Weibsen! Es wird ihnen bitter ankommen, wenn sie von hier fort müssen, wo sie so glücklich sind.
Und das waren sie wirklich. Das Haus im grünen Grund war für sie der Himmel auf Erden. Ortrun prangte nur so in ihrer Jugend Maienblüte, aber auch Jadwiga war förmlich aufgeblüht.
Seit gestern hatte sich sogar ihr Äußeres verändert. Bei einer ungeschickten Bewegung war ihr das ohnehin wacklige Pincenez entglitten und auf dem Steinboden der Terrasse zerschellt. Hilflos stand sie da, dem Weinen nahe. Doch schon wurde sie von Ortrun umfaßt und lachend getröstet:
»Mach dir nichts draus, Wigaleinchen. Das Dings hatte sowieso schon Altertumswert, und so richtig sehen konntest du damit längst nicht mehr. Spazieren wir also zum Optiker, wo du dir eine Brille verpassen läßt. Oder magst du das nicht?«
»Das schon. Aber ohne Glas bin ich sehr unsicher, wie soll ich da wohl zum Optiker hinkommen?«
»Das ist allerdings schwierig. Ein Gefährt steht uns leider nicht zur Verfügung, höchstens Michels Handkarre. Nun lachst du, das ist lieb. Laß mich mal angestrengt überlegen.
Halt, ich hab’s!« drückte sie der verblüfften Dame einen Kuß auf die Nase und wirbelte ab zum Telefon, wählte die Nummer, worauf es denn zu folgendem Gespräch kam:
»Ach, Sie sind es, Herr Baron?«
»Ja, warum denn nicht? Was enttäuscht Sie daran so sehr. Mit wem habe ich überhaupt…«
»Mit Ortrun Danz.«
»Ah, denn mal schönen guten Tag, gnädigs Fräulein. Wen wollen Sie sprechen?«
»Oda.«
»Die ist leider nicht da. Reitete mit dem Oberinspektor über Land.«
»Wie schade! Sie sollte mir nämlich helfen. Ich brauche ein Auto – das heißt, ich nicht, sondern Fräulein von Schlössen, und nun kann sie nicht – und nun weiß ich nicht… Entschuldigen Sie, Herr Baron.«
»Halt, gnädiges Fräulein, nicht auflegen!« hinderte die lachende Männerstimme sie daran, das Gespräch zu beenden. »Ich glaube nämlich, aus Ihrem kläglichen Gestammel dennoch klug geworden zu sein. Sie wollten Oda bitten, im Auto zu Ihnen zu kommen, stimmt’s?«
»Ja.«
»Aber sie hat doch noch gar nicht den Führerschein mit ihren sechzehn Jahren.«
»Das weiß ich. Doch ich hoffte, daß sie in Begleitung des Chauffeurs. Oder habe ich da zuviel verlangt?«
»Keineswegs, gnädiges Fräulein. Diese Gefälligkeit hätte Oda Ihnen mit Freuden erwiesen. Wozu benötigen Sie denn einen Wagen?«
»Um ins Dorf zum Optiker zu fahren. Fräulein von Schlössen hat ihr Augenglas zerschlagen und ist nun hilflos, kann so gut wie nichts sehen.«
»Danke, das genügt mir. Ich bin so schnell wie möglich zur Stelle.«
»Bitte nicht!« rief Ortrun in die Muschel. Doch zu spät, drüben war bereits eingehängt.
Bestürzt legte sie die Handflächen gegen die heißen Wangen und ging zur Terrasse zurück, wo sich mittlerweile Frauke eingefunden hatte, der Jadwiga soeben von ihrem Malheur erzählte. Und als sie von Ortrun hörte, was diese sich geleistet hatte, sagte sie vorwurfsvoll:
»Mädchen, wie konntest du nur den Mann bemühen. Er ist uns doch so gut wie fremd.«
»Ich wollte das ja gar nicht«, bekannte Ortrun kläglich. »Ich wollte Oda an den Apparat haben, um sie zu bitten, den Chauffeur mit dem Wagen herzuschicken. Daß der Baron an dem Fernsprecher sein würde, damit habe ich nicht gerechnet. Außerdem ist Oda nicht zu Hause. Sie ist mit dem Oberinspektor über Land geritten. Da habe ich mit meinem spontanen Anruf ja was Schönes angerichtet.«
»Nun, so schlimm ist es auch wieder nicht«, beschwichtigte Frauke, »der Herr Baron hat sich ja erboten, herzukommen, tut es somit nicht gezwungenermaßen. Halt, Tante Jadwiga, wo willst du hin?!«
»Mantel, Hut und Handtasche holen.«
»So ein Leichtsinn! Als ob wir das nicht könnten.«
»Aber ich möchte doch keinen bemühen.«
»Sieht dir nämlich ähnlich. Bleib du ja in deinem Sessel, so unsicher wie du ohne Augenglas bist. Hol die Sachen, Ortrun und halt auch du dich bereit, damit der Herr Baron nicht noch warten muß. Denn wie wir von Oda wissen, ist ihm Unpünktlichkeit verhaßt.«
Also beeilte man sich und war gerade bereit, als Swidbörn erschien. Nun er Jadwiga, die er ja zum ersten Mal erblickte, dastehen sah, mit dem ängstlichen, wie um Verzeihung bittenden Blick, wurde es ihm erst so recht bewußt, wie unerhört diese hilflose Stiftsdame von der despotischen Oberin schikaniert worden war. Und wenn er diese Dame bisher nicht geschätzt hatte, so stieg jetzt in ihm Verachtung zu ihr auf. Mit einem warmen Blick, den man diesen hellblitzenden Augen kaum zugetraut hätte, verneigte er sich vor Jadwiga.
»Da bin ich, gnädiges Fräulein. Verfügen Sie über mich.«
»Bitte, Herr Baron, ich bin nicht daran gewöhnt, daß man meinetwegen Umstände macht.«
»Dann wird es dazu aber Zeit, will ich meinen. Wie ich hörte, wollen Sie mit Fräulein von Schlössen zum Optiker?« wandte er sich jetzt Ortrun zu.
»Ganz recht, Herr Baron. Das heißt, wenn er ohne vorherige ärztliche Untersuchung eine Brille zupassen kann.«
»Ohne weiteres. Er ist nicht nur Optiker, sondern auch Augenarzt.«
»Na, siehst du, Tante Jadwiga, da kommst du in fachmännische Behandlung. Stütze dich fest auf meinen Arm, dann kann dir nichts passieren!«
Auch Frauke hielt ihr den Arm hin. So treulich geführt, gelangte Jadwiga zum Auto, wo man sie im Fond verstaute, während Ortrun neben dem Führersitz Platz nahm.
Warum sie dabei Herzklopfen hatte, wußte sie selbst nicht. Scheu huschte ihr Blick zu dem Mann hin, der ihr so hoheitsvoll vorkam, so herrisch und unnahbar. Das stolze Antlitz erschien ihr wie aus Erz gegossen, die Augen verglich sie mit blitzenden Kieseln. Die nervigen Hände, die das Steuerrad hielten, ließen wohl nicht mehr los, was sie einmal gepackt hatten. An der Linken glänzte der schwergoldene Wappenring, der Ringfinger der Rechten war leer.
Ortrun hatte keine Ahnung, daß der Mann sie beobachtete. Konnte sich daher das Lächeln nicht erklären, das plötzlich seinen hartgeschnittenen Mund umzuckte. Nur gut, daß sie keine Gedanken lesen konnte.
*
Als Jadwiga neu bebrillt zum Auto ging, tat sie das so sicher, wie schon lange nicht mehr.
»Herzchen, ich kann ja jetzt erst so richtig sehen«, sagte sie beglückt zu Ortrun, als man vor dem Wagen stand, in dem der Baron bereits wartend saß, nachdem er einige Besorgungen gemacht hatte. »Und das danke ich dir, du liebes, gutes Kind.«
»Nichts da, Tante Jadwiga«, lachte das Mädchen. »Der Dank gebührt deinem Pincenez, das Mitleid mit dir hatte, als es am Fliesenboden sein bejahrtes Leben aushauchte. Wenn du durch die altersschwachen Gläser so schlecht sehen konntest, warum hast du dich so lange damit herumgequält?«
»Weil ich dachte, es muß so sein. Außerdem trenne ich mich so schwer von meinen Sachen.«
»Bis sie sich selbst in Wohlgefallen auflösen«, bemerkte Ortrun trocken. Als sie nach Hause fuhren, sagte Jadwiga aufgeregt:
»Nun habe ich doch tatsächlich vergessen, die Brille samt der Untersuchung zu bezahlen – oder doch?«
»Doch, Tante Jadwiga«, bemühte Ortrun sich, harmlos zu tun. »Hast du denn vergessen, daß du mir dein Portemonnaie zur Begleichung der Rechnung übergabst?«
»Ja, jetzt besinne ich mich wieder. Hat denn das Geld auch gereicht?«
»O ja. Es ist sogar noch was übriggeblieben. Die Quittung findest du im Geldtäschchen.«
Das stimmte. Nur daß der Betrag auf den Belegen erheblich reduziert war. Der Arzt hatte sofort geschaltet, als Ortrun ihn bat, der weltfremden Dame ein X für ein U zu machen.
Aber bei dem Mann an ihrer Seite gelang ihr das nicht. Errötend senkte sie den Kopf unter seinem forschenden Blick. Mußte jedoch lachen, als er die Melodie aus Lortzings »Zar und Zimmermann« vor sich hin pfiff: Ja ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht.
Damit endete die Fahrt. Der Wagen hielt und ihm entstieg eine Jadwiga mit strahlendem Gesicht.
»Frauke, Hulda, Michel, Ajax, ich kann wunderbar sehen«, verkündete sie glückselig denen, die herbeigeeilt waren – und alle freuten sich mit ihr. Selbst der Hund blaffte freudig auf und brachte den Schwanz in stürmische Bewegung.
Dem Baron wurde es warm ums Herz. Nur ungern schlug er Fraukes Aufforderung ab, näherzutreten. Doch er mußte zu einer wichtigen Unterredung, und Pflicht ist nun einmal Pflicht. Er bat jedoch ein andermal vorsprechen zu dürfen, was ihm gern gestattet wurde.
Einige Tage später hatte Jadwiga Geburtstag, den die beiden Mädchen dazu benutzten, ihr eine kleine, aber gediegene Aussteuer zu schenken. Fassungslos stand das Geburtstagskind vor dem reichen Gabentisch, auf dem Kleidungsstücke lagen, die aus der altmodischen Dame eine vornehme Erscheinung machten, die den Tierarzt, der um den Geburtstag wußte, und mit einem Strauß Frühlingsblumen anrückte, überraschte.
»Oha, hier kann man wirklich sagen, daß Kleider Leute machen«, raunte er Frauke zu, die so allerliebste Grübchen zeigte, daß er rasch von ihr wegtrat und dem Geburtstagskind mit vielen guten Wünschen den Strauß überreichte. Daß er zum Kaffee blieb, war jetzt schon selbstverständlich.
Man konnte den Kaffee gerade noch trinken, da kam im wahrsten Sinne des Wortes ein Blitz aus heiterem Himmel. Es gelang gerade noch, sich und die Sachen in Sicherheit zu bringen, da tobte auch schon ein heftiges Gewitter los, das so plötzlich abzog, wie es gekommen war. Das heißt, der Himmel blieb wolkenverhangen, und der Platzregen war in sachten Regen übergegangen, die die lange durstende Natur wunderbar erquickte.
Man hatte sich im Salon niedergelassen, weil da der Stutzflügel stand, an den Ortrun heran mußte, ob sie wollte oder nicht.
»Warum gerade ich«, brummte sie. »Es sind ja noch vier andere da.«
»Meinen Sie mich auch damit?« fragte Uwe schmunzelnd. »Dann muß ich Ihnen sagen, gnädiges Fräulein, daß ein Klavier für mich ein Dreschkasten ist. Und wenn ich meine Stimme erschallen lasse, rasen bestimmt Bertchen und Michel herbei, weil sie annehmen, daß ich jämmerlich nach Hilfe schreie.«
Da mußte Ortrun mit den andern lachen und bequemte sich endlich zum Spiel. Placierte sich, während Frauke die Kerzen in dem Leuchter anzündete, der auf dem Flügel stand. Man suchte sich bequeme Plätze, bis auf Oda. Die kauerte sich auf ein Fußkissen und legte das Gesichtchen auf das Seitenende des Instruments. Die langen Zöpfe berührten den Boden, in den Augen spiegelte sich der Schein der Kerzen, genauso wie in den Ortruns, die das aufgestellte Notenbuch zuklappte und dann leise zu präludieren begann. Allmählich wurden die Töne sicherer, reihten sich wie Perlen aneinander – und dann erklang Mozarts »Romanze« so zart und süß, daß sie die Zuhörer in ihren Bann zog.
Auch den Mann, der in der Tür stand. Als Frauke ihn bemerkte, winkte er ab, trat leise näher, legte der überraschten Jadwiga einen Strauß erlesener Blüten in den Schoß und setzte sich in den Sessel, den Frauke ihm mit einer Handbewegung zuwies.
Sein Blick hing an der Spielerin, deren feines Gesicht ihm im Profil zugekehrt war. Über das leichtgeneigte Köpfchen huschte der Schein der Kerzen, ließ das einzigschöne Gelock aufsprühen in metallischem Glanz. Tändelnd huschten die zarten Finger über die Tasten, ihnen Töne entlockend, die aus einer Äolsharfe zu kommen schienen.
Als Spiel und Gesang verklang, war es zuerst einmal still. Oda erhob sich, trat zu Ortrun und drückte ihre Lippen auf die weiche Wange, dann ein abgrundtiefer Seufzer:
»War das schön. Ich wünschte, ich könnte so spielen und singen wie du.«
Das wünschte auch der Bruder – und noch mehr. Daß seine kindliche Schwester so werden möchte wie dieses bezaubernde Menschenkind. Es war das größte Kompliment, das er zu vergeben hatte. Schade, daß er es nicht aussprechen durfte.
Auch nicht über die Veränderung, die sozusagen über Nacht mit Jadwiga vor sich gegangen war. Und das hatten sie zuwege gebracht, die beiden Mädchen aus dem Haus im grünen Grund.
Und was sagte sein Freund Uwe dazu? Der mußte sein Herz krampfhaft festhalten, damit es ihm nicht durchging. Aber bald würde es das tun – und dann?
Es waren dieselben Gedanken, wie Hulda sie hegte. Was wurde dann aus dem alten und dem jungen Fräulein, die hier ein so trautes Zuhause fanden. Wohl würde Uwe, soweit Winrich ihn kannte, die beiden sozusagen mitheiraten, aber es konnte dann nicht mehr so sein, wie es jetzt war.
Denn jetzt gehörte ihnen die reizende Frauke ungeteilt. Doch mit dem Moment, wo Uwe Rechte an sie haben durfte, würde ihr Herz so ausgefüllt sein, daß die andern sich nur mit kläglichen Resten begnügen mußten.
Arme Ortrun, dachte er traurig. Arme Jadwiga.
Als hätte er sie gerufen, trat diese nun auf ihn zu.
»Ich möchte mich für die herrlichen Blumen bedanken, Herr Baron. Ach, ich bin ja so glücklich, so liebe Menschen und ein so wunderschönes
Zuhause gefunden zu haben.«
Das gab dem Mann einen Stich ins Herz. Tief neigte er sich über die feine Hand und sagte herzlich:
»Alles nur denkbar Gute wünsche ich Ihnen für das neue Lebensjahr, gnädiges Fräulein.«
»Danke, Herr Baron. Hier kann es mir gar nicht anders als gutgehen.«
In dem Moment schlug der Gong an, worauf der Gast sich verabschieden wollte, was Frauke unterband.
»Daraus wird nichts, Herr Baron. Kommen Sie nur, es gibt was Gutes!«
»Wovon ich überzeugt bin, gnädiges Fräulein. Aber…«
»Kein Aber! Sie bleiben und damit holla!«
Da blieb er und fühlte sich äußerst wohl in dem gemütlichen Kreis. Wenn er dabei an sein Zuhause dachte, tat ihm das Herz weh. Ein Glück, daß Oda hierher flüchten konnte, wenn ihr in dem kalten, öden Schloß traurig zumute war. Hier fand sie alles, was ein junges Menschenkind brauchte, Lachen, Frohsinn und offene Herzen.
Nach dem Abendessen, das wirklich delikat war, ging man hinüber in die Bibliothek, wo im Kamin ein helles Feuer loderte.
»Hulda machte es, während wir aßen«, erklärte Frauke. »Nach dem Regen hat es sich draußen erheblich abgekühlt, und ohne Feuer wäre es hier direkt kalt. Bitte, meine Herrschaften, sich zwanglos zu gruppieren. Für einen guten Trunk werden unsere beiden Jüngsten sorgen.«
»Sekt?« fragte Oda erwartungsvoll.
»Jawohl. Geht nur zu Hulda, da steht alles bereit.«
Vergnügt trollten sie ab, und als sie wiederkamen, schob Ortrun den Servierwagen vor sich her, auf dem außer Gläsern ein Kühler stand, aus dem zwei Hälse verlockend ragten. Zwei weitere Flaschen trug Oda, die Uwe natürlich wieder necken mußte.
»Wirst du die auch schaffen, Fips?«
»Diese Bezeichnung verbitte ich mir!«
»Herrje, verzeih, du bist ja eine junge Dame von Stand.«
»Und du ein junger Mann von Unverstand!«
Somit hatte sie die Lacher auf ihrer Seite. Zufrieden setzte sie sich neben Ortrun, Uwe ließ den Pfropfen knallen, füllte die Gläser, dann trank man auf das Wohl des Geburtstagskindes. Daß Uwe die reizende Frauke dabei so eigen ansah und sie unter dem Blick heiß errötete, bemerkte nur Winrich. Die anderen waren zu sehr mit dem prickelnden Getränk beschäftigt, das wie ein heißer Strom durch die Adern floß.
»Na, du hast vielleicht einen Zug«, lachte Ortrun das Baroneßchen an. »Dein Glas ist ja leer.«
»Ach was, man muß die Gelegenheit wahrnehmen. Wer weiß, wann ich mich mal wieder einmal so köstlich laben kann.«
»Und wenn du einen Schwips kriegst?«
»Dann ist der Fips blau.«
»Ei, Uwe, ärger mich nicht. Ich hab einen schlechten Rausch. Sag doch selbst, Ortrun, ist das nicht ein gräßlicher Mensch?«
»Nein, ich finde ihn sehr nett.«
»Herzlichen Dank, gnädiges Fräulein!« hob er ihr lachend das Glas entgegen… »Dafür eröffne ich beim Schützenfest mit Ihnen den Tanz.«
»Schützenfest?« fragte Oda mit blanken Augen. »Wann ist es denn?«
»Sonntag.«
»O wie schön! Wir gehen doch hin, Winrich?«
»Als Ehrenmitglied wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben – trotz der Trauer.«
»Ach was, Trauer.«
»Oda!«
»Verzeih!« senkte sie verlegen das Köpfchen. »So darf ich gar nicht tanzen?«
»Doch, das darfst du.«
»Da freu ich mich aber«, strahlte sie schon wieder. »Ihr kommt doch auch zu dem Fest?«
»Ehrensache«, antwortete Uwe. »Grün sind die Schützen und grün sind die Damen.
Ich meine doch das Haus!« schrie er in das ausbrechende Gelächter hinein. »Wie kann man mich nur so mißverstehen.«
»Na?« zweifelte Ortrun mit schiefgelegtem Köpfchen. Sie sah dabei so entzückend aus, daß Oda sie ganz verdutzt ansah.
»Hör mal, du bist vielleicht hübsch. Wenn das so weitergeht, was soll das bloß noch werden.«
»Erst einmal eine Schützenprinzeß«, schmunzelte Uwe. »Nicht wahr, gnädiges Fräulein, das wäre doch was.«
»Ich weiß ja gar nicht, was das ist.«
»Sie werden ausgelost.«
»Wie abscheulich!« unterbrach sie ihn empört. »Ich bin doch keine Schachtel, keine Wurst, keine Gans. Ja warum lacht ihr denn so unbändig? So was kommt doch immer zur Verlosung.«
»Goldige, wenn du wüßtest, wie reizend du bist in deinem Zorn«, wische Frauke sich die Lachtränen aus den Augen, und Ortrun brummte:
»Schützenprinzeß, so ein Unsinn. Unter ähnlichem habe ich schon im Töchterheim genug zu leiden gehabt. Mich hatte man immer am Bändel, wenn etwas vorgeführt oder vorgetragen wurde. Und bei der Tanzstunde war ich diejenige, der man am meisten auf die Füße trat.«
Da mußte man wieder über sie lachen, und Uwe raunte Frauke zu:
»Sie ist wirklich eine Goldige, die Kleine.«
»Das ist sie«, flüsterte Frauke zurück. »Dabei wird sie schöner mit jedem Tag.«
»Nun, Sie können sich wahrlich auch nicht beklagen«, umfaßte er sie mit einem bewundernden Blick. »Wie mir ein Bekannter erzählte, soll der Gemeindevorsteher einmal gesagt haben: Es blühen zwei köstliche Blumen im Garten vom grünen Grund.«
»Bitte, Herr Doktor!«
»Na ja, ich bin schon still«, seufzte er, und da wandte sie sich hastig ab, Jadwiga zu.
»Ist’s schön so?« fragte sie leise.
»Ach Kind, fast zu schön um wahr zu sein. Gott segne das Haus im grünen Grund!«
*
Als Baron Swidbörn und seine Schwester kurz nach zehn Uhr die Halle des Schlosses betraten, lachte ihnen Barbe vergnügt entgegen und auch Niklas schmunzelte in sich hinein.
»Sie ist weg«, platzte erstere schon heraus, bevor die Angekommenen noch eine Frage stellen konnten. Setzte dann jedoch schuldbewußt hinzu: »Ich meine die Frau Gräfin Warl.«
»War die denn hier?«
»Sehr wohl, Herr Baron«, sprach nun der Diener, nachdem er seiner Ehehälfte einen verweisenden Blick zugeworfen hatte. »Die Frau Gräfin erschien in einem Mietauto, das draußen wartete, bis die Frau Gräfin gepackt hatte und wieder abfuhr. Mit Verlaub zu sagen, ging das alles Hals über Kopf.«
»Da schlag einer lang hin«, verfiel Baroneßchen verblüfft in Michels Redewendung, und der Bruder fragte:
»Hat die Frau Gräfin denn nicht gesagt, warum dieser überstürzte Aufbruch sein mußte?«
»Nein, Herr Baron.«
»Merkwürdig.«
Damit war für ihn die Sache vorläufig abgetan, aber nicht so für das neugierige Schwesterlein. Das fragte Barbe, die ihm beim Auskleiden half, so richtig aus, wollte alles ganz genau wissen, was nun doch wirklich interessant war. Nachdem die Frau Gräfin hier einige Tage verweilte, wie eine gekränkte Königin, begab sie sich auf eine kurze Reise, wie sie dem Gastgeber gnädig erklärte. Hatte ihn um ein Gefährt »ersucht«, das sie zur Bahn brachte. Dann erschien sie hier ganz unerwartet in einem Mietauto, packte Hals über Kopf und fuhr ab? Wenn das nicht interessant war!
»Rasch, erzähle, Barbe!« und die erzählte:
»Es war so gegen neun Uhr, als die Frau Gräfin hier plötzlich auftauchte, schwarz und düster wie ein Gespenst. Sie jagte damit sogar Niklas einen Schreck ein, was ja nun nicht oft vorkommt. Nachdem uns die Dame einen vernichtenden Blick zugeworfen hatte, rauschte sie nach oben und rumorte dort herum, bis ein Sturmklingeln uns zu der Gnädigsten beorderte.
›Tragt das Gepäck ins Auto!‹ herrschte sie uns an, rauschte davon und fuhr dann ab.«
»Wann war das?«
»Kurz bevor Sie eintrafen, Baroneßchen.«
»Na so was. Was mag die wohl nur in die Flucht gejagt haben.«
Das sollte man am nächsten Tag erfahren. Die Geschwister saßen gerade beim Frühstück, das sie am Sonntag länger auszudehnen pflegten, weil er ein Ruhetag für den rastlos arbeitenden Mann war, als ein Anruf aus dem Dorothea-Stift kam. Die Oberin war am Apparat, die den Neffen, der das Gespräch entgegennahm, munter begrüßte:
»Guten Morgen, mein Junge! Das Leben noch frisch?«
»Meins schon, Tante Herma, und deins?«
»Ich bin kreuzfidel. Hast du Zeit?«
»Für dich immer.«
»Hört man gern. Komm her und bring das Firlefänzchen mit! Ich habe schon so richtige Sehnsucht nach euch. Doch vorher die Frage: Ist die Gräfin Warl im Haus? Wenn ja, dann schmeiß sie raus!«
»Aber Tante Herma«, lachte er herzlich und erzählte dann, was sich gestern in seiner und Odas Abwesenheit hier zugetragen hatte, worauf die kurz angebundene Dame befriedigt sagte:
»Das ist gut, da bleibt dir noblem Kerl eine Unannehmlichkeit erspart.«
»Tante Herma, ich bin ein einziges Fragezeichen.«
»Komm her, dann biege ich dich wieder gerade!«
Lachend wurde abgehängt und zehn Minuten später fuhren die Geschwister dem Dorothea-Stift zu, das zwölf Kilometer entfernt lag und daher bald erreicht war. Das Gebäude glich einem Gutshaus, zumal die Vorderfront dem Hof zu lag mit seinem ländlichen Betrieb, während die Rückfront zum Park zeigte.
Als das Auto hielt, sah man hinter den Fenstern lachende Gesichter, die dem beliebten Geschwisterpaar herzlich zunickten. Es ließ sich jedoch niemand unten sehen, da die Damen wußten, daß der Besuch der Oberin galt, die ihn dann auch in Empfang nahm. Eine Dame, die man mit vornehm bezeichnen konnte. Die zierliche Gestalt wirkte direkt mädchenhaft, das Gesicht zeigte unverkennbar die geborene Swidbörn, gleichfalls die leichtangegrauten blonden Haare und die blauen Augen. Daß sie eine Blutsverwandte der Geschwister war, sah man auf den ersten Blick.
Eine charmante Dame, die Gräfin Attbach, klug, geistreich, gewandt und mit Sinn für Humor, weil sie selbst welchen besaß. Eine Oberin, wie sie sein soll. Liebenswürdig, gerecht, nachsichtig da, wo es angebracht war, unnachsichtig bis zur Härte, wenn es um Übeltäter ging. Sie wurde von ihrer Schar, wie sie die Stiftsdamen nannte, sehr verehrt.
»Da seid ihr ja«, begrüßte sie die Geschwister herzlich. »Siehst noch vergrämt aus, Junge, aber das wird sich schon geben, nun du dein Kreuz los bist.
Und was ist mit dir, Firlefänzchen? Was ist nun mehr gewachsen bei dir, das Figürchen oder die Zöpfe?«
»Beides«, lachte Oda, die Dame stürmisch umhalsend. »Wie schön, dich wiederzusehen nach dieser schrecklich langen Trennung.«
»Ja, mein Herzchen, zuerst die Krankheit, hinterher die Kur im Badeort, das macht schon etliche Wochen aus. Kommt weiter!«
Es war ein vornehmes Gemach, das sie aufnahm. Jeder Gegenstand darin war gediegen und wertvoll. Man nahm Platz und Oda wurde ein Teller zugeschoben, dessen Inhalt ihr Leckermäulchen entzückte. Doch jetzt griff die Kleine noch nicht zu, jetzt hingen ihre Augen fragend an dem feinen Antlitz der Tante, die ihr dann auch den Gefallen tat, mit ihrem Bericht zu beginnen.
»Also erst einmal vorweg, daß die Gräfin Warl hier im Stift war. Da staunt ihr, was?«
Oda tat’s, doch der Bruder sagte lächelnd:
»So ungefähr habe ich mir das gedacht. Denn der Brief, den sie mir schrieb, bevor sie bei uns erschien, ließ durchblicken, daß sie sich dem Wahn hingab, hier Oberin zu werden. Deshalb war sie hier, um die Lage zu peilen.«
»Junge, ich staune über deine Kombinationsgabe. Sie war tatsächlich deshalb hier. Kam die ›liebe, gute Freundin‹ besuchen, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen.«
»Wer ist denn die liebe gute Freundin?«
»Baroneß Salten.«
»Ausgerechnet dieser feine, vornehme Mensch?«
»Jawohl, ausgerechnet. Der gegenüber hat sie durchblicken lassen, daß du dich mit dem Gedanken trägst, mich meiner Gebrechlichkeit wegen hier abzusetzen und sie mit dem Posten der Oberin zu betrauen, was mir natürlich brühwarm hinterbracht wurde. Damit hätte diese Person ja eigentlich rechnen müssen, aber dafür ist sie wohl zu dumm.«
»Das ist sie«, bekräftigte Winrich. »Sonst hätte sie unmöglich so bornierte Behauptungen aufstellen können, nachdem ich ihr deutlich zu verstehen gab, daß man bei der Auflösung des Anna-Stifts wohl nicht korrekt vorgegangen sein könne und ich die Sache untersuchen lassen werde.«
»Aha! Nun, das erzähle ich später. Also meine gute Salten war zutiefst empört. Sie bat mich inständig, sie doch von dieser üblen Intrigantin zu befreien, mit der sie vor Jahren mal auf einer Gesellschaft zusammentraf. Eine Anmaßung von der Person, sie nicht nur Freundin zu nennen, sondern sie gar noch im Stift aufzusuchen und sie in einer infamen Art zu blamieren.
Nun, so tauchte ich denn auf. Man sagt mir nach, daß meine Worte zuzeiten schneiden können wie spitze Messer, was ich dir übrigens vererbt zu haben scheine, mein Sohn. Und die Worte schnitten so sehr, daß sie dieser üblen Person sozusagen die bösartige Zunge abschnitten. Ich rief sofort Grünehöh an, um dir diese skandalöse Angelegenheit zu unterbreiten, doch du warst mit Oda im Haus im grünen Grund, wie mir Niklas sagte, und ehe wir uns so recht versahen, war die Warl verschwunden. Machte sich deine Abwesenheit zunutze, um klammheimlich zu verschwinden, weil sie auch noch dein Strafgericht fürchtete.
Übrigens habe ich ihr absichtlich in Anwesenheit meiner Schar den Standpunkt klargemacht. Sie sollte so blamiert werden, daß man mit Fingern auf sie zeigt. Kein Stift darf diese gemeingefährliche Person mehr aufnehmen, dafür müssen wir sorgen, mein Junge.«
»Und dabei weißt du noch nicht einmal, wie gemeingefährlich sie ist«, sagte der Neffe und erzählte dann von Fräulein von Schlössen, von dem grünen Haus, in dem die Ausgestoßene so liebevolle Aufnahme fand. Und als er von den Menschen dort zu sprechen begann, unterbrach ihn das Schwesterlein, weil es das Zünglein nun wirklich nicht länger zügeln konnte. Alles bis ins kleinste bekam die gute Tante Herma zu hören, die sich dann auch einen Vers daraus machte, über das Ausgesprochene und das Unausgesprochene. Um das zu ergründen, sagte sie lachend:
»Nach deiner Begeisterung zu schließen, muß es ja ein ganz phänomenales Haus sein, das Haus im grünen Grund. Das muß ich mir unbedingt einmal ansehen und werde mich daher nächstens auf dem Schloß meiner Ahnen einfinden.«
»Wirklich, Tante Herma? Da freu ich mich aber. Du bleibst doch lange?«
»Ich weiß zwar nicht, was du unter lange verstehst, aber ein Weilchen kann es schon sein, da ich in der Beroneß Salten jetzt eine gute Vertretung gefunden habe, wie sie während meiner Krankheit und anschließenden Erholungszeit unter Beweis stellte. Und nun kommt, damit ich euch meiner Schar offerieren kann, die schon sehnsüchtig darauf wartet, ihre Lieblinge begrüßen zu können.«
*
Hell und klar stieg der Sonntag herauf, der das mit Ungeduld erwartete Schützenfest bringen sollte; denn das Schützenfest ist in einem Dorf das größte und beliebteste Fest des Jahres. Alles, was nur zwei gesunde Beine hat, findet sich auf dem weiten Gelände ein, auf dem das schmucke Schützenhaus steht. Auf dem etwas abseits liegenden großen Platz sind Buden aufgestellt, Karussells und so weiter. Man kann im Schützenhaus tanzen, im Zelt oder auf der Tanzfläche unter freiem Himmel. Überall spielen Kapellen, und auf dem Platz dudelt Karussellmusik. Die Damen glänzen in schicken Kleidern, die Herren in feschen Anzügen und die Mitglieder der Schützengilde in der schmucken Uniform. Es wird scharf darauf geachtet, wer von den Honoratioren da ist. Wer nicht da ist, dem wird das sehr übelgenommen.
Am Vormittag sind die von der Gilde, bis auf neugierige Zuschauer, unter sich. Da wird nach der Scheibe geschossen, der Schützenkönig wird gewählt, der sich wiederum seine Königin erkürt, die mit der Krone geschmückt und mit Ketten behängt wird, wobei der »königliche Gemahl« auch nicht zu kurz kommt. Dann werden beide becourt, beehrt und dürfen ihr Portemonnaie weit aufmachen.
Daß das höchste Ehrenmitglied der Gilde trotz seiner Trauer zugegen war, wurde ihm hoch angerechnet. Schneidig sah er aus, in der schmucken Uniform, gleichfalls sein Intimus, der Tierarzt. Beide beliebte und hochgeachtete Persönlichkeiten, gewissermaßen die Elite des Dorfes.
Um zwei Uhr ging dann der Rummel erst richtig los. Da konnte man wohl sagen: Strömt herbei, ihr Völkerscharen. Arm und reich, jung und alt, dick und dünn, alles war reichlich vertreten, darunter auch Feriengäste. Alle waren sie frohgemut und leichtbeschwingt.
Und über allem lachte die Sonne; denn es war ja noch immer Mai, der erst nach dem Pfingstfest am nächten Sonntag Abschied nehmen würde.
Der Clou vom Ganzen waren entschieden die Damen aus dem Haus im grünen Grund, nebst dem bei allen Hiesigen beliebten Baroneßchen. Auch Hulda war mit, die in ihrem »Staat« ganz stattlich aussah. Als sie auftauchten, wurden sie von einem Schützen an den Honoratiorentisch geführt, wo der Baron die Vorstellung übernahm. Namen schwirrten, Herren dienerten, Hände fanden sich zu festem Druck. Danach konnte man sich zwanglos placieren.
Ortrun warf der ihr gegenübersitzenden Frauke einen lachenden Blick zu, zeigte mit einer Kopfbewegung nach rechts und nach links – und schon war die andere im Bilde. Da saßen sie alle, die damals mit ihnen das Abteil besetzt hatten, bis auf die Dame mit ihren ungezogenen Kindern. Die etwa am Tisch ertragen zu müssen, von dem Kelch blieben sie verschont.
Doch die andern waren alle da. Hulda, Frauke, Ortrun, die Dame mit dem Pincenez, die jetzt allerdings kaum noch wiederzuerkennen war, der strenge Herr, der cholerische Herr und der große blonde, benamst mit Uwe Gunder.
Selbst die Dicke aus der Kleinbahn fehlte nicht, die wie die personifizierte Gemütlichkeit an der Seite ihres Gatten saß, des Domänenpächters Scholt. Vertraulich nickte sie den beiden jungen Mädchen und Hulda zu, die an der Seite des Barons saß. An der anderen Seite hatte sie Frauke, die von dem Tierarzt beehrt wurde. Wie könnte es auch anders sein.
Ihnen gegenüber saß Ortrun, von Oda und Jadwiga eingerahmt. Diese konnte man mit distinguiert bezeichnen, erster mit allerliebst. Ein hellblaues Kleid mit rosaroten Knöspchen am Ausschnitt, umbauschte das Figürchen. Die blonden Zöpfe glänzten, die blauen Augen strahlten.
Und Ortrun? Für die gab es nur eine Bezeichnung: Bezaubernd. Hatte das Mädchen einzigschönes Haar und ein paar Augen im Kopf – olala! Ihr Kleid war weiß, ohne jede Verzierung, aber es hatte es in sich. Eng die Taille, weit der Rock. Eine Bernsteinkette, eine Armbanduhr und ein Ring – das war der Schmuck des reichsten Mädchens auf dem weiten Platz.
Und Frauke? Die war für den verliebten Uwe die Schönste von allen. Bitte sehr! Hatte etwa noch jemand so allerliebste Grübchen, so dichtbewimperte grüngraue Augen, so wunderbar gepflegtes kastanienbraunes Haar, eine so ranke Figur und ein so schickes hellgrünes Kleid? Na also!
Und diese Schönste wurde nun vorwurfsvoll gefragt:
»Wollen wir hier festwachsen, gnädiges Fräulein?«
»Nein, ich will mich amüsieren.«
»Na wunderbar. Fangen wir gleich damit an.«
Worauf sie sich erhoben und davongingen. Die ungeduldige Oda zog Ortrun mit sich fort, so daß die älteren Herrschaften allein zurückblieben. Darunter allerdings auch der Baron, der sich wegen der Trauer zurückhalten mußte, obwohl es gar nichts für ihn zu betrauern gab. Aber er mußte doch mal in seiner exklusiven Stellung den Menschen mit gutem Beispiel vorangehen, das wurde direkt von ihm verlangt.
Langweilig wurde es ihm trotzdem nicht, dafür sorgte schon Frau Schölt mit ihrem trockenen Humor. Außerdem fand sich immer jemand, der sich an des Mannes Seite setzte und sich mit ihm unterhielt.
Die beiden jungen Mädchen jedoch nahmen alles mit, was der Rummelplatz bot, bis selbst die unersättliche Oda genug hatte. Auf Umwegen schlichen sie an den Tisch zurück, weil der Tanz bereits in vollem Gange war und sie unterwegs nicht abgefangen werden wollten. Dafür waren sie zu hungrig und zu durstig.
Und schon fanden sie, zu den Ihren zurückgekehrt, ein Tischleindeckdich vor. Wie schmeckte das Bier, der Kartoffelsalat doch herrlich. Dazu noch Würstchen, das dem Baroneßchen fast in der Kehle stecken blieb, als ein Tusch die Menschen zusammenströmen ließ.
»Du meine Güte!« schluckte sie ein großes Stück herunter. »Ortrun, komm bloß schnell von hier fort, damit sie dich nicht sehen. Die Prinzessinnenwahl beginnt.«
Eiligst huschten sie ab, und Frau Schölt sagte lachend:
»Da hilft Fräulein Danz kein Verdrücken, sie wird trotzdem die meisten Stimmen kriegen. Sonst müßten unsere Mannsleut’ keine Augen im Kopf und kein Herz im Leibe haben. Allerdings würden sie zwischen Fräulein Danz und dem Baroneßchen schwanken, wenn dieses nicht zu jung wäre. Also wird erstere daran glauben müssen.«
»Arme Ortrun«, lachte Jadwiga. Die heute so fröhlich und leichtbeschwingt war, wie kaum jemals zuvor. Sie erzählte, was das Mädchen gesagt hatte, worauf die gute Dicke sich die Lachtränen aus den Augen wischte.
»Sie hat sogar recht. Denn so was kommt auf einem ländlichen Fest immer zur Verlosung.«
Sie horchte nun gleich den andern auf das, was ein Herr durch das Megaphon sprach. Die Mädchen zwischen achtzehn und zweiundzwanzig wurden aufgefordert, sich auf der Tanzfläche einzufinden, damit die Herrn aus dem Komitee der Gilde sie genau in Augenschein nehmen und danach ihre Stimmen zur Prinzessinnenwahl abgeben konnten. Die Damen, die hier als Feriengäste weilten, wären von der Wahl ausgeschlossen.
Und dann präsentierten sich die Mädchen. Jede fest davon überzeugt, daß sie die Auserkorene sein würde.
Uwe, der sich mit seiner Schönsten am Tisch eingefunden hatte, weil er für sie nichts zu befürchten brauchte, zeigte mit unterdrücktem Lachen auf den Damenflor.
»O Schreck, laß nach! Was sich da aber auch alles schön findet. Selbst Agneschen mit dem Mopsgesicht und den Dackelbeinen.«
»Werden Sie wohl still sein, Sie Spötter!« verwies Frauke ihn streng. »Sie sind heute unerhört frech. Ich bin Ihnen böse.«
Sie wandte sich ab, doch schon hörte sie an ihrem Ohr eine raunende Stimme:
»Liebchen, sei nicht gleich so böse,
hast du solch ein hitzig Blut?
Mußt dir’s Zürnen abgewöhnen,
ist nicht für die Ehe gut.«
Ach, wie wurde das Fraukchen da verlegen. Sie wagte nicht, den hinter ihr stehenden Mann anzusehen und war froh über die Ablenkung, die sich bot. Die Herren vom Komitee defilierten an dem Damenflor vorbei, nahmen sie scharf aufs Korn, zückten dann Zettel nebst Stift und schrieben einen Namen darauf. Sie wurden dann in den Schlitz eines geschlossenen Kastens gesteckt, den ein Herr dann feierlich aufschloß, die Zettel las und dann lachend verkündete:
»Zehn Zettel und ein Name. Damit ist die Wahl einstimmig getroffen. Hoch lebe unsere Schützenprinzessin Ortrun Danz!«
Das gab nun einen fröhlichen Tumult. Aber wo war die Prinzessin überhaupt? Nirgends zu sehen, so scharf man auch Ausschau hielt. Und schon setzte ein Sprechchor ein:
»Prinzessin Ortrun Danz – Prinzessin Ortrun Danz.«
Dabei wurde in die Hände geklatscht. Die Menschen auf dem Festplatz schienen außer Rand und Band zu sein.
Und die neugebackene Prinzessin? Die stand mit Oda hinter einer Bude und machte ein bitterböses Gesicht.
»Man soll mich in Ruhe lassen!«
»Ortrun, sei vernünftig«, sagte Oda eindringlich. »Du mußt hin, sonst beleidigst du die ganze Gilde. Wird so schlimm nicht werden, ist ja alles nur ein neckisches Spiel –«
»Prinzessin Ortrun Danz – Prinzessin Ortrun Danz.«
Da warf diese den Kopf zurück und ging sicheren Schrittes dem Platz zu, wo ihr Erscheinen Jubel auslöste. Man drückte ihr die Krone auf das gleißende Köpfchen, legte ihr das Band mit den Farben der Gilde um, dann gab man sie frei für die Kameras.
Und Prinzeßchen lächelte, lächelte bezaubernd, obwohl sie am liebsten geweint hätte. Doch der Mann, der langsam auf sie zutrat und ihr mit einer Verbeugung den Arm bot, strömte so viel Tröstliches aus, daß sie sofort ruhig wurde.
Es war Baron Swidbörn, das Ehrenmitglied, das schon seit Jahren jede neuerwählte Schützenprinzessin zur Polonäse führen mußte, voran als erstes Paar. Der Schützenkönig mit seiner Königin kam hier an zweiter Stelle. So war es Vorschrift, und so wurde es getan.
»Bitte die Herrschaften zur Polonäse anzutreten!« schallte die Stimme durchs Megaphon. »Jeder Herr darf seine Dame nach Belieben wählen.«
Was man mit Vergnügen tat. Und daß Uwe Gunder seine Schönste wählte, war wohl so sicher, wie das Amen in der Kirche.
»Unsere Goldige«, sagte Frauke mitleidig. »Die fühlt sich bestimmt nicht wohl in ihrer Haut. Aber ihre tadellose Haltung ist bewundernswert.«
»Kunststück, als früherer Zögling des Elitetöchterheims«, entgegnete er achselzuckend. »Da werden die Mädchen streng auf Selbstbeherrschung gedrillt. Aha, jetzt geht’s los.«
Langsam setzte sich der unendlich lange Zug in Bewegung, vorweg die Schützenkapelle, dahinter die Schützenprinzeß mit ihrem schneidigen Prinzen. Die Blechmusik schmetterte, die Menschen sangen. Jubelnd stieg der alte und doch immer wieder neue Jägermarsch in die Dämmerung, die magische Beleuchtung durchgeisterte.
Ich schieß den Hirsch im wilden
Forst,
im tiefen Tal das Reh.
War es da vielleicht ein Wunder, daß dieses Fest so großen Anklang fand? Wo alles durchweht war von Fröhlichkeit und Leichtbeschwingtheit. Wo es nichs Schwüles, nichts Verstecktes gab. Wo man sich freuen konnte, so recht von Herzen freuen.
»Nun, gnädiges Fräulein, immer noch ängstlich?« fragte Winrich von Swidbörn das Prinzeßchen, das an seiner Seite so leichtfüßig dahinschritt und nun das bezaubernde Köpfchen schüttelte.
»Nein, Herr Baron. Wenn Sie dabei sind, habe ich keine Angst.«
Fast hätte der Mann den Schritt verhalten, so sehr überraschte ihn dieses Bekenntnis, das von ihr wohl harmlos hingesagt, für ihn jedoch von schwerwiegender Bedeutung war. Ein Glücksgefühl durchflutete sein Herz, wie er es noch nie empfunden. Als hätte er solange nur dahingedämmert und wäre jetzt erst zum Leben erwacht. Jetzt erst begriff er so ganz und gar das Lied des Walther von der Vogelweide.
Wer gab dir, Minne, die Gewalt,
daß du so allgewaltig bist?
Du zwingest beide, jung und alt,
dagegen gibt es keine List.
Nein, die gab es nicht. Diese eine Bemerkung, die vielleicht nur so dahingesagt war, hatte genügt, den Wall, mit dem sein Herz sich umpanzerte, leicht und mühelos einzureißen. Nun lag sein Herz da, kahl und bloß. War schutzlos zwei strahlenden Augen ausgeliefert und einem goldigen Lachen.
Als dann die Polonäse beendet war, blieben die Paare zum anschließenden Walzer zusammen. Und da die Tanzfläche viel zu klein war, tanzte man da, wo man Platz fand.
Wie ein Elflein schwebte Ortrun dahin. Strahlte ihren Partner an, wie sie auch den nächsten und übernächsten anstrahlte.
Da wandte der Mann sich brüsk ab. Wie hatte er auch nur einen Herzschlag daran glauben können, daß das strahlende Lachen, der strahlende Blick ihm allein galt. Und wie hatte er sich durch eine einzige Bemerkung, von der er jetzt wußte, daß sie nur so dahingesagt war, aus dem Gleichgewicht bringen lassen können. Nun, das sollte ihm nicht noch einmal passieren. Von jetzt ab würde er auf der Hut sein.
*
»Tanzen möcht ich, jauchzen möcht ich, in die Welt es schrei’n, mein ist die schönste der Frauen, mein, nur mein«, sang Uwe Gunder jämmerlich falsch die Worte des Walzers mit, seine Schönste dabei immer fester umfassend, bis diese es sich ernstlich verbat, ihr die Luft abzuschnüren. Doch er lachte sie freundlich an und beteuerte, er müßte es tun, sollte ihm nicht das übervolle Herz bersten.
»Dann denken Sie gefälligst auch an anderer Leute Herz und quetschen Sie es nicht ab.«
»Ei, denken Sie daran, was ich Ihnen vorhin sagte.«
»Unmöglich, mir alles zu merken, was Sie heute an Unsinn zusammengeredet haben.«
»Es war kein Unsinn, was ich Ihnen mit den Worten Uhlands zu verstehen gab.«
»Ich bin ein einziges Fragezeichen.«
»Hm. Dann will ich die letzten Sätze wiederholen: Mußt dir’s Zürnen abgewöhnen, ist nicht für die Ehe gut.«
»Wer will denn eine Ehe eingehen?«
»Ich.«
»Mit wem?«
»Mit dir. Ich liebe dich nämlich, meine süße Frauke, und zwar mehr, als für uns beide gut ist.«
»Ach du lieber Gott! Soll das etwa ein Heiratsantrag sein?«
»Na, was denn sonst? Sag bloß schnell ja, ich halte das Hangen und Bangen nicht mehr länger aus. Wer weiß, wann sich wieder Gelegenheit geboten hätte, dir die Frage zu stellen, die mir schon längst auf der Zunge brennt. Ergo mußte ich die jetzige Gelegenheit beherzt beim Zopf fassen. Ja, Frauke?«
»Ja«, entgegnete sie einfach, und da drückte er sie mit einem befreiten Lachen an das närrische Herz.
Indes saß der Baron bei Jadwiga und Hulda, die immer wieder ein Gähnen unterdrückten. Es war ja auch bald Mitternacht, und der Bettzipfel winkte. Bis Hulda einmal den Mund ganz weit aufsperrte, da sagte der Mann lächelnd:
»Das war herzhaft, Fräulein Hulda. Nun die Musik gerade schweigt, werde ich Oda holen, dann fahren wir nach Hause.«
»Und Ortrun?« fragte Jadwiga ängstlich.
»Die wollen wir nicht stören. Mag sie die Ehrungen, die man ihr als Schützenprinzessin entgegenbringt, auskosten bis zur Neige.«
»Sie haben recht, Herr Baron«, brummte Hulda. »Die sonst so vernünftigen Menschen gebärden sich heute wie Narren. Daß Ortrun diesen Unsinn so eifrig mitmacht, damit enttäuscht sie mich. Jetzt ist’s aber genug, jetzt muß ein vernünftiger Mensch zwischen die Narretei.«
Sprachs, erhob sich und ging gewichtigen Schrittes davon. Schon wenige Minuten später kehrte sie zurück, Ortrun und Oda im Schlepptau.
»Mault nicht, wir fahren nach Hause und damit basta. Ihr Grünzeug habt genug getanzt, die Sohlen eurer Schuhe müssen ja schon durch sein. Leg den Schnickschnack da ab, Ortrun. Ich werde ihn dem Herrn bringen, der ihn dir anlegte. Dort steht er gerade.«
Resolut, wie Hulda nun einmal war, legte sie wenig später dem verdutzten Herrn die Insignien der Schützenprinzessin in den Arm. Ehe der noch etwas sagen konnte, war sie schon davon und kehrte zum Tisch zurück, wo sie Frauke und Uwe vorfand.
»Ach sieh mal an, ihr laßt euch auch einmal blicken.«
»Brumm nicht, Huldchen!« drückte sie ihr einen Kuß auf die Wange, worauf sie mißtrauisch gemustert wurde.
»Na ja«, sagte Hulda trocken. »Muß ja auch so was geben. Ich fahre mit Fräulein von Schlössen und Oda nach Hause. Der Herr Baron wird so freundlich sein, uns in seinem Wagen mitzunehmen.«
»Den wollen wir erst gar nicht bemühen«, tat der Herr Doktor großartig. »Wir haben alle in meinem Wagen Platz.«
So fuhr man denn ab. Voran der Baron mit seiner Schwester, hinterher der Tierarzt mit seinen vier Weibsen, wie er sie schmunzelnd bei sich nannte. Als der Wagen hielt, stiegen die drei, die im Fond saßen, rasch aus, während die vorn sich damit Zeit ließen.
»Kommt schleunigst ins Haus«, sagte Hulda. »Damit ihr euch nicht erkältet. Gute Nacht, Herr Doktor, schlafen Sie so gut, wie Sie können!«
Die andern beiden riefen ihm auch einen Gutenachtgruß zu, dann eilten sie ins Haus und Uwe schmunzelte.
»Ich glaube, unsere Hulda weiß Bescheid. Komm her, mein Schatz, auf daß ich meinen Hunger stille!«
Es schien schon ein Mordshunger zu sein; denn es dauerte lange, bis er sich an den weichen Lippen sattgeküßt hatte, wobei die Grübchen nicht vernachlässigt wurden, versteht sich. Dann ließ er endlich von seinem »Opfer« ab und sagte zufrieden:
»Nach dem langen Schmachten hat das gutgetan. Darf ich morgen – oder besser heute – mit dir frühstücken?«
»Bitte sehr!«
»Es darf aber nicht zu spät sein; denn um elf beginnt meine Sprechstunde.«
»Hm. Wie spät haben wir es, kurz nach zwölf. Sieben Stunden Schlaf oder auch keinen, also kannst du um acht Uhr erscheinen.«
»Tiefgefühlten Dank! Schlaf gut, träum von mir, meine Schönste, und um acht auf Wiedersehen!«
Noch ein Kuß, dann stieg Frauke aus, winkte dem abfahrenden Wagen nach und ging dann ins Haus, wo Hulda in der Diele stand und ihr entgegenschmunzelte.
»Also denn meinen herzlichen Glückwunsch! Daß du glücklich bist, sagen mir deine strahlenden Augen.«
»Ich bin es auch, Hulda. Bist du mit meiner Wahl zufrieden?«
»Sehr! Dein Uwe ist ein guter Mensch.«
*
Pünktlich um acht Uhr betrat der Tierarzt das gemütliche Frühstückszimmer, wo auf dem Tisch ein gutes Frühstück seiner wartete. Doch zuerst kam der Gutenmorgenkuß, dann der Strauß mit dreiundzwanzig roten Rosen, für jedes Lebensjahr eine und dann der Ring mit einem herrlichen Smaragd.
»Es ist der Ring meiner Mutter«, sagte er leise. »Werde in deiner Ehe so glücklich, wie sie es in der ihren gewesen ist.«
»Und ich werde bestrebt sein, so zu werden wie deine Mutter«, entgegnete sie einfach. »Und dein Ring?«
»Ist der meines Vaters, dem auch ich nachzueifern bestrebt bin. Wie ich an den beiden Gedecken sehe, werden wir beide allein frühstücken?«
»Ja.«
»Das ist lieb von dir, meine Schönste. Denn so gern ich Tante Jadwiga und Ortrun auch habe, in dieser Stunde möchte ich mit dir allein sein.«
Sie ließen sich das Frühstück gut munden und griffen dann zur Morgenzigarette. Während Uwe Zukunftspläne spann, blieb Frauke merkwürdig still, was ihn endlich stutzig werden ließ.
»Was hast du denn, Liebste?« fragte er besorgt. »Ist dir nicht wohl?«
»Doch«, entgegnete sie hastig, den Zigarettenrest in den Ascher drückend. »Ich sorge mich nur… Ach, es ist so schwer, darüber zu sprechen.«
»Aber Frauke, mir kannst du doch alles sagen. Ich bin jetzt doch dazu da, um dir beizustehen. Nun?«
»Uwe, es ist wegen Tante Jadwiga und Ortrun, die so sehr an diesem Haus hängen. Wenn ich nun heirate…«
»Bleiben sie selbstverständlich hier.«
»Aber das kann ich dir doch nicht zumuten.«
»Warum denn nicht?«
»Weil sie noch nicht einmal mit mir verwandt sind. Da kannst du sie doch nicht sozusagen mitheiraten.«
»Doch, ich tu’s«, lachte er vergnügt. »Sollst mal sehen, wie gut wir uns alle vertragen werden. Außerdem wird Ortrun nicht lange ledig bleiben. Hast du denn gestern nicht gemerkt, wie entzückt die Herren von ihr waren?«
»Das schon. Hauptsächlich der Sohn des Oberförsters scheint sich ernstlich in sie verliebt zu haben.«
»Und andere werden es auch noch tun. Wir müssen nur aufpassen, daß dieses reiche Mädchen nicht womöglich einem Mitgiftjäger in die Hände fällt. Aber wegbringen tun wir sie nicht, wenn so eine Gefahr naht, wie es der Doktor Danz tat. Ja ja, mein Mädchen, ich weiß genau Bescheid. Und zwar durch meinen Vetter Folbe, der mich bei seinem letzten Besuch genauestens über die beiden Schönen im grünen Haus orientierte. So einer wie der Zerkel – den ich übrigens bis in den Tod nicht leiden kann und seine liebe Familie auch nicht, weil sie dich so schikanierten –, so einer soll sich mal unserer Goldigen zu nähern wagen, dann kriegt er es mit mir zu tun, und das wäre nicht ratsam. Ich vertrete jetzt Bruderstelle an Ortrun und werde sie wie ein Bruder schützen.
Und Tante Jadwiga? Ich müßte ja ein Herz aus Stein haben, wenn ich dem lieben alten Fräulein das Zuhause nehmen wollte, das sie nun endlich gefunden hat. Und daß Hulda bleibt, das bedarf überhaupt keiner Erwähnung. Bist du jetzt beruhigt, du Dummchen?«
»Ich bin glücklich.«
»Dann beweise es.«
Worauf sie ihm um den Hals fiel, was er sich nur zu gern gefallen ließ. Und als Uwe durch das geöffnete Fenster Michels Organ vernahm, sagte er schmunzelnd:
»Der gehört ja auch zum alten Bestand, also wird auch er übernommen. Bertchen muß ihre Stelle aufgeben und nur für uns arbeiten. Denn ein Mann im Haus macht viel zu schaffen, und Hulda soll sich nicht überanstrengen. Warum siehst du mich denn so ängstlich an?«
»Werden wir es auch schaffen, drei Angestellte einschließlich Verpflegung zu bezahlen?«
»Liebchen, was hast du bloß für viele Sorgen. Aber auch die kann ich zerstreuen, indem ich dir sage, daß wir es sogar glänzend schaffen können. Erstens verdiene ich gut, dann bin ich vermögend. Es reicht für alle, verlaß dich drauf.«
»Ich bin aber auch nicht ganz arm«, bekannte sie stolz. »Ich bekomme eine monatliche Rente von vierhundert Mark.«
»Und dieses Haus vergißt du ganz?«
»Richtig. Und das ist schön, Uwe, nicht wahr?«
»Es ist ein richtiges, trauliches Zuhause. Doch jetzt muß ich dich verlassen, so leid es mir tut, aber ich möchte meine Arbeit nicht vernachlässigen. Eigentlich dumm von dir, einen Arzt zu heiraten, der so viel unterwegs sein muß. Du wirst es noch so manches Mal verwünschen. Sind deine Papiere in Ordnung?«
»Gewiß. Aber was willst du denn damit?«
»Das Aufgebot bestellen.«
»So bald schon?«
»Bald nennst du das? Ich betrachte die drei Wochen als halbe Ewigkeit. Also ’runter unter die Haube, mein Herzchen, da gibt es kein Pardon.«
»Will ich ja auch gar nicht«, lachte sie ihn so lieblich an, daß er unbedingt die reizenden Grübchen küssen mußte.
*
Die Verlobungsfeier verlief voll Harmonie und Fröhlichkeit. Uwe hatte die richtigen Worte für Jadwiga und Ortrun gefunden. Sie waren nun davon überzeugt, daß sie dem späteren Hausherrn nicht im Wege sein würden. Und als er sich beim Sekt mit ihnen verbrüderte, zog er gleich den Freund in diese Verbrüderung mit ein. Doch während dieser sich mit einem Handkuß zufrieden gab, nahm Uwe sich den obligaten Kuß. Er war von einem so strahlenden Übermut, daß man kaum aus dem Lachen herauskam.
Beim Abschied lud Winrich die vergnügte Gesellschaft zum Pfingstsonntag nach Schloß Swidbörn ein, was mit Freuden angenommen wurde. Hulda hatte sogar von Barbe schriftlich eine Extraeinladung bekommen, die sie wohl ehrte, aber brummen ließ:
»Alles recht schön und recht nett, aber wenn alle fortgehen, was wird dann aus Ajax? Das arme Tier winselt sich ja zuschanden, wenn es allein hier zurückbleiben muß.«
»Den nehmen wir mit«, entschied Uwe, doch Huldchen hatte Bedenken.
»Und was werden die Hunde im Schloß dazu sagen?«
»Die werden ihren Gast ehren, wie es sich für vornehme Schloßhunde gehört.«
»Da soll der arme Hund wohl hinter dem Auto herlaufen, was?«
»Aber nicht doch, Huldchen, der fährt mit.«
»Ach so, da soll ich das niedliche Tierchen wohl auf den Schoß nehmen«, entrüstete sie sich, und als der Heiterkeitsausbruch sich gelegt hatte, kam der Baron, dem das Geplänkel Spaß gemacht hatte, der bedrängen Seele zu Hilfe.
»Fräulein Hulda, da ich unter Larven die einzig fühlende Brust bin, schicke ich extra für Sie und den Hund den kleinen Wagen mit Chauffeur. Wäre das was?«
»Und wie das was wäre, Herr Baron«, besah sie sich ihn so zärtlich, daß die andern Mühe hatten, ernst zu bleiben.
»Sie sind der einzige Mensch hier, den die Verlobung nicht närrisch gemacht hat. Sie sind überhaupt ein Mann, wie er im Buch steht.«
Sprachs, zog ab, und man lachte verhalten hinter ihr her.
»Schau mal an, Huldchen hat ihr Herz entdeckt«, schmunzelte Uwe. »Liebes altes Mädchen, du bist nicht dumm, auch nicht nuscht. Denn der Herr Baron von Swidbörn ist ein Mann…«
»Der dir gleich deine Frauke abspenstig machen wird, wenn du nicht aufhörst, du Spötter.«
»Herrje, nein, da bin ich schon lieber still.«
»Nur gut, daß es jetzt etwas gibt, womit man dich kleinlaut machen kann«, lachte der Freund. »Also meine Herrschaften, am Pfingstsonntag auf frohes Wiedersehen bei mir zu Haus!«
Und es wurde ein fröhliches Wiedersehen. Dafür hatte schon Hulda bei der Abfahrt mit ihren Sperenzchen gesorgt. Bis sie und der Hund in dem kleinen Wagen verfrachtet waren, lachte man Tränen.
Man hätte es am liebsten wieder getan, als man mit ansah, wie würdig Barbe ihren Gast vor dem Schloß empfing und wie gnädig dieser es sich gefallen ließ. Aber man mußte schon ernst bleiben, um die beiden treuen Menschen nicht zu kränken.
Auch die Hunde wußten, was sich gehörte. Zwar bellte der kleine Dackel den Hundegast an, doch es war ein freudiges Begrüßungsbellen, während der prächtige Spaniel sich seiner Würde bewußt blieb, wie Ajax es auch tat.
Es wurde überhaupt ein Tag ohne jeden Mißklang. Wohl hatten die drei weiblichen Gäste viel erwartet, doch nun sie das Schloß sahen in seinem Glanz, waren sie denn doch überrascht. Und dann der Park mit seinen herrlichen Anlagen, überhaupt das ganze Drum und Dran, da war das Haus im grünen Grund ein Nichts dagegen – und doch war es den Bewohnern lieber. Was da anheimelte, bedrückte hier. Und als man das liebe Haus wieder betrat, dehnte Frauke die Arme weit.
»Tohuus is doch tohuus.«
Und zwei anderen Menschen tat dabei das Herz bitter weh.
*
Nun waren die Neuvermählten fort, hinaus in die weite Welt. In einem neuen, teuren Wagen, den der Herr Doktor eigens für die Hochzeitsreise angeschafft hatte.
Zwar hatte Gunder seinen Vetter Folbe nebst Gattin zur Hochzeit eingeladen, doch leider mußte der Arzt absagen, weil eine Scharlachepidemie ihn unabkömmlich machte, selbst für einen Tag. So waren als Gäste nur die Geschwister Swidbörn zugegen, die man eigentlich als Gäste gar nicht mehr bezeichnen konnte. Nachdem die jungen Gatten abgefahren waren, brachen auch sie auf. Und nun saßen ein junges und ein altes Fräulein oben im Zimmer, die Augen voll Tränen, das Herz voll Weh. Und als Jadwiga aufschluchzte, umfaßte Ortrun die bebenden Schultern.
»Weine nicht, Tante Jadwiga, ich verlaß dich nicht. Wir gehen zuerst einmal eine Zeitlang auf Reisen und schaffen uns dann in einer Stadt ein kleines Heim, das du betreust, während ich mich zur Kunstgewerblerin vorbereite. Etwas werde ich ja unternehmen müssen. Denn um müßig meine Tage zu verbringen, dafür bin ich noch zu jung.«
»Wird dein Vormund dich auch mir anvertrauen?« fragte Jadwiga zaghaft, und Ortrun lachte bitter auf.
»Er hat ja keine Bedenken gehabt, mich einem dreiundzwanzigjährigen Mädchen anzuvertrauen. Der ist froh, mich überhaupt irgendwo unterbringen zu können. Außerdem werde ich in zehn Monaten mündig.
Und nun wollen wir die vier Wochen, die uns hier zu bleiben noch vergönnt sind, nicht mit Trübsal vergeuden, sondern sie aus vollem Herzen genießen.«
Was sie denn auch taten. Das heißt, sie weilten mehr im Schloß als in dem grünen Haus. Denn Oda schien ohne sie nicht mehr leben zu können. Ließ keinen Tag vergehen, ohne sie ins Schloß zu holen, in das nun zwei fröhliche junge Menschenkinder Leben brachten. Die weiten Räume waren erfüllt von Lachen. Der kostbare Flügel, schon lange nicht mehr benutzt, klang nun oft unter zwei zarten Händen. Eine süße Stimme sang fröhliche Lieder und entzückte alle, die es hörten.
Wie Kletten hingen die beiden Mädchen zusammen, unternahmen alles gemeinsam, und immer war Jadwiga dabei. Nur bei den Ritten blieb sie zurück, was sie auch gern tat. Dann gab sie sich einer besinnlichen Stunde hin, in der sie gar nicht merkte, wie alles ringsum von ihrem Herzen Besitz ergriff – mehr noch als im grünen Haus.
Es war nicht einfach gewesen, Ortrun in den Sattel zu bekommen. Nicht etwa, weil sie sich darin nicht sicher fühlte, sondern weil dann immer der Mann dabei war, in dessen Nähe sie stets so unsicher wurde. Wo ihr Herz so seltsam klopfte, in harten, schmerzhaften Schlägen.
Lenzesgebot, o süße Not!
Nun war auch die junge Ortrun davon erfaßt. Und als sie sich dessen bewußt wurde, gab es bitteres Herzeleid. Jetzt mußte sie ja noch viel mehr aufgeben, wenn der Abschied kam.
Doch jetzt nicht daran denken. All das Schöne, Beglückende und auch Bittersüße auskosten bis zur Neige. Jetzt noch in die Sonne sehen, die die bald dunkle Nacht verscheuchen würde.
Wenn nur nicht diese köstlichen Tage so dahinrasen wollten. Aber kaum, daß einer begann, war er auch schon zu Ende. Und je weniger Tage es wurden, je mehr Tränen wurden es, die ein verzweifeltes junges Menschenkind nachts in die Kissen weinte.
Und wie gern hätte der Mann die Tränen getrocknet, der genauso um den Abschied bangte, wie Ortrun es tat. Der genauso hätte die Tage festhalten mögen, die so unerbittlich enteilten. Er hätte nie geglaubt, daß ein Mensch dazu imstande wäre, soviel Sonne in Herz und Haus zu bringen, wie dies Mädchen mit den sonnenhellen Haaren es tat und den strahlenden Blauaugen, der süßen Stimme und dem goldigen Lachen. Wenn das alles für ihn versank, das konnte er doch nimmermehr ertragen. Gab es denn für ihn kein Erbarmen?
Doch, das gab es. Denn als Ortrun an einem Vormittag die Schloßterrasse betrat, saß da eine Dame, die sie so scharf musterte, als müßte sie ihre Seele ergründen. Doch dann huschte über das vornehme Antlitz ein heller Schein.
»Also das ist Fräulein Danz«, sagte die Dame langsam, dem jungen Mädchen die Hand reichend, über die es sich artig neigte. »Ich habe Ihren Vater gekannt, mein Kind, und habe den klugen Mann bewundert. Schade, daß er so früh dahingehen mußte, er hätte der Wissenschaft noch viel Wertvolles geben können. Und nun wollen Sie gewiß wissen, wer ich bin.«
»Ich kann es mir denken«, entgegnete Ortrun mit einem so reizenden Lächeln, daß es der Dame warm ums Herz wurde. »Sie sind Gräfin Attbach, die Oberin des Dorothea-Stifts.«
»Das bin ich tatsächlich«, lachte die Dame so frisch und froh, daß Ortrun sie spontan in ihr Herz schloß. »Woher haben Sie denn meinen Steckbrief?«
»Von mir«, gestand Oda. »Ich habe ihr erzählt, wie lieb und gut du bist. Aber wo ist denn Tante Jadwiga?«
»Zu Hause geblieben«, gab Ortrun Antwort. »Wir erhielten eine Karte, auf der Frauke und Uwe ihre Ankunft für Sonntag avisieren. Da gibt es für Hulda noch manches zu tun, wobei Tante Jadwiga ihr zur Hand geht.«
»Sie fühlen sich im grünen Haus sicher sehr wohl«, begann die Gräfin zu sondieren, das Mädchen dabei scharf im Auge behaltend, das nun den flimmernden Kopf senkte und leise sagte:
»Ja, Frau Gräfin. Es war mir ein liebes Zuhause.«
»War, Fräulein Danz? Wie soll ich das verstehen.«
»Daß ich, wo nun Frauke verheiratet ist…«
»Übrig bin«, warf die Gräfin trocken ein. »Denn wo zwei sich genug sind, ist übrig der dritte, das ist wohl traurig, aber wahr. Darf ich wissen, was Sie zu tun gedenken, wenn Sie das grüne Haus verlassen haben? Ich frage nicht aus Neugierde, mein Kind.«
»Ich ja, ich gehe zuerst einmal eine Zeitlang mit Tante Jadwiga auf Reisen, dann lassen wir uns in einer Stadt nieder, wo ich mich zur Kunstgewerblerin vorbereiten kann.«
»Wird Ihr Vormund damit einverstanden sein?«
»Ich glaube schon. Denn er hat…«
Erschrocken hielt sie inne, als Oda ihren Hals umklammerte und bitterlich schluchzte:
»Du darfst nicht fort, Ortrun, du darfst nicht fort. Was soll ich wohl – anfangen – ohne – dich –?«
»Na, nun mal langsam«, sagte die Gräfin ruhig. »Erwürge ja deine liebe Ortrun nicht, damit ich ihr sagen kann, was für ein törichtes Köpfchen sie hat. Zuerst mal vorweg, daß ich ziemlich genau über Sie Bescheid weiß, Fräulein Danz. Daher ist mir auch bekannt, warum Ihr Vormund Sie Fräulein Gortz anvertraute. Aber Fräulein von Schlössen wird er Sie nicht anvertrauen, da diese so weltfremd ist, daß sie selbst noch einen Beschützer braucht.«
»Ja, was soll denn aus uns werden«, sagte das Mädchen verzweifelt. »Mich würde mein Vormund wohl zur Not aufnehmen, aber Tante Jadwiga doch nicht.«
»Die kann Aufnahme im Dorothea-Stift finden.«
Da sprang Ortrun gepeinigt auf.
»Bitte mich zu entschuldigen, Frau Gräfin.«
Weg war sie, und Herma sagte hastig:
»Geh ihr nach, Oda! Gib acht, daß sie keine Dummheiten macht. In der Verfassung scheint sie mir nämlich zu sein.«
Als die Kleine fort war, sprach die Tante den Neffen an, der an der Balustrade stand und ihr den Rücken zudrehte.
»Ein schöner Rücken soll wohl auch entzücken, mein Sohn, aber dein Gesicht ist mir bedeutend sympathischer.«
Da drehte er sich langsam um. Und als sie seine Augen sah, in denen der Schmerz brannte, sagte sie trocken:
»Wäre ja auch unnatürlich, wenn du dich in das bezaubernde Geschöpf nicht verliebt hättest.«
»Tante Herma – bitte!«
»Ach was, Junge, versuch mir doch nichts vorzumachen, das gelingt dir bei mir doch nicht. Willst du müßig zusehen, wenn dieses schöne und dazu noch reiche Mädchen das grüne Haus verläßt und auf Reisen geht – dazu noch mit einer so welt- und menschenunkundigen Ehrendame wie Fräulein von Schlössen? Die Kleine kommt nicht weit, verlaß dich darauf. Dafür sind die Mitgiftjäger zu schwer auf Posten.«
»Und was wäre ich, wenn ich um sie freite?« lachte er bitter auf. »Ich kann mich gerade so knapp auf meinem Besitz halten. Und wenn ich mich da um eine reiche Erbin bewerbe, dann werden sich schon Menschen finden, die ihr beibringen, daß ich nicht sie begehre, sondern ihr vieles Geld.«
»Hm. Sag mal, Winrich, weißt du eigentlich, wieviel Geld ich habe?«
»Nein. Das interessiert mich auch nicht«, brummte er verdrießlich, und sie lachte.
»Ich an deiner Stelle würde es doch tun. Ich liege schon längst auf der Lauer, um einzugreifen, wenn Grünehöh ernstlich gefährdet ist. Denn ich bin ja selbst eine Swidbörn und habe Interesse daran, daß unser Jahrhunderte alter Besitz nicht in fremde Hände kommt. Aber offen gesagt wollte ich mein Geld nicht in ein Danaidenfaß werfen. Und ich hätte es getan, solange dein nichtswürdiger Vater und deine nicht minder nichtswürdige Frau noch lebten. Damit hätte ich ja nur ihre Geldgier unterstützt. Sofern die nur Geld witterten, waren sie hinterher, wie die Katze nach dem Baldrian. Aber wenn der Mensch nichts hat, kann er auch nichts geben. Und du konntest es auch nicht, dir selbst zu Nutz und Frommen. Denn das Geld, das ich dir jetzt geben werde, kommt nicht einer liederlichen Frau zugute, sondern deinem Besitz. Also kannst du ruhig um das reiche Mädchen freien, dessen Geld du gar nicht brauchst. Noch etwas?«
»Sie liebt mich nicht.«
»Auch das noch. Junge, so ein Kerl wie du und Minderwertigkeitskomplexe! Laß dich doch nicht auslachen. Nimm sie bei den Öhrchen, gib ihr einen Kuß, dann sollst du mal sehen, wie ihre übrigens wunderschönen Augen strahlen.«
Weiter konnte sie nicht sprechen, da die beiden Mädchen zurückkamen. Ortrun niedergeschlagen und sehr blaß, Oda mit dickverweinten Augen.
»Ortrun läßt sich auf nichts ein«, schluchzte sie verzweifelt. »Sie will fort, bevor Frauke und Uwe noch zurück sind. Hilf mir doch, Tante Herma!«
»Tu ich, mein Herzchen, tu ich. Kommen Sie mal her, Sie kleine Sünderin, die so viel herzblutenden Jammer heraufbeschwört. Schämen tun Sie sich wohl gar nicht, wie?«
»Warum sollte ich das denn, Frau Gräfin?«
»Weil Sie Ihre Freundin Frauke, die so viel Gutes an Ihnen tat, so bitter kränken wollen, indem Sie sie verlassen, sogar noch heimlich.«
»Es muß doch sein.«
»Es muß nicht sein, Sie Närrchen. Wollen Sie mir einen Gefallen tun?«
»Wenn ich kann, gern.«
»Dann gehen Sie in den kleinen Salon, wo ich meine Brille vergaß. Denn ohne die kann ich Ihnen nicht die Leviten lesen, wie man so sagt.«
Arglos fiel Ortrun auf die List herein, ging davon, und Herma raunte dem Neffen zu:
»Geh ihr nach, zieh die Weste glatt und tu forsch. Wehe, wenn du mich enttäuschst!«
»Nun, findest du die Brille nicht?« fragte er lachend, was sie herumfahren ließ.
»Toi, toi, toi! Ich hatte ja gar keine Ahnung, daß du hier bist. Such du mal bitte nach der Brille, ich jedenfalls kann sie nicht finden.«
»Ich bestimmt auch nicht, weil Tante Hermas Brille gar nicht existiert.«
»Ja, aber was soll denn das bedeuten. Das hat doch keinen Sinn.«
»Und wie das Sinn hat. Es hängt mit einer Frage zusammen, die ich an dich stellen möchte.«
»Jetzt versteh ich überhaupt nichts mehr.«
»Darf ich jetzt meine Frage stellen?«
»Bitte, aber kurz und präzise.«
»Sollst du haben, mein Kind. Willst du meine Frau werden?«
»Ach du lieber Gott«, ließ sie sich in den nächsten Sessel fallen und sah ihn mit einer so süßen Hilflosigkeit an, die ihm mehr sagte, als viele Worte es vermocht hätten. Und da fackelte er auch nicht länger, sondern tat das, wozu sein Herz ihn drängte.
»Na also«, lachte die Gräfin dem glückseligen Paar entgegen. »Hab ich mir doch gleich gedacht. Nun, Firlefänzchen, begrüße deine Schwägerin, aber würg sie in deinem Freudentaumel nicht ab.«
Schmunzelnd wartete sie dann, bis sie an die Reihe kam.
Sah gerührt in die glückseligen Augen, küßte das weiche Gesichtchen und sagte leise:
»Sei gesegnet, du süßes Kind. Du hast unserm Winrich das Glück gebracht, nach dem er hungerte und darbte.«
»Danke, Tante Herma«, schmiegte Ortrun sich an die gütige Frau. »Ich mußte dich liebhaben, vom ersten Augenblick an.«
»Hm, so was hört man gern. Da sieht man doch wieder, wie gut es manchmal ist, einer spontanen Eingebung zu folgen. Eigentlich wollte ich erst nächste Woche hier erscheinen, aber eine innere Unruhe drängte mich, es heute schon zu tun. Und kam gerade noch zur Zeit, um einem schüchternen jungen Mann das Rückgrat zu steifen. Weißt du denn, mein Kind, mit welchen Komplexen er sich herumschlug, nein? Dann will ich es dir sagen. Er fürchtete, für einen Mitgiftjäger gehalten zu werden, wenn er um dich kleinen Krösus freite. Hättest du ihm das zugetraut?«
»Nein, Tante Herma.«
»Das wollte ich nur wissen. Er braucht dein Geld auch gar nicht, weil er das von mir bekommt, was er für seinen Besitz benötigt. Und nun schick das Auto zum grünen Haus, Winrich, damit es Fräulein von Schlössen und die famose Hulda nach oben holt.
Ja, sieh mich nur so erstaunt an, mein Kind, ich weiß über deine Verhältnisse genau Bescheid. Weiß, woher du stammst, weiß, daß du ein Zögling des Elitetöchterheims bist, was allein schon ein Freibrief für dich ist, weiß überhaupt alles, was eine mißtrauische alte Frau wissen muß, um den Neffen, den sie wie einen Sohn liebt, nicht zum zweiten Mal bei der Wahl seiner Gattin ins Unglück laufen zu lassen. Und nun schaut mich nicht so verblüfft an, ihr drei liebsten, die ich habe, sondern kommt her und gebt mir einen Kuß.«
*
»Ich freue mich, Fräulein von Schlössen, Sie nun auch persönlich kennenzulernen«, sagte Gräfin Herma liebenswürdig, nachdem ihr Neffe die beiden Damen miteinander bekannt gemacht hatte. »Gehört habe ich nämlich schon viel von Ihnen. Warum ist denn das Prachtstück Hulda nicht mitgekommen?«
»Weil sie keine Zeit hat, Frau Gräfin«, entgegnete Jadwiga mit der Schüchternheit, die sie Fremden gegenüber immer noch hatte. »Das junge Paar kommt Sonntag nach Hause, und da stellt nun Hulda mit Bertchen gewissermaßen das Haus auf den Kopf. Als ich abfuhr, waren sie eben dabei, die Zimmer umzuräumen, wobei Michel ihnen hilft. So war ich denn ganz froh, als mich der Wagen nach oben holte.«
»Und weißt du auch, warum das geschieht, Tante Jadwiga?«
»Nein, mein Herzchen – oder doch. Winrich hat so frohe Augen. Habt ihr euch etwa – verlobt?«
»Ganz recht.«
»Also hat der liebe Gott doch mein Gebet erhört. Was bin ich doch bloß glücklich, daß ihr euch endlich gefunden habt.«
Dabei liefen ihr die hellen Tränen über die Wangen. Ortrun trat zu ihr und legte ihr blühendes Gesicht an das schon leicht welkende.
»Du Liebe, Gute. Nun habe ich doch mein Wort gebrochen. Wir beide gehen nun nicht auf Reisen.«
»Aber Kind, das macht doch nichts. Die Hauptsache, daß du glücklich bist und daß du Winrich glücklich machst. Es hat mir so weh getan, als er an der Verlobungsfeier von Frauke und Uwe so traurig dasaß. Ich hätte weinen mögen.«
Und diesem grundguten Menschen hat so eine Kreatur wie die Warl das Leben zur Hölle gemacht, dachte Herma böse. Na warte nur, das sollst du schon noch büßen, dafür werde ich sorgen. Mit einer Herzlichkeit, die diese Frau so liebenswert machte, wandte sie sich Jadwiga zu.
»Und was soll nun aus Ihnen werden, Fräulein von Schlössen? Hätten Sie Lust, ins Dorothea-Stift zu kommen?«
»Aber Frau Gräfin, das wäre doch eine Ehre für mich. Denn das Dorothea-Stift ist dafür bekannt, bei der Auswahl der Damen sehr wählerisch zu sein.«
»Nun, ich wüßte nicht, warum Sie der Wahl nicht standhalten sollten.«
»Und ich wüßte nicht, warum Tante Jadwiga in ein Stift sollte, wo sie uns hier so notwendig ist«, sagte Winrich gelassen. »Wenn hier erst wieder die Geselligkeit beginnt, wovor ich mich nicht mehr lange drücken kann, müßten wir eine Dame ins Haus nehmen, da Ortrun noch zu jung ist, um den Klimbim allein schaffen zu können. Und warum da in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Nicht wahr, Tante Jadwiga, du bleibst bei uns, wo du so notwendig bist?«
»Wenn das so ist, Winrich, dann bin ich glücklich.«
»Na also«, schmunzelte Gräfin Herma, die so richtig stolz auf den Neffen war, der in einer so vornehmen Art einen mit Minderwertigkeitskomplexen behafteten Menschen von seiner Notwendigkeit überzeugte. Ortrun jedoch schmiegte sich an den Verlobten und sagte leise:
»Ich danke dir.«
Und das Firlefänzchen? Das war einfach selig. Würgte die gute Tante Jadwiga ein bißchen und strahlte sie an.
»Hach, wird das hier ein Leben werden; alle bleiben wir zusammen, die wir uns liebhaben. Tante Herma bleibt selbstverständlich auch hier.«
»Na, nun mal langsam«, dämpfte diese den frohen Eifer. »So selbstverständlich ist das nun auch wieder nicht. Was würde wohl meine Schar sagen, wenn ich sie so schnöde im Stich ließe.«
»Das ist nun auch wieder wahr«, senkte die Kleine beschämt das Köpfchen. »Aber ich hätte doch alle so gern beisammen, die ich lieb habe. Aber jetzt bleibst du wenigstens noch eine Weile hier, ja?«
»Nun, wollen mal sehen. Wann heiratest du, Winrich?«
»Am liebsten gleich auf der Stelle«, entgegnete er seufzend. »Aber das Trauerjahr…«
»Rede jetzt keinen Unsinn«, unterbrach die Tante ihn kurz. »Wenn man einem Menschen wie Ola nachtrauern wollte, das wäre Heuchelei. Also wann heiratest du?«
»In drei Wochen.«
»Das ist doch ein Wort. Wen wirst du einladen?«
»Die aus dem grünen Haus kommen sowieso uneingeladen«, entgegnete er lachend. »Und sonst möchte ich keinen haben. Höchstens noch Ortruns Vormund mit seiner Familie. Die werden wir wohl schlecht übergehen können, nicht wahr, mein Herz?«
»Och, großen Wert lege ich darauf nicht«, gestand Ortrun aufrichtig. »Die sind mir genauso fremd, wie andere Menschen auch. Die werden Augen machen, wenn ich mit Winrich anrücke, darauf freue ich mich schon.«
»Und wenn der Vormund mit deiner Wahl nicht einverstanden ist?« fragte Tante Herma leichthin, und da fuhr das Mädchen entrüstet auf.
»Was, mit Winrich nicht einverstanden sein, mit dem vornehmsten, liebsten und besten Menschen? Na das wäre!«
»Mädchen, wenn du wüßtest, wie entzückend du in deinem Zorn bist«, lachte die Gräfin. »Aber du hast recht, alles das ist dein Winrich. Wenn ich euch einen Rat geben darf, fahrt morgen zu Doktor Danz und holt euch seinen vormundlichen Segen.«
Und als er dann dessen Vermögensverhältnisse darlegte, sagte das reiche Mädchen verblüfft: »Das ist aber mal viel Geld. Winrich, willst du es haben?«
Da mußten die beiden Herren denn doch lachen.
»Na, Sie bekommen vielleicht eine Frau, Herr Baron. Gut, daß die leichtsinnige Kleine in die Hände eines Ehrenmannes fällt.«
»Na also«, lachte Ortrun vergnügt, als sie Arm in Arm mit dem Verlobten die Straße der großen Stadt entlangging, wo turbulentes Leben herrschte. »Das hätten wir auch geschafft. Und nun schnell nach Hause, der Trubel hier fällt mir auf die Nerven.«
Wogegen der Mann nichts einzuwenden hatte. Am liebsten hätte er das zauberhafte Geschöpf im Trubel der Straße an das heißschlagende Herz genommen und sich an den jungfrischen Lippen sattgeküßt. Doch da es ja nicht gut anging, bezähmte er sein heiß’ Verlangen und benutzte außerhalb der Stadt einen Seitenweg dazu, wo er seine Liebste nach Herzenslust abküßte.
»Mädchen, was bist du doch nur für ein goldiges Geschöpf«, sah er in die Augen hinein, die ihn anstrahlten wie zwei Sonnen. »Hast du überhaupt eine Ahnung, wie unaussprechlich glücklich ich bin?«
Und das stimmte. Wohl selten hatte die Liebe einen Mann so arg gepackt, wie diesen ernsten, schwerblütigen Menschen.
Wer gab dir, Minne, die Gewalt,
daß du so allgewaltig bist.
*
Zu dem Empfang der Hochzeitsreisenden hatte man sich vollzählig im grünen Haus eingefunden. Auch Gräfin Attbach, die Uwe von ihren Besuchen auf Schloß Swidbörn kannte und die er sehr verehrte. Demnach fiel auch die Begrüßung aus, die er der Dame zollte, und Frauke war von ihr entzückt.
Nachdem der Begrüßungssturm sich gelegt hatte, tat Uwe das, was ihm sein Herz gebot. Er zog seine Schönste in die Arme, küßte den lachenden Mund – und sah dann verdutzt auf den Freund, der bei Ortrun dasselbe tat.
»Ja, sag mal, was fällt dir ein, unsere Goldige…«
»Hat sich für euch ausgegoldigt, mein Lieber«, sagte Winrich gelassen. »Die Benennung bleibt fortan nur mir überlassen. Ich sehe gar nicht ein, daß, wenn du eine Schönste hast, ich dann keine Goldige haben soll.«
Erst ein Stutzen, und dann ein befreites Lachen.
»Winrich, hast du dich nun endlich aufgerafft? Nun, dir gebe ich unsere – pardon, Goldige ist ja jetzt tabu – gebe ich unsere Ortrun gern.«
»Verbindlichsten Dank. Und was sagt die liebe Frauke dazu?«
»Ich habe eine Mordsfreude. Schon allein deshalb, daß ich die Verantwortung für dieses gefährlich schöne, gefährlich reiche Mädchen los bin, und daß es nun so gut bei dir aufgehoben ist, Winrich. Na das ist vielleicht ein glückhaftes Nachhausekommen!«
Nachdem auch dieser Freudensturm sich gelegt hatte, nahm man des Regenwetters wegen in der Bibliothek Platz, wo das Bild des Professors hing, dem zwei junge Paare ihr Glück verdankten. Denn hätte er Frauke nicht das Haus vermacht…
Doch daran dachte man jetzt noch nicht. Jetzt gab es noch vieles zu fragen und vieles zu beantworten. Die erste Frage stellte Uwe:
»Winrich, du wirst doch nicht so töricht sein und mit der Hochzeit warten, bis das obligate Trauerjahr vorüber ist?«
»Nein, so töricht bin ich nicht. Unsere Hochzeit findet in drei Wochen statt, das Aufgebot ist bereits bestellt.«
»Bravo. Wieviel Gäste?«
»Da ihr ja keine mehr seid, nur Doktor Danz und seine Familie. Standesamt, ein stilles Zusammengeben in der Schloßkapelle, ein opulentes Mahl und anschließend eine Hochzeitsreise von zwei Wochen. Länger kann ich von der Landwirtschaft nicht fort, wo jetzt ja Hochbetrieb ist.«
»Damit ihr es wißt. Tante Jadwiga bleibt nicht bei euch, sondern kommt zu uns«, blähte Oda sich förmlich auf. »Ihr habt an Hulda, Bertchen und Michel genug.«
»Herzlichen Dank, daß du uns die wenigstens noch gnädigst überläßt«, lachte Uwe gleich den andern. »Wie großspurig du jetzt sein kannst, Baroneßchen. Denkst du noch daran, wie du ins grüne Haus flüchtetest?«
»Ach, laß doch«, winkte sie ab. »Verdirb mir nicht die frohe Stimmung.«
»Hast recht«, bekräftigte Frauke. »Wenden wir uns erfreulicheren Dingen zu. So wie ich Hulda kenne, hat sie Sekt kaltgestellt. Wie nahm sie übrigens eure Verlobung auf?«
»Brummig«, lachte Ortrun. »Sie meinte, daß der liebe Gott, der zwei Menschen in seiner besten Laune erschuf, auch füreinander bestimmte.«
»Ganz Hulda«, lachte Frauke und sorgte dafür, daß der Sekt bald in den Gläsern perlte. Wie auf Verabredung schweiften die Blicke aller zu dem Bild über dem Kamin hin. Frauke hielt ihm das Glas entgegen und sagte leise:
»Lieber Onkel, dein Erbe hat Glück und Segen gebracht. Wäre es nicht gewesen, hätten die Menschen niemals zusammengefunden, die jetzt so glücklich sind. Hab Dank für das Haus im grünen Grund!«