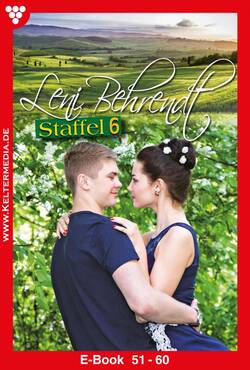Читать книгу Leni Behrendt Staffel 6 – Liebesroman - Leni Behrendt - Страница 7
Оглавление»Herr Baron, hier ist ein Einschreibebrief.«
Hellersen, der arbeitend am Schreibtisch saß, nahm der alten Barbe den Brief ab und setzte seinen Namen auf den Zustellungsschein, mit dem die Alte wieder hinausging. Gleichgültig öffnete er das Schreiben; doch schon bei den ersten Zeilen trat ein Ausdruck höchster Überraschung in sein Gesicht. Der Bogen trug links oben die Anschrift eines Notars, und der Inhalt des Schreibens lautete dann:
Baron von Hellersen, Verwalter auf Rittergut Lorren, wird gebeten, nach Empfang dieses Schreibens unverweilt nach Waldwinkel zu kommen. Die Aufforderung geschieht auf ausdrücklichen Wunsch des Herrn Leopold von Hellersen, des Besitzers von Waldwinkel, der schwer erkrankt ist.
Unten stand der schlecht leserliche Namenszug des Notars. Swen schüttelte zweifelnd den Kopf: Wenn dem Herrn Justizrat da nur nicht ein Irrtum unterlaufen war!
Waldwinkel, das sagenumwobene. So konnte man es wohl nennen, weil viele davon sprachen, wenige es jedoch mit eigenen Augen erschaut hatten. Ein wundervoller Besitz sollte dieses Waldwinkel sein, zu dem noch einige Vorwerke und die Güter Jagen und Trollen gehörten. Es war der Stammsitz der Hellersen, der immer auf den erstgeborenen Sohn vererbt wurde.
Das war im letzten Falle der verwachsene Leopold von Hellersen gewesen. Seinem jüngeren Bruder Ewald waren das naheliegende Rittergut Hirschhufen und die beiden Nebengüter Wallen und Lutzen als Erbteil zugefallen. Er hatte jedoch ein so verschwenderisches Leben geführt, daß sein Besitz unter den Hammer gekommen war. Sein Bruder Leopold hatte die Familiengüter ersteigert, weil er sie nicht in fremde Hände übergehen lassen wollte. Ewald erschoß sich, und seine Familie, die nun mittellos dastand, wurde von Leopold von Hellersen unterhalten. Er fühlte sich dazu verpflichtet, weil sie seine nächsten Anverwandten waren. Swen von Hellersen entstammte einer entfernten Seitenlinie. Er hatte Leopold von Hellersen nur einmal gesehen und ihn als unfreundlichen, stark verwachsenen und grundhäßlichen Mann in Erinnerung, der einsam auf seinem herrlichen Besitz lebte und nicht einmal seine nächsten Verwandten und Erben um sich duldete.
Und da sollte der alte Herr ausgerechnet ihn, Swen, der so entfernt mit ihm verwandt war, daß er eigentlich nur den Namen mit ihm gemein hatte, zu sich rufen?
Das war doch wohl kaum denkbar.
Es war wohl am besten, wenn er den Notar anrief; seine Telefonnummer stand ja auf dem Briefbogen.
Der Justizrat war jedoch nicht in seinem Büro zu erreichen. Er wäre in Waldwinkel, erhielt Hellersen als Auskunft. Und erst, als er dort anrief, bekam er den Herrn an den Apparat.
Nein, es wäre absolut kein Irrtum, lautete der Bescheid. Das Kommen des Barons wäre dringend, sehr dringend. Es hinge der Frieden eines Sterbenden davon ab; denn Leopold von Hellersen erwartete ihn mit Ungeduld.
Swen wurde die Angelegenheit immer rätselhafter. Was hatte er mit dem Frieden dieses fremden Mannes zu tun?
Nach Waldwinkel mußte er fahren, das konnte er wohl nicht umgehen. Es hieß also zuerst den Reiseplan aufstellen; er wußte ja nicht einmal, wohin er eigentlich zu fahren hatte, mußte erst die Station ausfindig machen.
Nach einiger Mühe war sein Plan fertig. Bis Königsberg konnte er mit dem D-Zug fahren, dann einige Stationen mit der Nebenbahn, dann mit der Kleinbahn, und schließlich hatte er noch ungefähr vier Kilometer zu Fuß zu gehen. Dieses Waldwinkel schien ja ein ganz gottverlassener Winkel zu sein. Gut, daß die Anschlüsse paßten, sonst käme er heute überhaupt nicht mehr ans Ziel.
Hellersen packte einen kleinen Koffer und ging dann nach dem Herrenhause hinüber, um sich Urlaub zu erbitten.
Als Hellersen sein Anliegen vorbrachte, sagte Herr Hungold: »Den Urlaub sollen Sie selbstverständlich haben.«
»Gehorsamsten Dank für die Urlaubsbewilligung. Ich komme wieder, sobald es mir möglich ist.«
Der alte Herr reichte seinem Verwalter mit betonter Herzlichkeit die Hand.
»Kommen Sie recht bald wieder!« verabschiedete er ihn.
*
Der Zug lief in einen Bahnhof ein, und Hellersen fuhr aus seinen Gedanken auf. Er spähte hinaus und las den Namen der kleinen Station, an der er zum zweitenmal umsteigen mußte. Rasch verließ er den Zug und wollte sich gerade nach dem Weg zur Kleinbahn erkundigen, als ein Herr auf ihn zutrat.
»Ich habe wohl Herrn Baron von Hellersen vor mir?« fragte er höflich, und der Gefragte war überrascht.
»Woher kennen Sie mich denn, mein Herr?«
Ein leichtes Lächeln ging über das ausdrucksvolle Gesicht des Mannes.
»Es steigen nicht viele Menschen auf dieser Station aus, und da dürfte es nicht schwerfallen, einen Hellersen herauszufinden. Gestatten: Roger Wieloff, Sekretär des Herrn von Hellersen-Waldwinkel«, stellte er sich mit einer respektvollen Verbeugung vor. Swen streckte ihm die Hand hin.
»Das freut mich, Herr Wieloff«, sagte er herzlich. »Sind Sie gekommen, um mich nach Waldwinkel zu holen?«
»Jawohl, Herr Baron. Eile tut nämlich not.«
Dabei schritt er schon auf ein elegantes Auto zu, neben dem der Fahrer in gestraffter Haltung stand.
»Darf ich den Herrn Baron bitten, Platz zu nehmen?« bemerkte Wieloff höflich und wollte sich neben den Führersitz setzen; doch Hellersen winkte ihn an seine Seite.
»Kommen Sie zu mir, Herr Wieloff. Sie müssen mir erzählen, was eigentlich in Waldwinkel los ist.«
Der Wagen sprang an. Obgleich aber Swen den Sekretär, der nun neben ihm saß, vieles fragen wollte, blieb er doch sehr schweigsam, erkundigte sich nur nach belanglosen Dingen, und Wieloff gab höfliche und klare Antworten.
Aufmerksam sah Swen sich um. Zuerst ging es durch das Städtchen, das einen erstaunlich großstädtischen Eindruck machte. Jetzt ging es ungefähr fünfzig Meter durch einen alten Park, und dann hielt der Wagen endlich vor dem Schloß. Ein alter Diener öffnete den Schlag. Swen stieg zögernd aus, und seine Blicke gingen an dem stattlichen Gebäude hoch. Mit einem Gefühl der Ehrfurcht betrachtete er den wundervoll zusammengefügten Bau. Soviel er von diesem Schloß auch schon gehört hatte, so bedeutend hatte er es sich doch nicht vorgestellt. Und dann die ganze Umgebung, einfach unvergleichlich schön! Vor dem Schloß, nur durch einen breiten Kiesweg getrennt, streckten sich gepflegte Rasenflächen mit Baumgruppen, Ziersträuchern und prachtvollen Blumenrabatten hin. Dahinter leuchteten die roten Dächer der hiesigen Wirtschaftsgebäude. Kleine Häuser lagen überall zerstreut; es waren wohl die Häuser der Gutsarbeiter. Und alles das eingerahmt von Wald – Wald und wieder Wald, so weit das Auge reichte. Herrlich, hier leben und schaffen, dieses Paradies sein eigen nennen zu dürfen. Beneidenswerter Leopold von Hellersen.
Mit einem leisen Seufzer ging Swens Blick wieder zum Schloß zurück und blieb an zwei männlichen Gestalten haften, die unter der Portaltür standen – still und stumm wie ja alles hier ringsum war. Er stieg die breiten Stufen empor und stand nun vor den Herren, die sich tief vor ihm verneigten.
»Justizrat Glang« – »Sanitätsrat Melch«, stellten sie sich vor. Schweigend gab Swen ihnen die Hand. Er wurde aus zwei Augenpaaren gemustert, sehr scharf, sehr eingehend, und fühlte sich beunruhigter von Minute zu Minute.
»Sie sind wohl der Herr, der mich brieflich hierhergerufen hat?« wandte er sich höflich an den Justizrat, und der nickte.
»Ganz recht, Herr Baron. Der Herr Onkel erwartet Sie schon ungeduldig. Wollen Sie mir bitte folgen.«
Sie betraten die riesengroße Halle des Schlosses, und Hellersen überwältigte fast der durch einige Stockwerke gehende, feierlich wirkende Raum. Er hatte ein kirchenartiges Gepräge, und dieser Eindruck wurde noch durch die buntgemalten Glasfenster erhöht. Es ging über weiche Teppiche, die zum größten Teil den kunstvoll eingelegeten Steinboden bedeckten, und an sehr hohen und sehr breiten geschnitzten Türen vorbei. Swen erschien das alles so unwirklich, beinahe märchenhaft. Er hatte das Gefühl, als ginge er schon stundenlang durch diese feierliche Stille, und er atmete wie befreit auf, als der Justizrat eine Tür öffnete und ihn mit einer höflichen Handbwegung einzutreten bat. Die Tür schloß sich hinter ihm; Swen wurde es recht unbehaglich zumute. Zuerst konnte er in dem Halbdunkel, das in dem weiten Raum herrschte, nichts unterscheiden. Es war so still um ihn her, daß er seine eigenen Atemzüge hörte.
»Ein echter Hellersen, ganz so wie er«, sprach nun eine Stimme ganz in seiner Nähe, sehr langsam, sehr müde und schleppend. Swen fuhr herum und entdeckte zu seiner Erleichterung den Sprecher in einem Lehnstuhl am Kamin.
»Komm näher, mein Junge!«
Er trat rasch auf die Gestalt im Lehnstuhl zu und ergriff die ihm entgegengestreckte, kraftlose, fieberheiße Hand. Aus ihn verhüllenden Decken schaute ein unförmiger Körper, auf dem ein viel zu kleiner Kopf mit einem faltigen Greisengesicht saß, hervor. Die Augen blickten glanzlos und unstet, musterten den Besucher jedoch sehr eingehend.
Das mußte wohl Leopold von Hellersen sein! Swen hatte Mühe, sein heftiges Erschrecken über diese Mißgestalt zu unterdrücken.
»Herr von Hellersen, ich bin gekommen…«, begann er zögernd, doch der Kranke winkte mit einer matten Handbewegung ab.
»Sag Onkel zu mir, mein Junge, wenn ich es auch dem Verwandtschaftsgrade nach kaum noch für dich bin. Zieh dir einen Sessel heran und nimm Platz! Ganz dicht, noch dichter! Ich kann nur leise sprechen und habe dir noch viel zu sagen.«
Swen schob einen Sessel an den Lehnstuhl heran und bemerkte jetzt erst die mächtige Dogge, die an der Seite ihres Herrn lag, jede Bewegung des Besuchers aufmerksam verfolgend.
»Harras hat schon längst erkannt, daß du gut Freund bist. Kannst ganz beruhigt hier sitzen«, ermunterte ihn der häßliche Mann, dessen kraftlose Greisenhände nun nach den jungen, nervigen des Neffen griffen. Wieder mußte Swen einen langen, prüfenden Blick über sich ergehen lassen. Die Musterung schien jedoch zur Zufriedenheit des Kranken ausgefallen zu sein. Er seufzte auf, ließ die festen Männerhände los und legte sich tiefer in den Lehnstuhl zurück.
»Beneidenswerter Junge«, murmelte er mehr für sich und sank förmlich in sich zusammen. Doch gleich richtete er sich wieder auf, so gut es gehen wollte. Er begann mit Fragen, die ebenso rätselhaft waren wie alles, was Swen hier erlebte und die der seltsame Frager immer gleich selbst beantwortete. Er sprach mit brüchiger Stimme, leise und abgehackt und überließ es dem Zuhörer, angedeutete Dinge zu Ende zu denken.
»Du warst verheiratet? Ich weiß, mit Ilse Neßling, der Tochter des Verwalters aus Lorren, dessen Stelle du nach seinem Tode bekamst. Zum Dank dafür heiratetest du seine Tochter.«
»Das stimmt nicht ganz, Onkel, ich liebte meine Frau. Leider starb sie zu früh.«
»Hast es dir eingebildet, mein Junge. Das weiß ich, der ich durch die Hölle der Liebe gegangen bin. War sie gut, deine Ilse? Ja, sie war lieb und nett, aber keine rechte Frau für dich. Du wirst an meine Worte denken, wenn du einmal die rechte gefunden hast.«
Je länger der Kranke sprach, desto überraschter war Swen. Es war erstaunlich, wie gut der Onkel über ihn Bescheid wußte.
»Du hast eine Tochter«, sprach nun wieder die dünne, brüchige Stimme. »Ich weiß, sie ist drei Jahre alt. Ist verzogen und verwöhnt.«
»Ein Kind, das ohne Mutter aufwächst, Onkel!«
»Brauchst dich nicht zu entschuldigen, Junge. Brauchst ja nur wieder zu heiraten, mußt überhaupt heiraten. Hörst du, du mußt! Du darfst nicht ohne Erben bleiben, das wäre Frevel an deinem Geschlecht. Versprichst du mir das?«
»Aber, Onkel, ich weiß nicht.«
»Nein, du weißt nicht – jetzt noch nicht. Aber du wirst es gleich wissen. Und du sollst mir versprechen…«
Swen sah, wie der Kranke nach dem Herzen griff, wie er sich zu erregen begann, und nickte wie unter einem Zwang. Da wurde der Mann wieder ruhiger.
»Ich habe deine Mutter geliebt, deinen Vater gehaßt«, flüsterte er. Swen zuckte zusammen.
»Onkel Leopold!«
»Laß nur, daran ändert dein ganzes Entsetzen nichts. Dein Vater war ein ganzer Mann, stolz und aufrecht – genau wie du, sein Sohn! Er besaß alles, wonach ich förmlich lechzte – Schönheit, Kühnheit. Auch die von mir bis zur Raserei geliebte Frau. Darum haßte ich ihn. Und dich auch, weil du ihm bis zur Lächerlichkeit gleichst. Das war unrecht von mir, das habe ich voll bitterer Not erkennen müssen.«
Er brach unvermittelt ab und schien angestrengt über etwas nachzudenken. Swen hatte eine so eigenartige Stunde noch nie erlebt, und das Herz klopfte ihm vor Unruhe bis zum Halse hinauf.
»Du weißt noch nicht, wie das ist, wenn man innerlich fast verbrennt – vor Liebe, vor Leidenschaft, und dazu so aussieht wie ich. Aber du wirst es schon noch erfahren. Bist ja ein echter Hellersen, und die hat die Liebe nie verschont. Hat sie geschleift durch Himmel und Hölle. Ich habe nur die Hölle kennengelernt.«
»Aber Onkel, wie kannst du dich nur so erregen«, sagte Swen vorwurfsvoll, als er merkte, wie sehr sich der Kranke quälte. »Ich werde jemand herbeirufen, damit er dich bequemer bettet.«
»Nein, ich will mit dir allein bleiben«, kam es eigensinnig zurück. »Kennst du die Gerswint Hellersen? Ich weiß, du kennst sie, hast sie nur fünf Jahre nicht mehr gesehen. Sie ist schön, aber hochmütig und hoffärtig, genau wie ihre Mutter, wie die ganzen Kinder überhaupt nach dieser dünkelhaften, verschwenderischen Frau geraten sind. Keines ist Hellersensche Art, schade. Sie sind nicht schlecht, nur im Sinne ihrer Mutter erzogen – falsch, total falsch. Ganz wertvolles Material, kann viel Gutes daraus geschaffen werden.«
Diese lange Rede schien den Kranken sehr angestrengt zu haben. Er legte sich völlig erschöpft im Lehnstuhl zurück und sah den Neffen mit angstvollen, hilflosen Augen an.
»Deine Hände, Junge«, murmelte er. »Sie strömen so viel Kraft aus, so große Beruhigung.«
Swen faßte behutsam nach den welken Greisenhänden. Stand über den Kranken gebeugt da und wagte sich nicht zu rühren. Bemerkte mit Grausen, wie das häßliche Gesicht sich veränderte, spitz und kalkweiß wurde. Der Atem wurde immer unregelmäßiger, unruhiger, wurde zuletzt pfeifend und schwer.
Die Augen des Kranken öffneten sich beängstigend weit, die Lippen liefen blau an.
»Swen, versprich mir…«, keuchte er mit großer Anstrengung. »Vergiß nie, daß du – ein Hellersen – bist. Die Pflicht – gegen dein – Geschlecht…«
Ganz plötzlich sank die verkrampfte Gestalt in sich zusammen; über das Antlitz ging ein verklärender Schein.
»Gertraude«, flüsterte er. »Gertraude!«
Dann fiel der Kopf schwer vornüber, und Swen wußte, daß er einen Toten vor sich hatte. Vorsichtig löste er seine Hände und legte den entseelten Körper in die Kissen des Lehnstuhls zurück. Der Hund winselte jämmerlich und drängte sich wie hilfesuchend an Swen, der ihm tröstend über den mächtigen Kopf strich. Er streckte sich dann wieder zu Füßen seines toten Herrn, und Hellersen schoß es durch den Sinn, wie schwer es sein würde, den treuen Gesellen von diesem Platz zu bekommen. Sein Blick ging wieder zu dem Toten hin, der so friedlich aussah.
Lieber Onkel Leopold, dachte er traurig. Warum hast du mich nicht früher zu dir gerufen? Nun habe ich dich kennengelernt, um dich gleich wieder zu verlieren.
Niedergedrückt schlich er leise durch das Zimmer, öffnete die Tür zur Halle – und schrak zurück. Vor ihm standen die Herren Glang, Melch und Wieloff und hinter ihnen Gestalten in Dienstkleidung, wohl das Schloßpersonal. Alle sahen sie mit atemloser Spannung zu ihm hin, und Swen mußte heftig schlucken, bevor er sprechen konnte. Und als er es endlich tat, klang seine Stimme dennoch heiser und gepreßt.
»Mein Onkel ist tot. Eben jetzt verschieden.«
Da senkten sich die Köpfe gottergeben, und hie und da wurde unterdrücktes Schluchzen laut.
»Also doch«, sagte der Sanitätsrat traurig. »Wir haben es stündlich erwartet. Hat er wenigstens einen leichten Tod gehabt?«
»Er schlief mir unter den Händen ein.«
»Wie gut, daß Sie noch zur Zeit kamen, Herr Baron«, sagte der Arzt. Er betrat leise das Sterbezimmer, und die anderen folgten ihm.
Hellersen blieb in der Halle zurück und ließ sich in den nächsten Sessel sinken. Seine Gedanken hasteten hinter der Stirn wie aufgescheuchte Vögel und kehrten doch immer wieder zu der Frage zurück: Warum hat man mich hierhergerufen?
Diese Männer und Frauen, die jetzt im Sterbezimmer weilten und über den Tod des Schloßherrn so erschüttert waren, mußten dem Verstorbenen doch nahegestanden haben. Er jedoch war ihm ein Fremder. Und doch hatte Onkel Leopold so merkwürdig gut über ihn Bescheid gewußt. Immer rätselhafter erschien ihm das alles, immer verworrener und geheimnisvoller.
Eben kehrten die Trauernden aus dem Sterbezimmer in die Halle zurück. Die Dienerschaft zog sich leise zurück, und die vier Herren beratschlagten, wo sie den Hund hinschaffen könnten. »Man müßte Harras zu dem Oberförster bringen«, sagte der Sekretär. »Dort kann er bleiben, bis hier alles vorüber ist. Aber er wird sich kaum dorthin führen lassen. Und fort muß er, weil er niemand an den Toten heranläßt.«
»Man müßte ihn betäuben«, schlug der Baron vor, und dieser Vorschlag konnte in die Tat umgesetzt werden, da der Arzt ein geeignetes Betäubungsmittel in seiner Medikamententasche mit sich führte. Es gab nun noch ein schweres Stück Arbeit, bis man den betäubten Hund zur Oberförsterei schaffen konnte. So schwer es allen auch fiel, man mußte die Läufe fesseln und dem Tier einen Maulkorb umbinden, damit man es, wenn es aus der Betäubung erwachte, bändigen konnte. Erst als der treue Wächter entfernt war, konnte man den Toten hinlegen.
Mittlerweile war es Abend geworden, und der Diener Christian bat die Herren zu Tisch. Man begab sich nach dem sogenannten kleinen Speisesaal, und Hellersen, der von den Erlebnissen des Tages halb betäubt war, konnte nicht verstehen, wie man jetzt an Essen denken konnte.
In dem kleinen Speisesaal, der kaum den Namen verdiente, denn er erschien Swen riesengroß, stand in einem Erker ein runder Tisch mit Speisen bestellt.
Vier Gedecke lagen darauf, und die drei Herren schienen hier ihre Stammplätze zu haben, denn sie traten hinter die Stühle und warteten, daß der Gast sich setzen solle. Der blickte zögernd auf den wuchtigen Lehnsessel, der noch frei war.
»Bitte Platz zu nehmen, Herr Baron!« ermunterte der Justizrat und zeigte auf den Ehrensitz. »Hier hat immer unser lieber Freund Leopold gesessen.«
Hellersen wollte erwidern, daß ihm der Platz gar nicht zukäme.
Aber wozu? Auf mehr oder weniger ungeklärte Dinge kam es hier kaum an. Er mühte sich, etwas zu essen, ließ zwischendurch seine Blicke umherschweifen und war entzückt von der Vornehmheit, die im Saale herrschte.
Zuletzt betrachtete er die Herren, die mit ihm speisten, verstohlen.
Der Justizrat und der Sanitätsrat sahen sich merkwürdig ähnlich. Beide hatten untersetzte Gestalten, ausdrucksvolle Gesichter und kluge, scharfblickende Augen. Sie waren Swen sofort sympathisch, und doch gefiel ihm der Sekretär noch besser. Der Mann sah überraschend gut aus, vornehm, weltmännisch und elegant.
Swen hob die Tafel auf, denn er hatte das Gefühl, daß man das von ihm erwartete, und wandte sich an den Justizrat: »Sie wissen sicherlich hier mit den Fahrgelegenheiten Bescheid, Herr Doktor. Darf ich also um freundliche Auskunft bitten? Ich möchte nämlich heute noch nach Hause zurück.«
»Das wird leider nicht gehen, Herr Baron«, erwiderte der Anwalt höflich. »Nicht etwa, weil Sie um diese Abendstunde weder an Kleinbahn noch an Nebenbahn Anschluß haben. Das Auto könnte Sie ja nach Königsberg bringen – oder nach Lorren. Allein Sie können jetzt hier unmöglich fort.«
»Ja, aber mein Himmel; was soll ich denn noch länger hier?« entfuhr es Hellersen unwillig. »Hier etwa herumsitzen? Das kann ich mir nicht leisten; ich stehe in fremden Diensten. Außerdem möchte ich mit den Erben, die ja bald hier erscheinen werden, nicht zusammentreffen. Ich habe allen Grund dazu.«
»Das weiß ich alles, Herr Baron«, bestätigte der Justizrat und lächelte leicht, als Swen ihn verblüfft anstarrte. »Aber trotzdem können Sie hier nicht fort, wenigstens heute noch nicht. Ich habe so das Gefühl, daß Ihr Herr Onkel einige Stunden zu früh gestorben ist, daß er Ihnen nicht alles gesagt hat, was er Ihnen sagen wollte. Ich kann daher Ihren Unwillen nur zu gut begreifen. Bitte, Herr Baron, ich frage nicht aus Neugierde, aber ich möchte gerne wissen, was der Herr Onkel Ihnen alles gesagt hat.«
»Eigentlich nichts von Bedeutung«, versetzte Hellersen kurz. »Er sprach von mir, meiner verstorbenen Frau, meiner Tochter und von meinen Eltern. Erwähnte seine Erben und starb mir dann unter den Händen weg.«
»Dann möchte ich Sie bitten, mir zu folgen, Herr Baron«, forderte der Anwalt ihn auf, und Swen wurde nun wirklich neugierig, was er wieder erleben würde. Er ging jedoch gutwillig mit Glang, der ihn nach dem Zimmer des Verewigten führte. Der Justizrat schien hier merkwürdig gut Bescheid zu wissen, er kannte selbst das versteckt liegende Geheimfach des Schreibtisches, aus dem er einen schwerversiegelten Brief nahm und ihn Hellersen mit tiefer Verbeugung reichte.
»Der Tote wird jetzt zu Ihnen weitersprechen, Herr Baron«, sagte er feierlich. »Sollte Ihnen manches unverständlich sein, fragen Sie mich. Ich war nicht nur der Anwalt Ihres Herrn Onkels, sondern auch sein Vertrauter und Freund. Daher kenne ich seine Angelegenheiten so gut wie meine eignen. Wenn Sie den Brief gelesen haben, dann rufen Sie mich, ich stehe zu Ihrer Verfügung.« Er verließ das Zimmer, und Swen sah ihm kopfschüttelnd nach.
*
In einem Königsberger Vorort wohnte die verwitwete Frau Elisa von Hellersen mit ihren vier Kindern Bolko, Gerswint, Edna und Elke. Als Kind wohlhabender Eltern geboren, hatte sie eine sorglose Kindheit und Jungmädchenzeit verlebt. Als sie dann Ewald von Hellersen heiratete, kam sie in noch bessere Verhältnisse. Daher hatte sie nicht die Schattenseiten des Lebens kennengelernt. Rechnen zu müssen war ihr ein fremder Begriff. Ihre Kinder hatte Frau Elisa ganz in ihrem Sinne erzogen, und diese machten ihrer Erziehung auch alle Ehre. Waren schöne, gepflegte Menschenkinder, die selbstbewußt und hoffärtig ihren Weg gingen und sich einbildeten, vom Schicksal etwas Besonderes beanspruchen zu dürfen. Sie lebten alle bei ihrer Mutter, die auch noch nach dem Tode des Gatten ein großes Haus machte.
Der siebenundzwanzigjährige Sohn, der das Landwirtschaftsfach studierte, war nicht energisch genug, um ernstlich vorwärts zu streben und das Studium zu vollenden. Ein Herrenleben voll Müßiggang sagte ihm entschieden mehr zu. Die zweiundzwanzigjährige Gerswint füllte ihre Tage aus mit Gesellschaften und Sport, die neunzehnjährige Edna und die zehnjährige Elke besuchten noch die Schule. Frau Elisa war nämlich der Ansicht, daß ihre Töchter das Abitur machen müßten, gleichgültig, ob sie es später verwerten konnten oder nicht.
Also saß Edna noch auf der Schulbank und plagte sich mit Dingen herum, die ihr gar nicht lagen.
Die Zeit in der Stadt war ja nur ein Übergang. Nach dem Tode des Erbonkels würde sich alles für sie mit einem Schlage ändern. Und nun war es endlich soweit: Leopold von Hellersen war tot. Eben hielt Frau Elisa das Telegramm, das sie vom Ableben des Schwagers in Kenntnis setzte, in der zitternden Hand. Ihre Kinder standen um sie herum, und in ihren klaren, gepflegten Gesichtern stand entschieden mehr Freude als Trauer.
Warum sollte der Tod des menschenscheuen, verbitterten Onkels ihnen auch nahegehen? Sie hatten ihn nur einige Male gesehen und sich dann vor seiner Mißgestalt gefürchtet.
»Kinder, nun gilt es, alles in Ruhe zu überlegen«, sagte Frau Elisa würdevoll. Sie verfügte über eine bewundernswerte Selbstbeherrschung, die sie auch ihren Kindern als erste Pflicht gegen sich selbst anerzogen hatte.
So gab es denn kein wirres Durcheinander. Alles das, was besorgt und bedacht werden mußte, wickelte sich in Ruhe ab.
»Ich bin dafür, daß wir im eigenen Auto nach Waldwinkel fahren«, bemerkte die Mutter, als sich die Mädel über die Zugverbindung unterhielten, in ihrer bestimmten Art, die keine Widerrede duldete.
»Bolko, du begleitest mich wohl zum Autohändler; du verstehst ja etwas von Wagen.«
So kam es denn, daß die Familie Hellersen zwei Tage später im neuen Auto, das ganz ihren verwöhnten Ansprüchen entsprach, nach Waldwinkel zur Beisetzung des Erbonkels fuhr. Ein Fahrer, der Frau Elisa zusagte, war auch gemietet worden und steuerte den teuren Wagen mit würdevoller Ruhe.
Während Frau Elisa und ihre Kinder Waldwinkel zufuhren, schmiedeten sie die schönsten Zukunftspläne. Viel zu rasch war für sie das Ziel erreicht, es hatte sich in dem weichgefederten Wagen so gut gesessen. Überhaupt war die schöne Autofahrt ein langentbehrter Genuß für sie alle gewesen.
Swen von Hellersen, der am Fenster des Gastzimmers stand, sah den kostbaren Wagen vor dem Portal des Schlosses halten und ahnte, wer ihm entsteigen würde. Ein Zug von Bitterkeit und Ironie trat in sein hartes Antlitz, als er sie alle, mit denen er vierzehn Jahre lang zusammen gelebt, nach fünfjähriger Trennung wiedersah.
Tante Elisa – ach ja, das war sie. Eine würdige, hochmütige Dame, die alles, was nicht mit ihren Anschauungen übereinstimmte, weit von sich schob. Bolko hatte sich so entwickelt, wie er sich als Sohn dieser Mutter ja nicht anders hatte entwickeln können. Er war sehr selbstbewußt und aufgeblasen.
Und Gerswint? Nun, die zweiundzwanzigjährige junge Dame hatte gehalten, was sie als siebzehnjähriges Mädchen schon versprochen, war zu einer beachtenswerten Schönheit herangereift. Allein Swens Geschmack war sie nicht; sie war ihm zu hochmütig und überheblich.
Edna sah der älteren Schwester sehr ähnlich, erschien jedoch nicht so unnahbar wie sie.
Reizend war die kleine Elke mit den langen blonden Zöpfen. Auch sie glich den Schwestern. Sie gab sich wohl alle Mühe, sich wie eine kleine Dame zu bewegen, wirkte aber trotzdem kindlich und lieb.
Augenblicklich hatten sie alle für nichts anderes Augen als für das Schloß und seine Umgebung; denn auch Frau Elisa und ihre Kinder waren nie in Waldwinkel gewesen. Leopold von Hellersen hatte die Schmarotzer, wie er seinen Bruder und dessen Familie immer genannt, nie um sich dulden wollen.
Also das war Waldwinkel, von dem sie alle schon so viel gehört. Es war größer und gediegener, als man es sich vorgestellt hatte. Man war sehr zufrieden, und der Justizrat, der unter dem Portal stand, um die Gäste willkommen zu heißen, wurde mit freundlicher Herablassung begrüßt.
»Sie waren wohl der Rechtsberater unseres lieben Verewigten?« fragte Frau Elisa und reichte ihm die Hand. »Dann werden Sie ja auch wissen, daß wir ihm am nächsten gestanden haben.«
»Gewiß, gnädige Frau. Die Zimmer sind zum Empfang bereit, der Diener wird die Herrschaften führen«, entgegnete der Anwalt höflich.
Ja, so gefiel es Frau Elisa, so hatte sie es erwartet. Sie fühlte sich schon ganz als Herrin und hielt es daher für selbstverständlich, daß man die Gastzimmer für sie und ihre Kinder gerichtet hatte.
Schön war es hier, wunderschön. Alles so vornehm, so ungemein harmonisch. Solche Räume konnte eine Stadtwohnung nie aufweisen, und wenn sie noch so elegant eingerichtet war.
Zuerst machten Frau Elisa und ihre Töchter sich daran, die Koffer auszupacken. Dann kleideten sie sich um, wobei sie die mollige Wärme, die dem Kamin entströmte, angenehm empfanden.
Später gingen sie dann hinunter, wo sie in der Halle den Justizrat vorfanden, der die Herrschaften zur Mittagstafel bat.
Das Mahl war köstlich zubereitet, die Bedienung tadellos, und Frau Elisa wurde immer zufriedener.
»Nun erzählen Sie uns mal Näheres über den Tod unseres lieben Onkels Leopold, Herr Doktor«, wandte sie sich freundlich an den Justizrat. »Er ist wohl unerwartet gestorben?«
»Nein, gnädige Frau. Er kränkelte schon seit dem Frühjahr.«
»Der Arme! Aber da wundere ich mich, daß er uns nicht zu sich gerufen hat. Wir waren doch seine einzigen nahen Verwandten, und er wird doch noch so manches auf dem Herzen gehabt haben?«
»Davon weiß ich nichts zu berichten, gnädige Frau.«
»Das finde ich aber merkwürdig. Waren Sie nicht sein Anwalt und Vertrauter, Herr Doktor?«
»Ich war sogar sein Freund«, setzte er hinzu. »Doktor Melch und ich gingen hier als einzige Fremde aus und ein.«
»Sonst hatte mein Schwager keinen Verkehr?«
»Keinen, gnädige Frau.«
Das war dieser Weltdame unverständlich, denn sie schüttelte mißbilligend den Kopf.
»Na ja, der gute Leopold war eben ein Einsiedler und Sonderling. Schuld daran war wohl seine Mißgestalt. Ist er etwa auch so allein gestorben, wie er gelebt hat?«
»Nei…n!«
»Also sind Sie dabei gewesen? Das ist mir eine außerordentliche Beruhigung, Herr Doktor. Hat er einen leichten Tod gehabt?«
»Einen beneidenswert leichten.«
»Das ist mir ein Trost. Aber wie ist es, Herr Doktor, müßte der Tote jetzt nicht aufgebahrt werden? Ist der Sarg überhaupt schon bestellt?«
»Alles ist aufs beste erledigt, gnädige Frau. Mein lieber Freund ruht bereits auf seinem letzten Lager.«
»Aber das geht doch nicht!« erregte sich Frau Elisa. »Ich meine, das ist doch Angelegenheit der Nächststehenden. Und das sind in diesem Fall doch ich und meine Kinder.«
»Der Verstorbene muß wohl anderer Ansicht gewesen sein«, meinte Glang schulterzuckend. »Denn er hat darüber anders verfügt.«
»So bitte ich, mir die Verfügungen auszuliefern!« verlangte sie kurz und glaubte nicht recht zu hören, als der Justizrat erwiderte, daß er leider nicht befugt sei, das Schriftstück aus der Hand zu geben.
Frau Elisa preßte die Lippen zusammen, und auf ihrer Stirn erschien eine scharfe Falte. Das war immer ein Zeichen höchsten Unwillens.
»Das wird ja immer merkwürdiger. Sie sollten nicht so viel Befugnis haben, hinterlassene Briefe des Verewigten, die zweifellos vorhanden sind, den Erben ausliefern zu dürfen?«
»Bedaure sehr, gnädige Frau.«
Da wandte sie sich schroff ab. Ihre Kinder wußten, wie böse nun die Mama war, wenn man ihr äußerlich auch kaum etwas anmerken konnte. Sie verhielten sich so ruhig wie möglich. Der Justizrat verspürte sowieso keine Lust zu großen Gesprächen, und Wieloff wagte überhaupt nicht, ungefragt zu reden.
Daher war es sehr ungemütlich an der Tafelrunde, und sie atmeten alle erleichtert auf, als Frau Elisa sich erhob.
Sie äußerte kurz den Wunsch, den Toten zu sehen, und der Anwalt war bereit, sie zu führen.
Als sie den großen Saal, in dem der Tote aufgebahrt war, betraten, umklammerte Elke Gerswints Arm und preßte ihr Gesicht daran. Der düstere Raum, der nur von den Kerzen in den Wandleuchtern erhellt wurde, der Duft der Blumen und der Bäume, die den Katafalk umstanden, und endlich der stumme Schläfer in seinem Sarge flößten dem Kinde zitternde Angst ein.
Frau Elisa ließ ihre Blicke umherschweifen, und ihren scharfen Augen entging nichts. Aber sie sah nicht den friedlichen, fast lächelnden Ausdruck in dem Antlitz des Toten, das im Leben nie so schön und edel gewesen war wie jetzt. Sie fand nur, daß alles lächerlich einfach war. Als wäre hier nicht ein reicher Mann, sondern ein armer Schlucker aufgebahrt.
*
In ihren Räumen sagte Frau Elisa: »Herba ist vom Ableben Onkel Leopolds benachrichtigt. Sie wird hier erscheinen, und ich erwarte von dir, mein Sohn, daß du deine spätere Gattin vor allen Menschen auszeichnest.
Auch Alf kommt«, wandte sie sich dann an ihr schönstes und liebstes Kind, es mit wohlgefälligen Blicken betrachtend. Sie sah aber Edna unwillig an, die erfreut ausrief: »Dann kommt auch sein Bruder mit.«
»Hoffentlich kommt er nicht mit!« betonte die Mutter scharf. »Deine Vorliebe für ihn gefällt mir nicht, mein Kind. Er ist weiter nichts als der Schatten seines bedeutenden Bruders Alf – in jeder Beziehung. Und mir daher als Gatte meiner Tochter ganz und gar unerwünscht. Ich habe andere Pläne mit dir. Mache erst deine Prüfung, dann sollst du sie erfahren.«
»Ich dachte, das wäre jetzt nicht mehr nötig«, meinte Edna niedergeschlagen und schwer enttäuscht. »Wir sind doch jetzt wieder reich, Mama.«
»Um so mehr müßt ihr danach streben, euch ein angemessenes Wissen anzueignen. Ich will nicht nur schöne, sondern auch kluge und gebildete Töchter haben«, belehrte sie in einem Ton, der jede Widerrede von vornherein ausschloß.
Da wußte Edna, daß sie weiterlernen mußte.
*
Der Tag der Beisetzung war gekommen – ein grauer, regnerischer Septembertag. Im Schlosse war alles feierlich still. Nichts deutete darauf hin, daß eine Stunde später der tote Schloßherr zu Grabe getragen werden sollte.
Frau Elisa und ihre Kinder kleideten sich sorgfältig an und sahen denn auch sehr schön und elegant aus, als sie unten im Schloß erschienen. Sie war heute mit ihren Kindern zufrieden. Hauptsächlich auf Gerswint ruhten ihre Augen mit Mutterstolz. Diese Tochter war ganz nach ihrem Geschmack.
Aber auch Edna hatte sich gut entwickelt, das fiel der Mutter besonders heute auf. Sie glich Gerswint auffallend. Nur daß ihr das Überlegene, Hochmütige fehlte – das war in Frau Elisas Augen eine Unvollkommenheit.
In der Halle des Schlosses standen schon die Herren Glang, Melch und Wieloff und mit ihnen die Beamten der Hellersenschen Güter. Es war eine ansehnliche Schar, wie Frau Elisa mit der Befriedigung feststellen konnte; die Herrschaft Waldwinkel mußte also noch größer sein, als sie angenommen hatte. Die Frauen und Kinder, die unter den Männern standen, gehörten wohl zu den Beamten.
Frau Elisa und die Ihren schritten an der Gruppe vorüber und suchten sich in gemessener Entfernung einen Platz, als wollten sie den Leuten klarmachen, daß sie keine Gemeinschaft mit ihnen wünschten. Und die ohnehin schon traurigen Mienen der Frauen und Männer wurden immer trostloser. Voll Wehmut gedachten sie der guten Tage, die sie bei ihrem verstorbenen Herrn gehabt hatten.
»Da stehen einem ja die Haare zu Berge bei so viel Unnahbarkeit«, spottete der Sanitätsrat halblaut. »Und was werden Ihre Gnaden dazu sagen?« zeigte er mit einer Kopfbewegung zum Portal hin, durch das soeben die Gutsleute die Halle betraten. Männer, Frauen und Kinder, alle sahen sie niedergeschlagen und verschüchtert aus.
»Arme Leute«, sagte der Arzt mitleidig. »Die guten Tage, die sie bei dem Dahingeschiedenen hatten, werden sie nun doppelt büßen müssen durch die, die jetzt die Herrschaft antreten.«
Der Justizrat nickte zerstreut.
»Ich werde jetzt den Zug eröffnen und in das Totenzimmer gehen, damit den Leuten noch Zeit genug bleibt, von ihrem Herrn Abschied zu nehmen. In einer halben Stunde ist der Pfarrer hier.«
Langsam bewegte sich der lange Zug zum Saale hin. Trotz der vielen Menschen herrschte eine tiefe Stille, die nur von unterdrücktem Schluchzen unterbrochen wurde.
Und dann standen sie vor dem toten Gutsherrn. Die Frauen und Kinder weinten bitterlich, und auch die Männer wurden hier und da von einem trockenen Schluchzen geschüttelt.
Frau Elisa und ihre Kinder sahen mit großen Augen auf das erschütternde Bild. Daß man um einen Menschen so trauern konnte, und um einen fremden noch dazu, das war ihnen neu. Sie fühlten sich recht unbehaglich und hatten nur den einen Wunsch, daß die Trauerfeierlichkeiten erst zu Ende wären.
Doch plötzlich weiteten sich ihre Augen.
Diese hohe Gestalt, die da soeben durch den Saal schritt, das war doch…?
Tatsächlich, es war Swen. Ja, was wollte der denn hier? Der hatte dem Verstorbenen doch gewiß nicht nahegestanden, hatte ihn nicht einmal gekannt.
Und wie gut er aussah, wie er sich in den fünf Jahren, da sie ihn nicht gesehen, herausgemacht hatte!
Einfach unglaublich!
Und wie er dahinschritt. Mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre er hier der Herr.
Frau Elisa und ihre Kinder sahen sich an, und einer las in des andern Augen Überraschung und Bestürzung.
Nur Elke erkannte den Vetter nicht. Sie war ja auch erst fünf Jahre alt gewesen, als er Hirschhufen verlassen hatte.
Jetzt schien Swen die Verwandten bemerkt zu haben, denn er verhielt den Schritt. Als er jedoch ihre eisigen Mienen sah, ging er weiter, und ein ironisches Lächeln zuckte um seinen Mund.
Wie war Swen hierhergekommen?
Das war die Frage, die Frau Elisa und die Ihren sehr beschäftigte, viel mehr als alles andere.
Wie die Leute ihm ehrerbietig Platz machten, als er an den Sarg trat. Da gehörte er doch wirklich nicht hin! Aber so war es ja schon immer gewesen; er hatte sich Rechte angemaßt, die ihm nicht zukamen.
Frau Elisa schrak aus ihren unerfreulichen Gedanken auf, als Christian plötzlich vor ihr stand und ihr leise eine Meldung machte. Darauf verließ sie den Saal und kam erst nach Minuten wieder. Man sah es ihr an, daß sie etwas sehr erzürnt haben mußte. Sie ging auf die Gruppe zu, in der der Justizrat stand.
»Herr Doktor, ich weiß nicht mehr, was ich zu den sonderbaren Zuständen, die hier herrschen, sagen soll«, begann sie zwar gedämpft, aber leicht vernehmlich. »Soeben läutet ein Bekannter von uns an, der mit Schwester und Bruder aus Königsberg zur Beisetzung hierhergekommen ist, daß man die Tore versperrt hält und niemand auf das Gut läßt. Was hat das zu bedeuten?«
Der Anwalt gab gelassen zurück. »Mein Freund wünschte unter den Trauergästen nur die anwesend, die hier bereits versammelt sind.«
»Und diese Marotte eines Sonderlings wird so streng befolgt? Das ist doch geradezu lächerlich!«
»Wie kann die letztwillige Verfügung eines Verstorbenen lächerlich sein, gnädige Frau?« fragte Glang mit einer Schärfe, die der ungehaltenen Dame auf die Nerven fiel. Sie biß sich auf die Lippen, denn sie sah selbst ein, daß sie doch zu weit gegangen war.
»Na ja, gewiß«, versuchte sie ihre herben Worte abzuschwächen. »Es sollten doch aber wenigstens Menschen eingelassen werden, die uns nahestehen, die sozusagen zur Familie gehören.«
»Nun gut«, entschied der Anwalt noch ein wenig zögernd. »Mögen die Dame und die beiden Herren der Feier am Grabe beiwohnen. Nur hierherzukommen, davon müssen sie absehen.«
Frau Elisa war’s zufrieden, und Christian wurde beauftragt, einen großen grünen Wagen, der vor dem Schloßtor halten würde, einzulassen.
Einige Minuten später wurde der Sarg geschlossen, und gleich darauf betrat der Pfarrer den Saal. Eine kurze, doch sehr wirkungsvolle Feier begann, bei der selbst Frau Elisa die Tränen in die Augen traten. Dann trugen acht Arbeiter den Sarg davon. Dicht hinter ihm schritt Swen mit solcher Selbstverständlichkeit, als müßte er so sein und nicht anders.
Vor dem Portal warteten bereits die Gäste der Frau Elisa. Sie begrüßte sie flüchtig und behielt sie an ihrer Seite.
Langsam bewegte sich der unübersehbare Zug zu dem Platz hin, den Leopold von Hellersen sich für seine letzte Ruhestätte ausgesucht hatte.
Dort, wo der Park durch eine Wiese vom Walde getrennt war, wo sich weiter hinten die Bäume zu einem Halbkreis zusammenschlossen, lag ein Waldsee. Und gerade dort zwischen Wiese, Wald und Wasser hatte Leopold von Hellersen am liebsten geweilt und auch begraben zu werden gewünscht.
Das konnte Frau Elisa nun auch wieder nicht verstehen. Seine Ahnen ruhten doch alle im Erbbegräbnis!
Swen war der erste, der die Handvoll Erde in die Gruft warf. Darauf folgten ein Strauß buntgefärbten Waldlaubes und einige Tannen- und Kiefernäste, was Frau Elisa ein mißbilligendes Kopfschütteln abnötigte. Daß die Leute ihrem Herrn die farbenfreudigen Blumen in den Sarg gelegt – na schön! Sie verstanden es nicht anders, besaßen wohl auch nicht das Geld, um sich geeignete Blumen zu kaufen. Aber Swen hatte sich doch nun wirklich solche besorgen können.
Schade, daß sie nicht an Blumen gedacht; sie war doch manchmal schon zu vergeßlich!
So mußte sie sich damit begnügen, nach Swen die Handvoll Erde auf den Sarg zu werfen; und ihre Kinder taten desgleichen. Als sich jedoch die drei Fremden anschließen wollten, trat der Justizrat mit den Beamten hinzu und kam ihnen zuvor.
Und immer weiter wurden sie zurückgedrängt; denn die Gutsarbeiter, die ungeduldig zur Gruft strebten, schoben sie rücksichtslos zur Seite.
Frau Elisa war das selbstverständlich sehr unangenehm, und sie versuchte ihre Gäste damit zu trösten, daß diese unmanierlichen Leute sich bald geändert haben würden.
Swen, der in der Nähe stand, hörte es, und wieder hockte ihm das ironische Lächeln in den Mundwinkeln. In seinen Augen, die eben noch so traurig geblickt hatten, blitzte es auf. Ei, sieh da, dachte er belustigt, alles schon ganz nett geregelt.
Neben Gerswint, diesem Bild ohne Gnade, der Herzensbetörer Alf von Unitz, ganz der Schönen würdig. An Ednas Seite Enno von Unitz, ganz des älteren Bruders Ebenbild und für die reizende Edna wie geschaffen, was die Frau Mama allerdings nicht anzuerkennen schien. Und neben Bolko ein Mädchen, das vor lauter Vornehmheit kaum geradeaus sehen kann.
Schade, daß Elke noch ein Kind ist. Sie hätte sonst ihren Zukünftigen bestimmt auch an ihrer Seite.
Swen zuckte zusammen, denn jetzt wurde die Gruft geschlossen.
Onkel Leopold, lieber Onkel Leopold, warum hast du mich nicht schon früher zu dir gerufen? Ich hätte dich sehr liebgehabt, dachte er traurig.
Endlich war auch das Letzte und Schmerzlichste vorüber. Scholle um Scholle häufte sich zu einem Hügel, auf den die schönsten Kränze gelegt wurden, die davon zeugten, wieviel Verehrung und Liebe der Sonderling besessen.
Traurig und niedergedrückt kehrten die Leute nach ihren Wohnungen zurück, während die anderen in zwei Gruppen dem Schlosse zuschritten.
Swen ging mit den Herren Glang, Melch, Wieloff und dem Pfarrer, was Frau Elisa ganz in der Ordnung fand. Den Geistlichen verabschiedete sie vor dem Schloß und gab auch den anderen zu verstehen, daß sie von ihrer Gegenwart verschont zu bleiben wünschte.
Doch nur der Pfarrer allein verließ Waldwinkel, während die anderen Herren das Schloß betraten.
Swen, der in der Halle Miene machte, die Tante zu begrüßen, wurde mit einem hochmütigen Blick gemustert.
»Ich wundere mich, woher du den Mut nimmst, dieses Haus zu betreten«, sagte sie mit schneidender Schärfe. »Es ist nun mein Haus, in dem für Leute deines Schlages kein Platz ist. Hoffentlich verstehst du mich?«
»Deutlicher konntest du nicht werden, Tante Elisa«, entgegnete er gelassen. »Habe keine Angst, mein Anblick soll dich nicht mehr stören.«
Damit schritt er, von den drei Herren begleitet, davon, die Tante höchst unwillig zurücklassend.
Und diesen Unwillen bekam die Dienerschaft zu spüren. Ihre schlechte Laune besserte sich erst, als sie in die Wirtschaftsräume ging und sich Küche und Vorratskammern zeigen ließ.
Das würde hier ein anderes Wirtschaften sein als in der Stadt! Schade, daß man das Trauerjahr abwarten mußte, sonst konnte man die schönsten Gesellschaften geben. Aber daß man ab und zu einige Gäste bei sich sah, das vertrug sich ja selbst mit der tiefsten Trauer.
Um das gleich ins Werk zu setzen, wurden die Geschwister Unitz zum Bleiben aufgefordert.
*
Am nächsten Morgen saß die Familie Hellersen mit ihren Gästen am Frühstückstisch. Daß um elf Uhr die Testamentseröffnung stattfinden sollte, erregte sie durchaus nicht.
Warum auch? Sie hatten ja schon ihr reiches Erbe angetreten. Was nun noch kam, war nichts als Formsache.
Sie hatten gerade ihr Frühstück beendet, als auch schon Christian erschien und die Beteiligten ins Arbeitszimmer des Verstorbenen bat. Sehr selbstbewußt begaben sie sich dorthin und waren nun doch voller Erwartung.
In dem Zimmer war es sehr still und feierlich. Auf dem langen Tisch stand das Bild des Verstorbenen, Kerzen brannten daneben. Swen saß zwischen dem Sanitätsrat und dem Sekretär, und hinter ihren Stühlen stand die gesamte Dienerschaft. Frau Elisa und ihre Kinder nahmen die leeren Plätze ein, und aller Augen hingen voll Spannung an dem Justizrat, der am oberen Ende des Tisches saß. Er sprach klar und deutlich, und doch nahm Frau Elisa an, daß sie sich verhört haben müßte.
Swen sollte der neue Besitzer von Waldwinkel sein, Swen, der herumgestoßene Waisenknabe von einst?
Und sie und ihre Kinder…?
Jetzt zuckte sie zusammen, denn ihr Name fiel. Der Justizrat las: Ich, Leopold von Hellersen, vermache meiner Schwägerin, Frau Elisa von Hellersen, geborene Ortleff, und ihren vier Kindern ein Vermögen, das monatlich die Zinsen von zweihundertundfünfzig Mark abwirft, die der jetzige Besitzer von Waldwinkel, Baron von Hellersen, ihnen jeden Monat pünktlich zu zahlen verpflichtet ist. Ich treffe die Bestimmung, weil es gewagt wäre, meiner Schwägerin das Vermögen in die Hände zu geben. Sie hätte es ja doch in kurzer Zeit verschleudert. Ferner erhält Frau Elisa von Hellersen ein auskömmliches Deputat –, bei diesem Wort zuckte die todblasse Frau wie unter einem Hieb zusammen – und das erste Waldhaus als Eigentum. Sollte das Frau Elisa von Hellersen zu wenig erscheinen und sie behaupten, daß sie unmöglich mit dem Bettel – wie sie ja meine Unterstützungen immer nannte – auskommen könnte, so möchte ich ihr zu bedenken geben, daß es tausende Familien gibt, die mit viel weniger wirtschaften und dafür noch schwer arbeiten müssen. Die Arbeit möchte ich meiner Schwägerin und ihren Kindern übrigens warm ans Herz legen. Sie ist nutzbringend und segensreich, und sie zeigt dem Menschen erst, wozu er auf der Welt ist. Wenn sie und ihre Kinder das erst erfaßt haben, dann wird es ihnen fortan besser gehen. Außerdem stelle ich noch zwei Bedingungen. Erstens: daß meine Schwägerin das Waldhaus als ständigen Wohnsitz bezieht. Zweitens: daß sie, wenn das Vormundschaftsgericht meinen Vorschlag gutheißt und Baron von Hellersen zum Vormund bestimmt, sich nicht dagegen auflehnt. Andernfalls dürften meine Schwägerin und ihre Kinder sich als enterbt betrachten. Sie erhalten dann nur ihr Pflichtteil; alles andere fällt dem Baron von Hellersen zu.
Augenblickslang nur schwieg der Anwalt und sprach dann rasch weiter, als wolle er den fünf wie versteinert dasitzenden Menschen Zeit lassen, sich zu fassen. Er verlas die Legate:
Als erster erhielt der Sekretär Wieloff zehntausend Mark, weil er Leopold von Hellersen stets ein selbstloser und unersetzlicher Mitarbeiter gewesen war. Das Schloßpersonal, das ja durchweg länger als zehn Jahre seinem Herrn treu gedient, erhielt je fünftausend Mark. Für die Beamten und Arbeiter waren je Familie eintausend Mark ausgesetzt; die jedoch über vier Kinder hatten, erhielten zweitausend Mark. Glang und Melch wurden nicht mit Geld bedacht, weil sie beide wohlhabend waren. Für sie hatte Leopold von Hellersen Dinge bestimmt, von denen er gewußt, daß die beiden treuen Freunde sich darüber freuen würden.
Nun legte der Anwalt das Dokument fort, und sein Blick fiel auf Frau Elisa. Er konnte sich nicht helfen, die Frau tat ihm leid. Wie sie sich mühte, Haltung zu bewahren, obgleich es in ihrem Innern trostlos genug aussehen müßte; das machte ihr sobald keiner nach.
»Herr Justizrat, ich erkenne das Testament nicht an«, sprach sie nun in die beklemmende Stille hinein. »Schon die Anordnungen, die mein Schwager betreffs seiner Beisetzung getroffen, ließen mich ahnen, daß in den letzten Lebenstagen sein Sinn verworren gewesen sein muß. Dieses merkwürdige Testament bestätigt nun meine Vermutung.«
»Und die ist falsch, gnädige Frau, gänzlich falsch«, entgegnete der Anwalt freundlich. »Aber es steht in Ihrem Belieben, das Testament anzufechten.«
»Das werde ich auch. Denn daß bei der Testamentsaufsetzung etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, die Gewißheit will und werde ich mir verschaffen. Kommt, Kinder!«
Aufrecht ging sie davon, und die Kinder folgten ihr. Als man an Swen vorüberkam, verhielt Frau Elisa den Schritt. Ein Blick traf ihn, der kaum noch verachtend zu nennen war, und das Wort »Erbschleicher« las man förmlich von ihren Lippen.
Dann ging sie weiter zur Halle hin, wo die Geschwister Unitz schon auf sie warteten.
»Laßt das!« winkte sie schroff ab, als man sie gratulierend umringte. »Nicht wir sind die Erben, sondern Baron von Hellersen.«
»Aber das ist doch nicht möglich«, stammelte Alf, blaß bis in die Lippen. Sein Blick suchte die nicht weniger blasse Gerswint.
Aber was das Mädchen nun von ihm erwartete – einen Trost, ein beruhigendes Wort –, es blieb beides aus. Er stand wie erstarrt da, und die grenzenlose Enttäuschung spiegelte sich nur zu deutlich in seinem Gesicht wider.
Da wandte Gerswint sich brüsk ab. Ebenso Schwester und Bruder, denen es bei Herba und Enno nicht anders erging. Sie folgten ihrer Mutter, die langsam die sehr breite, mit schwellenden Teppichläufern belegte Treppe emporstieg. Sie hatten alle nur den einen Wunsch, den zurückbleibenden Geschwistern Unitz nicht zu verraten, wie sterbenselend ihnen zumute war.
Oben starrten sie sich hilflos an, und erst die harte Stimme der Mutter ließ sie wieder zu sich zurückfinden.
»Packt eure Sachen zusammen! Wir fahren sofort nach Hause! Nicht eine Stunde mehr möchte ich das Haus mit diesem – diesem Menschen teilen. Ich erwarte von euch, daß ihr nicht um Dinge jammert, die vorläufig nicht zu ändern sind. Beweist jetzt, daß die sorgfältige Erziehung, die ich euch habe zuteil werden lassen, an keine Unwürdigen verschwendet worden ist.«
Das war in einem Ton gesagt, den die Kinder an ihrer Mutter fürchteten und gegen den sie sich nie aufzulehnen wagten.
Also bissen sie die Zähne zusammen und packten ihre Sachen. Der Autofahrer wurde verständigt, und es war knapp eine Stunde vergangen, als Frau Elisa mit ihren Kindern das Schloß verließ. Den Baron, der vor dem Portal zu ihnen trat, schienen sie nicht zu sehen. Ohne Gruß fuhren sie davon.
*
Eine halbe Stunde später verabschiedete Hellersen die Geschwister Unitz sehr kühl und förmlich. Zu Herzlichkeit hatte man ja auch keinen Anlaß, da man sich fremd war.
Swen sah dem auffallend grünen Wagen nach, bis er verschwunden war. Dann ging er langsam ins Schloß zurück.
Jetzt erst merkte er, wie müde und abgespannt er war. Die letzten Tage waren ja auch ausgefüllt gewesen mit Besorgungen und Erregungen aller Art, so daß er noch keinen Augenblick hatte zur Ruhe kommen können. Mit einem Gemisch von Wehmut und Selbstverspottung mußte er feststellen, daß es gar nicht so einfach war, über Nacht ein reicher Mann zu werden.
Vor allen Dingen mußte er jetzt einige Stunden ruhen. Daher bat er die Herren Glang, Melch und Wieloff, die in der Halle auf ihn warteten, ihn zu entschuldigen. Sie möchten es sich im Arbeitszimmer des Onkels, das ja nun das seine war, bequem machen. Er selbst wolle sich später zu ihnen gesellen.
Christian erhielt noch den Auftrag, die Herren gut zu versorgen; dann ging der Baron in die Räume, die er seit Tagen bewohnte. Die anderen Herren suchten das bezeichnete Zimmer auf und ließen sich in die wunderbar bequemen Sessel sinken, die am Kamin um einen Rauchtisch gruppiert standen. Christian brachte Wein, Zigarren und Zigaretten, bat die Herren, sich zu melden, falls sie weitere Wünsche hätten, und zog sich dann in seiner lautlosen Art zurück.
»So, meine Lieben, nun wollen wir zuerst einmal Prost sagen und uns dann so langsam wieder zu uns selbst zurückfinden; denn der letzten Stunden Qual war groß«, sagte der Notar. »Das war ja das reinste Todesurteil, das ich der Frau Elisa nebst Anhang verlesen mußte. Hätten sie gewettert und getobt, dann hätte man sich das voller Schadenfreude mit ansehen können. Aber so – na, schön ist anders.«
»Das sagst du, der du den Inhalt des Testaments doch schon kanntest?« gab der Arzt zurück und tat einen tiefen Zug aus dem Glase. »Aber was sollen wir anderen sagen, die uns das unerwartete Testament sozusagen aus allen Wolken riß?«
»Alle Achtung vor der Selbstdisziplin dieser Frau! So jäh und unerwartet von ihrem hohen Roß gestürzt zu werden und dennoch die Würde nicht zu verlieren, das muß man anerkennen.
Auch der Baron hat mir leidgetan. Den hat sein Erbe bestimmt nicht so gefreut, wie es eigentlich der Fall sein sollte.«
»Das hat es auch nicht«, bekräftigte Glang. »Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, weiß Gott nicht. Es ist ein außerordentliches Päckchen, das unser Freund Leopold dem armen Kerl nebst dem reichen Erbe aufgebuckelt hat. Ihr wißt nämlich noch nicht alles, was ich weiß.«
»Kann ich mir denken, du Rechtsverdreher!« schmunzelte Melch behaglich. »Dein Amt ist eben die Geheimniskrämerei. Läßt uns der Mensch bei dem unerschütterlichen Glauben, daß Frau Elisa nebst Anhang die Erben sind, und lächelt noch schadenfroh dazu, als uns nach der Testamentseröffnung die Überraschung fast umwirft.«
»Was kann ich dafür, daß ihr eine so lange Leitung habt«, wehrte Glang sich lächelnd gegen den Vorwurf. »Daß der Baron hier so plötzlich auftauchte, das muß euch doch schon zu denken gegeben haben.«
»Hat es auch«, behauptete Melch. »Aber da wir keine Hellseher sind, konnten wir den Zusammenhang ja nicht ahnen. Denn seltsam ist und bleibt die Sache doch auf alle Fälle; das wirst selbst du Neunmalkluger zugeben müssen.
Taucht da plötzlich so ein Mann auf, wie ihn unser alter Herrgott nur in seiner besten Laune schafft, und von dem man bisher kein Sterbenswörtchen gehört, obgleich man hier seit mehr als dreißig Jahren ein und aus geht – und schnappt mir nichts, dir nichts der Frau Elisa von Hellersen das reiche Erbe vor der Nase weg. Wird nicht nur unumschränkter Herr über die prachtvolle Herrschaft Waldwinkel samt Nebengütern, sondern erbt auch noch eine Summe Geld dazu, bei deren Zahl man sich verschluckt, wenn man sie aussprechen will.
Ist das merkwürdig oder nicht? Zumal dieser Herr dem Erblasser unbekannt war.«
»Nimmst du wenigstens an«, entgegnete der Justizrat geheimnisvoll und weidete sich augenblickslang an den verblüfften Gesichtern Melchs und Wieloffs. »Und wenn ich euch nun erklärte, daß Leopold den Baron schon seit seinem zwölften Lebensjahr gekannt hat?«
»Eine Frage habe ich, die du gewiß auch beantworten kannst: Warum nahm Leopold, der doch immer so einsam war, den Knaben nicht ganz zu sich?« wollte Melch wissen.
»Weil der kleine Swen schon damals das verjüngte Ebenbild seines Vaters war, den Leopold ebenso glühend haßte, wie er Swens Mutter geliebt hat.«
»Na, höre einmal, die Sache wird ja immer verzwickter.«
»Durchaus nicht, sie ist vielmehr unendlich einfach und unendlich traurig. Leopold war schon ein alternder Mann, als er Frau Gertraude von Hellersen durch Zufall kennenlernte. Ihn packte die Liebe um so gewaltiger, da sie ihn bisher gnädigst verschont hatte. Sich dieser wirklich bezaubernden Frau zu nähern, war natürlich unmöglich: Erstens mal wegen seiner traurigen Gestalt, zweitens weil die Heißbegehrte an einen Mann gebunden war, den sie über alles liebte. Und diesen Mann, der die Frau sein eigen nannte, nach der unser armer Freund sich völlig verzehrte, haßte und beneidete er glühend. Leopold litt damals entsetzlich, weil ihn die unglückselige Liebe wie eine Krankheit befallen hatte. Ich glaube bestimmt, daß Leopold hauptsächlich deshalb an dem Schicksal des kleinen Swen so regen Anteil nahm, weil er der Sohn der schmerzlich geliebten Frau war. Hätte er ihr geglichen, wäre der Knabe wohl schon damals nach Waldwinkel gekommen. Da er aber ganz seines Vaters Ebenbild war, hätte Leopold es nicht ertragen können, ihn ständig um sich zu haben; denn er kämpfte gegen den Haß und Neid, der ja einen ganz Unschuldigen traf, hart an, da sich beides mit seiner sonst hochherzigen Gesinnung nicht vertragen wollte. Und dann wollte er ja auch vergessen, was ihm nimmermehr gelungen wäre, hätte er den Knaben ständig vor Augen gehabt. Aber sein Erbe sollte Swen werden, diese Tatsache stand für ihn unabänderlich fest. Und je prachtvoller sich der Knabe entwickelte, um so fester wurde Leopolds Entschluß. Jede Kleinigkeit, die Swen betraf, nahm er wichtig, und der Gedanke, den nun Erwachsenen endlich zu sich zu rufen, nahm immer festere Formen an. Wie ich vorhin schon erwähnte, war Swen im Hause seiner Verwandten ein richtiges ›Mädchen für alles‹. Er ertrug auch stets alles mit bewundernswerter Geduld, bis ihm die doch einmal riß, und er ging von Hirschhufen fort. Das jedoch verbitterte die Verwandten maßlos; denn der Baron war ein Mensch, den man nicht ungestraft in der Wirtschaft missen konnte. Er war ein äußerst tüchtiger Landwirt, der Hirschhufen hochgehalten hatte. Tatsächlich ging es nach seinem Weggang auch schnell bergab. Und als gar noch nach knapp einem Jahr der alte Francke starb und ein Oberinspektor verpflichtet wurde, der sich die zügellose Wirtschaft des Gutes zunutze machte und gehörig in seine Tasche wirtschaftete, da war der Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten. Nun war wieder ein Fall eingetreten, wo der junge Baron seine Tüchtigkeit unter Beweis stellen konnte. Leopold war gespannt, wie er sich in fremden Diensten behaupten würde. Und das war wohl auch der Grund, weshalb er den Gedanken, ihn nach Waldwinkel zu rufen, wieder aufgab. Später kam dann allerlei dazwischen. Der Baron heiratete, ein Kindchen stellte sich ein, die junge Frau starb. Das waren alles Ereignisse, die unsern Freund abschreckten, den Neffen zu sich kommen zu lassen. Und als er es dann endlich tat, da hatte es wieder der Tod so eilig, daß Leopold dem Baron nicht einmal alles mündlich sagen konnte, was ihm so sehr am Herzen lag. Wäre er nicht so klug gewesen, in einem langen Brief schon vorher niederzuschreiben, was er von seinem Neffen wünschte und erwartete, so wäre dem Baron die unverhoffte Erbschaft lebenslang ein Rätsel geblieben.«
Nach diesen Worten des Justizrates war es eine Weile beklemmend still. Die Blicke der drei Männer hingen an dem Bild des Verstorbenen, der trotz seines Reichtums so unglücklich gewesen war wie selten ein Mensch, der neben der Verspottung, die seinem abschreckenden Aussehen galt, auch noch die Qualen einer aussichtslosen Liebe hatte auskosten müssen bis zum letzten bitteren Tropfen.
Schweigend saßen die Herren beieinander, jeder mit seinen Gedanken um den Toten beschäftigt.
Erst ein Winseln an der Tür schreckte sie aus ihren traurigen Grübeleien auf. Und als der Sekretär hineilte, um die Tür zu öffnen, sprang der jaulende Harras ihn so heftig an, daß er Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten.
»Zum Kuckuck, der schwarze Racker ist ganz einfach vom Teufel besessen!« schalt der Oberförster, der den Hund an der Leine hielt, ärgerlich. »Was wir mit diesem Gesellen in den vier Tagen zu Hause ausgestanden haben, das läßt sich nicht beschreiben. Er hat uns fast die ganze Bude umgeworfen.«
»Das will ich glauben«, lächelte der Sekretär und streichelte den Hund, der an der Erde schnupperte und jämmerlich winselte.
Sie wußten es ja alle, der arme Geselle suchte seinen geliebten Herrn, und es wurde ihnen allen weh ums Herz. Der Oberförster, ein kerniger, urgemütlicher Graubart, schneuzte sich gewaltig, und dem Sekretär schossen die Tränen in die Augen.
»Ich glaube, Sie können ihn ruhig von der Leine lassen, Herr Oberförster«, sagte er leise. »Er trägt ja einen Maulkorb und kann daher kaum ernstlichen Schaden anrichten.«
»Aber die Kinder kann er umwerfen«, entgegnete der alte Herr. Jetzt erst bemerkte Wieloff die vielen Menschen, die in der Tür standen. Vorn die Beamten und hinten die Arbeiter der Herrschaft Waldwinkel.
»Die Leute wollen durchaus den Herrn Baron sprechen«, bemerkte der Oberförster verlegen. »Mit keinen Vernunftsgründen ließen sie sich zurückhalten.«
Wieloff zögerte noch ein wenig, doch dann erklärte er, den Baron holen zu wollen, der jedoch nach einigen Minuten von selbst erschien. Der Hund erkannte ihn sofort wieder, strebte zu ihm hin, leckte ihm die Hände und ließ sich dann mit einem langen Seufzer ruhig zu seinen Füßen nieder. Das war ein so erschütterndes Bild, daß kaum ein Auge trocken blieb.
Hellersen streichelte zärtlich den Kopf des Hundes, dann ging sein ernster Blick zu den Menschen hin.
»Sie wollten mich sprechen?«
Zuerst herrschte betretenes Schweigen, doch dann trat der Kämmerer vor, die Mütze in der Hand.
»Herr Baron, wir sind gekommen, um Ihnen zu gratulieren und zu sagen, wie froh wir sind, daß nicht die anderen die Erben sind, daß wir dem Herrn Baron Treue auf Leben und Tod geloben«, stotterte er, und da glitt ein weiches Lächeln über die abgespannten Züge ihres Herrn.
»Ich danke Ihnen und den andern allen«, sagte er sehr herzlich. »Und euer Vertrauen, das ihr mir, dem Fremden, entgegenbringt, will ich hoch und heilig halten. Ihr habt mit dem Tode eures geliebten Herrn, der allzeit wie ein Vater für euch gesorgt hat, unendlich viel verloren, ich weiß es. Und daher will ich versuchen, euch euren Herren ein wenig zu ersetzen.«
Dann kamen die Beamten an die Reihe, die ebenso wie die Arbeiter unaufgefordert Treue gelobten, und für alle hatte der Baron ein warmes, herzliches Wort. Auch sie gingen zufrieden davon, und der Baron blieb mit den drei Herren, die im Zimmer auf ihn gewartet hatten, allein zurück.
Sein Blick fiel auf den Sekretär, der seltsam bedrückt aussah. Er trat zu ihm und streckte ihm die Hand entgegen.
»Sprechen Sie nicht, Herr Wieloff. Ich weiß, es fällt Ihnen schwer«, sagte der Baron sehr herzlich. »Ich weiß aus dem hinterlassenen Brief meines Onkels, was Sie ihm gewesen sind, und dasselbe sollten Sie mir werden. Er hat mir außerdem noch warm ans Herz gelegt, Sie gut zu behandeln. Und der Wunsch eines Toten soll dem Menschen heilig sein«, setzte er mit leichtem Lächeln hinzu.
Der Sekretär nahm die feste Männerhand, die sich ihm da so herzlich entgegenstreckte. Die Blicke der beiden Männer ruhten ineinander.
Da wußte Swen, daß er genau wie sein Onkel mit diesem Menschen einen Getreuen auf Leben und Tod gewonnen hatte.
*
»Papi, du bist ein böser Mann!« behauptete die kleine Ilsetraut, die in trotziger Haltung vor dem Vater stand, kurz und bündig. »Du hast deine Ilsetraut so lange allein gelassen, und nun mag sie dich nicht mehr«, erklärte sie, während in ihren Augen dicke Tränen funkelten und sich das Mündchen verdächtig nach allen Seiten hin verzog.
»Hallo, mein kriegerisches kleines Mädchen, nur immer sachte!« lachte der Baron belustigt. »Du weißt doch, daß ein kleiner Trotzkopf nie etwas mitgebracht bekommt?«
»Will auch gar nichts haben!« trotzte sie weiter. »Und – und du hast ja auch überhaupt nichts«, setzte sie vorsichtig hinzu.
»Das kommt ganz auf einen Versuch an«, neckte der Vater. »Wollen wir mal in meinem Koffer nachsehen?«
»Ach, was wird da schon sein?« fragte sie immer noch wegwerfend, aber doch schon ein klein wenig unsicher. »Schokolade?«
»Viel was Schöneres.«
»Dann Bonbons, die immer knistern, wenn man reinbeißt?« steigerte sich ihre Erwartung.
»Nein, noch Schöneres.«
Einen Augenblick überlegte sie noch, kämpfte auch noch mit dem Trotz, aber dann war die Neugierde doch größer.
»Weißt du was, Papi, am besten ist es, wir schauen mal nach«, schlug sie vor und schob ihr Patschchen in die Hand des lachenden Vaters.
»Halt, halt, so leicht ist es denn doch nicht. Zuerst möchte ich eine Hand zum Willkomm, dann einen Kuß.«
Das war nun wieder etwas, wozu sie sich trotz allem noch nicht entschließen konnte. Es hatte das Kind zu sehr gekränkt, daß der Vater es so lange allein gelassen.
Aber das geheimnisvolle Mitbringsel im Koffer – das war es, was immer stärker zog.
Einen kurzen Kampf noch mit dem vertrotzten Herzchen, ein nicht endenwollender, schier herzzerbrechender Seufzer, und der Papi wurde gar herzlich umarmt und geküßt. Dann eilte man nach dem Zimmer, wo der Koffer immer noch gepackt dastand.
Einige Minuten mußte Ilsetraut noch vor Ungeduld zappeln, aber dann hielt sie ein Puppenkind im Arm ganz genauso, wie sie es sich immer so brennend gewünscht hatte. Sie strahlte vor Freude, und der Papi wurde vor Dankbarkeit fast erdrückt.
Dann erst setzte sie sich auf den Fußboden und beschaute das neueste Puppenkind recht gründlich von allen Seiten.
Der Vater stand dabei und lachte.
»Na, du kleiner Wildfang, drehe deinem neuesten Opfer nur nicht gleich am ersten Tage den Hals um!« rief er lachend, während er das Töchterlein samt der Puppe auf den Arm hob. »Ich trage dich nach deinem Zimmer hinüber; ich habe mit Barbe zu sprechen. Wenn du allein hierbleibst, machst du mir zuviel Dummheiten«, erwog er aus allerlei bösen Erfahrungen heraus.
Ilsetraut ließ sich auch willig hinwegtragen, sie war viel zu beschäftigt, um etwas dagegen einzuwenden.
Und während sie in ihrem Zimmer mit der Puppe spielte, erfuhr Barbe, was sich in den letzten Tagen ereignet hatte. Die Alte, die ihren Herrn Baron förmlich vergötterte, lachte und weinte in einem Atemzug vor Freude über diese glänzende Schicksalswende.
»Aber was wird Herr Hungold dazu sagen?« war ihr erster Gedanke. »Er wird den Herrn Baron doch sicherlich nicht loslassen wollen.«
»Hör mal, Barbe, nun werde ich zuerst einmal zu Herrn Hungold gehen, um ihn von meiner Erbschaft in Kenntnis zu setzen. Von ihm wird es abhängen, wann wir von hier wegkommen. Wenn er es nämlich wünscht, muß ich die vorgeschriebene Zeit noch in seinen Diensten bleiben. Sollte er mich jedoch gleich freigeben, dann siedeln wir sobald wie möglich nach Waldwinkel über.«
Er ging also in das Herrenhaus hinüber, wo er seinen Herrn in nicht gerade rosiger Laune fand.
»Kommen Sie überhaupt mal wieder?« empfing Herr Hungold den Baron in seiner unwirschen Art, die dieser jedoch nie ernst nahm, da er wußte, wie wenig schlimm sie gemeint war.
»Fünf Tage zum Begräbnis eines alten Onkels, ist das nicht ein bißchen lange, mein lieber Hellersen?«
»Haben Sie mein Telegramm nicht erhalten, Herr Hungold?« fragte Swen dagegen.
»Natürlich habe ich das. Aber nun nehmen Sie mal Platz und erzählen Sie!«
Das war nun wieder der alte, gemütliche Papa Hungold. Der Baron kam seinem Wunsch nach, während sein Chef ihm die Zigarrenkiste zuschob.
»Bedienen Sie sich bitte, Hellersen! Und dann beichten Sie mal! Was ist mit Ihrem Onkel? Hat er Ihnen wenigstens einen netten Batzen vermacht?«
»Das will ich meinen«, lächelte Swen. »Seine ganze Herrschaft und noch etwas dazu.«
»Das wird wohl nicht gerade viel gewesen sein, was?«
»Wie man’s nimmt.« Dem Baron fing die Sache an, Spaß zu machen. »Wenn eine Herrschaft wie Waldwinkel – und manches andere noch dazu – nicht viel ist, das ist dann eben Ansichtssache.«
»Was, Waldwinkel?« fragte Herr Hungold, als hörte er nicht recht. »Etwa dieses Waldwinkel, das diesem – diesem Sonderling gehörte?«
»Eben das, Herr Hungold. Wissen Sie denn nicht, daß ich von seiner Beisetzung komme?«
»Nein, eigentlich nicht. Ich wußte nur, daß ein Onkel von Ihnen gestorben ist. Daß es gleich so ein Krösus wie der Waldwinkler Hellersen sein würde, daran habe ich wirklich nicht gedacht. Aber waren nicht die Verwandten, die früher auf Hirschhufen saßen, als Erben ausersehen?«
»Das haben sie irrtümlich angenommen, Herr Hungold. Tatsache jedoch ist, daß mein Onkel mich schon lange als seinen Erben bestimmt hatte.«
»Also hat der kluge Onkel noch kurz vor Toresschluß eingesehen, daß es doch besser ist, Ihnen statt den Verschwendern seinen Prachtbesitz anzuvertrauen. Werden saure Gesichter geschnitten haben, die andern, wie?
Na, jedenfalls gratuliere ich Ihnen zu diesem Riesendusel, wenn ich mich von Herzen auch nicht darüber mitfreuen kann. Denn jetzt muß ich Sie ja ziehen lassen.«
»Das allerdings ja, Herr Hungold. Aber es wird ja nicht schwer ein Ersatz für mich zu finden sein.«
»Ersatz – höre immer Ersatz«, brummelte der alte Herr vor sich hin. Er sah den Baron an, und in seinen guten Augen stand etwas wie wehe Trauer. »Ersatz für Sie dürfte schwer zu finden sein, mein Lieber. Können Sie mir wenigstens den sogenannten Ersatz für Sie vorschlagen?«
»Ich dachte an Herrn Brall. Er ist tüchtig und zuverlässig.«
»Also dann ziehen Sie in Gottes Namen, mein lieber Baron«, sagte der alte Herr dann sehr herzlich. »Und wenn Ihre reiche Erbschaft Ihnen nicht in den Kopf gestiegen ist, so daß Sie uns, die wir ja nun alle arme Schlucker gegen Sie sind, noch für voll ansehen, so werden wir uns freuen, wenn Sie uns besuchen wollten. Wann wollen Sie in Ihre neue Heimat ziehen?«
»Das hängt ganz von Ihnen ab, Herr Hungold. Wenn Sie mich sofort entlassen…«
»Entlassen? Wenn ich so was schon höre!« knurrte der alte Herr unwirsch. »Dieser Mensch, der uns alle hier ringsum in die Tasche stecken kann, spricht von ›entlassen‹. Ihnen scheint wirklich noch nicht bewußt zu sein, was für eine Persönlichkeit Sie jetzt sind?«
»Kann schon sein, Herr Hungold«, gab Swen lachend zurück. »Ich weiß nur, daß ich mit der Erbschaft auch eine Riesenverantwortung übernommen habe. Mit dem sorglosen Leben, das ich hier geführt habe, wird es nun wohl vorbei sein. Ich habe mich bei Ihnen wirklich wohl gefühlt, Herr Hungold«, schloß er herzlich.
»Wenigstens ein Trost. Also, dann reisen Sie mit Vergnügen, Baron. Der Brall kann ja jeden Tag an Ihre Stelle geschoben werden. Und einen zweiten Inspektor finde ich mit Handkuß.«
»Vielen Dank, Herr Hungold – für alles.« Hellersen verneigte sich. »Wenn Sie und Ihre werten Angehörigen mich mal in Waldwinkel besuchen wollten, würde ich mich sehr freuen. Wollen Sie mich bitte den Damen empfehlen!« bat Hellersen und erhob sich. »Und Ihnen, Herr Hungold, möchte ich nochmals danken.«
»Da ist nichts zu danken«, wehrte er unwirsch ab. »Wir sehen uns ja wohl noch, bevor Sie Lorren verlassen? Packen Sie nur schon heute Ihre Sachen zusammen! Wenn Sie schon von hier fortgehen, dann schnell und schmerzlos.«
Die Herren schüttelten sich die Hände – und der Baron ging erleichterten Herzens davon. Er hatte sich vor dieser Unterredung mehr gefürchtet, als er sich selbst eingestehen wollte.
In Waldwinkel hatte man alles zum Einzug des neuen Herrn festlich gestaltet. Der Baron konnte mit Rührung feststellen, wie sehr die Beamten und Arbeiter ihm jetzt schon zugetan waren. Mit solchen Leuten zu arbeiten würde natürlich eine Freude sein.
*
»Wie ich sehe, Mama, hast du nichts erreichen können«, fragte Gerswint ihre Mutter, die von einem Gang zum Rechtsanwalt zurückkehrte. Frau Elisa schüttelte den Kopf und ließ sich müde in einen Sessel sinken.
Doch nur einen Augenblick war sie mutlos, dann straffte sich ihre Gestalt, vielleicht noch etwas selbstbewußter als sonst. Ihr Blick streifte ihre Kinder, die sie erwartungsvoll ansahen.
»Nein, ich habe nichts erreichen können«, sagte sie hart. »Vom rechtlichen Standpunkt aus ist das Testament unanfechtbar; das ist mir heute restlos klargeworden. Man behauptet, daß Swen den Onkel kurz vor dessen Tode kennengelernt hat. Der Arzt, Sanitätsrat Melch, hat geschworen, daß Leopold von Hellersen bis zu seinem Tode bei klarem Verstand gewesen ist. Man gab mir noch den guten Rat, nichts weiter in der Sache zu unternehmen, weil ich nur Geld ausgeben und doch nichts erreichen würde. Und das glaube ich nämlich auch; Swen hat alles bis ins kleinste ausgetüftelt.«
»Also müssen wir wirklich in das öde Waldhaus ziehen?«
»Das müssen wir, Gerswint, wenn wir nicht verhungern wollen.«
»Und die Summe, die auf deinen Antrag hin für mein Studium freigegeben werden sollte?« fragte Bolko.
»Ist abgelehnt, mein Sohn. Du kannst also Schuhe putzen gehen, wenn du Lust dazu hast, während der Herr Baron…«
Sie lachte auf. Es war ein bitteres Lachen, das ihren Kindern durch und durch ging.
»Hat Alf etwas von sich hören lassen?« fragte sie dann kurz. Und als Gerswint verneinte, nickte sie vor sich hin.
»Ja, ja, Kinder, das ist nun das Ende. Begrabt nur all euer Wünschen und Hoffen, auf etwas mehr oder weniger kommt es wirklich nicht mehr an.«
Sie fuhr herum und starrte Edna an, die den Kopf auf die verschränkten Arme warf und bitterlich weinte. Sie wollte das Mädchen schroff anfahren, seufzte jedoch nur tief auf und verließ das Zimmer.
In den nächsten Tagen gab es viel Arbeit in der eleganten Stadtwohnung. Der ganze Haushalt mußte aufgelöst werden, was gewiß keine Kleinigkeit war. Um so mehr noch, da Frau Elisa sich nie um etwas gekümmert, sondern alles den Dienstboten überlassen hatte. Die überflüssigen Möbel mußten verkauft werden. Da es sich durchweg um kostbare Stücke handelte, brachten sie noch eine Summe, die Frau Elisa als Notgroschen zurücklegte.
Müde und erschöpft von der ungewohnten Arbeit von dem Wirrwarr, in dem sie seit Tagen gelebt, verdrießlich und verbittert, verließen sie an einem unfreundlichen Regentage in einem Mietsauto Königsberg, um nach dem Waldhause zu fahren. Den Wagen, in dem sie zur Beerdigung Onkel Leopolds gefahren waren, hatten sie längst abgegeben, da sie ein so teures Gefährt ja niemals bezahlen konnten.
Es war ein richtiges »Dreckwetter«, als man der neuen Heimat zufuhr. Und die Worte: »Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter, grau wie der Himmel liegt vor mir die Welt«, haben selten so gepaßt wie hier. Es herrschte eine drückende Trauerstimmung im Wagen, so sehr sich auch jeder zusammennahm, um dem andern seine wahre Gemütsstimmung zu verbergen.
Aus dem behaglichen, abwechslungsreichen Stadtleben hinaus in die Öde und Einsamkeit eines primitiven Waldhauses, knappste Geldmittel zur Verfügung, die nicht weiter reichten als dazu, das Leben zu fristen. Das war das Gespenst, das vom Morgen bis zum Abend bei ihnen saß, sie angrinste und ihnen alle Lebensfreude nahm. Und selbst der kleinen Elke, die mit ihren zehn Jahren diese tief einschneidende Schicksalswende noch nicht in vollem Umfange erfassen konnte, war erbärmlich elend zumute.
Hätte die Sonne geschienen und alles ringsum mit ihrem goldenen Schimmer überstrahlt, so wäre ihnen die neue Heimat nicht so trostlos erschienen wie jetzt, da sie im Regenwetter grau in grau vor ihnen lag.
Das Haus machte mit seinen leeren, düsteren Fenstern einen wenig einladenden Eindruck. Die Bäume des Waldes waren so dicht in Nebel gehüllt, daß sie kaum erkennbar wie unheimliche Schatten zu den neuen Bewohnern hinüberdrohten.
Schließlich goß es sogar in Strömen, so daß die niedergeschlagene Familie Hellersen sich kaum dazu entschließen konnte, das Auto zu verlassen. Endlich flüchteten sie in den kleinen Flur, wo sie zagend und frierend dicht aneinandergedrängt standen.
Stunde um Stunde verbrachten sie teils im zugigen Flur, teils in den leeren Stuben und warteten auf das Möbelauto, das schon längst hätte da sein müssen. Müde, elend und verdrossen standen sie herum und froren ganz jämmerlich. Später setzten sich Edna und Elke auf die Treppe, die aus dem Flur zum oberen Stockwerk führte, und hielten sich umschlungen, während Bolko wahre Indianertänze aufführte, um sich zu erwärmen.
Endlich kam das riesige Auto und mit ihm auch das Stubenmädchen Anna, das drei Jahre bei Frau Elisa in Diensten gestanden hatte. Sie hatte sich bereit erklärt, das Haus einrichten zu helfen. Bleiben jedoch wollte sie nicht – dort, wo sich die Füchse gute Nacht sagten? Um keinen Preis der Welt.
Als sie nun das Häuslein sah, schlug sie buchstäblich die Hände überm Kopf zusammen.
»Um Himmels willen, hier können die Herrschaften doch unmöglich hausen!« rief sie entsetzt. »Das ist ja die reinste Verbannung. Eine Woche halte ich es zur Not hier aus, aber dann auf schnellstem Wege in die Stadt zurück.«
Und so kam es denn, daß das einfache Mädchen Anna von seiner Herrschaft glühend beneidet wurde. Sie konnte in die Stadt zurückkehren. Die Glückliche!
Sie sahen nicht, wie nett das kleine Haus anzusehen war, wie es vor Sauberkeit nur so blinkte; der Baron hatte dafür gesorgt, daß es vom Keller bis zum Boden neu hergerichtet wurde. Sie sahen nur die Einsamkeit des Waldes.
Und das ließ sie immer trostloser werden. Es war ihnen gleichgültig, wie die Möbel verteilt wurden. Sie ließen Anna ganz nach Wunsch schalten und walten, und das gewandte Mädel, dem diese Beschäftigung Freude machte, richtete alles nett ein, wie die Hausfrau es gewiß nicht besser gekonnt hätte.
In einigen Stunden war das Möbelauto leer. Es rollte zur Stadt zurück, von den sehnsüchtigen Blicken der Zurückgebliebenen verfolgt. Anna tröstete sich damit, daß sie bald von hier wegkommen würde, und wirbelte nur so herum, um so schnell wie möglich mit dem Einrichten des Hauses fertig zu werden.
*
Baron von Hellersen hob den Kopf von seiner Arbeit, während ein Lächeln über sein hartes Antlitz huschte; denn in der Halle hörte er das herzige Lachen seiner kleinen Tochter, das zugleich mit dem gutmütigen Bellen Harras’ erklang. Selbst dieser rauhe Geselle war von dem kleinen Sonnenstrahl schon bezwungen worden. Sämtliche Bewohner des Schlosses hatte sie mit ihrer Lieblichkeit sofort gewonnen.
Zuerst hatten die weiten, hohen Räume des Schlosses die Kleine eingeschüchtert. Allein schon nach kurzer Zeit tollte sie genau darin herum, wie sie es in dem kleinen Hause in Lorren getan hatte. Ob es die Gemächer des Vaters waren oder ihr eigenes kleines Reich oder Barbes danebenliegendes Zimmer, der kleine Wildfang machte darin keinen Unterschied.
Und der Vater ließ seinem Kinde den Willen, soweit es nur anging. Sie mußte ja auf das Beste verzichten, was es im Kinderleben gibt: auf die Mutterliebe. Da sollte seine Kleine wenigstens in jeder andern Beziehung eine sonnige Kindheit haben. Der Anfang dazu war ihm leicht gemacht worden; er hatte hier alles in peinlichster Ordnung vorgefunden, so daß ihm das Einleben und Einfühlen in seinen neuen Wirkungskreis nicht schwergefallen war. Ob man sich da in Waldwinkel umsah oder nach Hirschhufen, den Nebengütern und den Vorwerken kam, überall herrschte strengste Ordnung, die nur eine straffe Hand und ein scharfes Auge geschaffen haben konnten. Er brauchte somit nur sein Besitztum im Sinne seines Onkels weiterzuführen, wenn er sich seines Erbes würdig erweisen wollte.
Eine starke Stütze war ihm Wieloff, der nicht nur ein vorbildlicher Sekretär, sondern auch ein ausgezeichneter Landwirt war. Der junge Mann leistete Unglaubliches und schien nie eine Ermüdung zu kennen.
Schade, daß er so ernst und unzugänglich war. Aber das war wohl seine Art, an die man sich gewöhnen mußte.
»Dürfte ich den Herrn Baron darauf aufmerksam machen, daß heute die neuen Bewohner des Waldhauses angekommen sind?« sagte der Sekretär höflich, und sein Herr schaute überrascht auf.
»Richtig, das habe ich ja ganz vergessen! Sicher sind sie schon am Vormittag gekommen; jetzt dunkelt es bereits. Die werden ja einen schönen Begriff von meiner Gastfreundschaft bekommen haben! Also will ich doch noch mal schnell hinübergehen. Kommen Sie mit, Roger?«
»Wenn der Herr Baron es wünschen.«
»Herrgott, ich wünsche es, Sie unzugänglicher Mensch«, sagte Hellersen unmutig. »Aber sofern man Ihnen selber nicht alles in eine Befehlsform faßt…«
»So schlimm ist es nun doch wohl nicht, Herr Baron«, lächelte Wieloff, während er an der Seite seines Herrn über den Gutshof durch die Waldwiese dem kleinen Haus zuschritt.
»Da ist ja schon das Haus. Sieht eigentlich recht schmuck aus. Und die Lage ist geradezu idyllisch. Schade, daß das andere Waldhaus leerstehen muß. Wie viele würden glücklich sein, ein solches Heim zu haben«, sagte der Baron.
»Wenn mich nicht alles täuscht, steht dort Frau von Hellersen«, sagte Wieloff.
»Ja, das ist sie«, bestätigte Swen und schritt nun schneller aus, um die Tante, die unter der Haustür stand, zu begrüßen. Hinter ihr wurden auch die Mädchen und Bolko sichtbar.
»Willkommen in dem neuen Heim, Tante Elisa«, begrüßte der Baron sie und machte Miene, ihr die Hand entgegenzustrecken. Doch sie wich förmlich zurück und sah den Neffen abweisend an.
In nicht weniger eisiger Ablehnung verharrten auch die andern. Selbst die Augen der kleinen Elke sprühten dem Vetter nur so vor Abneigung entgegen.
»Es ist heute wohl noch recht ungemütlich in dem kleinen Haus«, sprach er weiter, ohne die feindselige Haltung irgendwie zu beachten. »Daher möchte ich euch bitten, so lange im Schloß zu wohnen, bis hier alles eingerichtet ist.«
»Danke, bemühe dich nicht«, entgegnete Frau Elisa hochmütig. »Wir würden dir sehr verbunden sein, wenn du dich überhaupt nicht um unsere Angelegenheiten kümmern und uns mit deiner Person verschonen wolltest.«
»Das ist sehr deutlich«, gab Swen spöttisch zurück. »Es liegt auch gewiß nicht in meiner Absicht, mich in eure Angelegenheiten zu mischen, sofern sie nicht mein Amt als Ednas und Elkes Vormund betreffen.«
»Dieses Amt brauchst du gewiß nicht ernst zu nehmen, das ist in meinen Augen nichts weiter als eine lächerliche Wichtigtuerei«, erklärte sie wegwerfend. »Ein dreißigjähriger Mann wird sich doch kaum im Ernst anmaßen wollen, ein fast zwanzigjähriges Mädchen zu erziehen.«
»Darüber wollen wir nicht streiten, Tante Elisa; wir wollen abwarten. Du bist eben ein Mensch, der hartnäckig auf seinem Willen besteht; also werde durch Erfahrung klug. Und fühle dich in deinem neuen Heim so wohl, wie du es kannst; ich werde dir meine Gegenwart nie ohne triftigen Grund aufdrängen.«
Eine leichte Verbeugung, dann ging er mit dem Sekretär davon.
»Das ist doch einfach unerhört, was Sie sich da bieten lassen müssen, Herr Baron!« sagte der Sekretär, als sie außer Hörweite waren, empört. Doch Hellersen zuckte nur gleichmütig die Schultern.
»Lieber Wieloff, Sie kennen eben meine Verwandtschaft nicht. Sonst würden Sie sich nicht so entrüsten.«
*
Der Herbst verging, der Winter kam. Es war an einem unangenehmen kalten Januartage. Es regnete und schneite durcheinander, und außerdem pfiff ein scharfer Nordwind.
Swen von Hellersen fuhr in seinem schweren Wagen der Stadt zu. Und da er sich in dem geheizten Raum sehr behaglich fühlte, so erbarmten ihn um so mehr die beiden Mädchen, die sich auf der Landstraße mühsam durch das unfreundliche Wetter vorwärtsrangen. Als er sie erreicht hatte, ließ er halten, stieg aus – und stand Edna und Elke gegenüber.
»Was wollt ihr um sieben Uhr morgens bei diesen Hundewetter auf der Landstraße?« fragte er verständnislos. Edna sah ihn spöttisch an.
»Zur Kleinbahn, um zur Schule zu fahren«, antwortete sie abweisend und wollte Elke mit sich ziehen, als das Kind von einem heiseren Husten förmlich hin und her geworfen wurde.
»Ja, was hat die Kleine denn?« fragte Swen erschrocken.
»Den Husten, wie du hörst und siehst«, gab Edna schnippisch zurück, während sie die Schultern der Schwester umfaßte.
»Ich will dir sagen, daß es ein unverantwortlicher Leichtsinn ist, das kranke Kind diesem schauderhaften Wetter auszusetzen. Elke gehört ins Bett und nicht in diese ungesunde Witterung hinaus.«
»Das mußt du schon meiner Mutter überlassen, was die für ihr Kind für richtig hält«, entgegnete sie hochmütig. »Im übrigen hat uns die Mama verboten…«
»Ach, sieh doch mal an!« unterbrach er sie spöttisch. »Was da nicht noch viel zu verbieten wäre! Als ob ihr hochnäsigen Gören nicht von selbst wüßtet, wen ihr mit eurer Nichtachtung zu beehren habt! Und nun hopp, Elke, rasch ins Auto! Ich werde euch nach Hause fahren und euer Schulversäumnis beim Direktor entschuldigen.«
Aber das Kind rührte sich nicht, stand stumm und steif da und sah den Vetter feindselig an. Und Edna hatte wieder dieses aufreizend überhebliche Lächeln im Gesicht.
»Also gut«, entschied er nach kurzem Überlegen. »Mit Vernunftsgründen ist euch nicht beizukommen, das sehe ich ein. Also werde ich andere Maßnahmen ergreifen.«
Mit einem Ruck hob er die zappelnde Elke hoch, und schon saß sie im Auto.
»Nun, soll ich es mit dir ebenso machen?« fragte er Edna spöttisch.
»Wage es!« fuhr sie empört auf. »Du bist ja der reinste Wegelagerer, der…«
Und schon saß auch sie im Auto. Der Baron gebot dem Fahrer umzukehren und nach dem Waldhause zu fahren.
»Siehst du, Ednalein, so macht man es mit widerspenstigen kleinen Mädchen«, erklärte er der Base, die nur mit Mühe ihre Zornestränen unterdrücken konnte.
Bald hielt der Wagen vor dem Waldhause.
Die Mädchen flohen förmlich aus dem Auto in das Haus und warfen die Haustür hinter sich zu. Doch Swen ließ sich heute nicht abschrecken; denn in seinen Mundwinkeln hockte der harte, unerbittliche Zug, den man nur selten sah, vor dem sich jedoch seine Untergebenen fürchteten.
Gelassen öffnete er die Tür wieder, trat ein und verneigte sich vor Frau Elisa, die sich sofort in Kampfstellung begab.
»Ich muß dich bitten…«
»Laß nur, Tante Elisa«, winkte er kurz ab. »Ich muß dich sprechen. Dann befreie ich dich sofort wieder von meinem Anblick.«
»Du weißt doch, daß ich für dich nicht zu sprechen bin!«
»Und doch wirst du es heute tun müssen, Tante Elisa«, sagte er nun hart und scharf, so daß sie zusammenzuckte. »Ich komme nämlich heute als Ednas und Elkes Vormund.«
»So will ich dir sagen, daß meine Kinder keinen Vormund brauchen, da ich mir noch zutraue, sie allein erziehen zu können«, erklärte sie sehr von oben herab.
»Wozu werden unmündige Kinder denn unter Vormundschaft gestellt, wenn die Mutter allein als Erzieherin genügte?«
»So, willst du sagen, daß meine Kinder schlecht erzogen sind?«
»Davon will ich nicht sprechen, obgleich das Benehmen der Töchter nicht gerade wohlerzogen zu nennen ist. Ich will dich vielmehr darauf aufmerksam machen, daß Elke krank ist, daher bei diesem ungesunden Wetter unmöglich die Schule besuchen kann.«
»Das mußt du nun schon wirklich meiner Beurteilung überlassen, ob Elke die Schule besuchen kann oder nicht.«
»Ich sehe schon ein, Tante Elisa, daß ich dir ebensowenig mit Vernunftsgründen kommen kann wie deinen Töchtern«, bemerkte er eisig. »Ich will auch nicht lange um die notwendige Sache herumreden, sondern dir kurz und bündig anheimstellen, heute noch einen Arzt herkommen und Elke untersuchen zu lassen. Damit habe ich meiner Pflicht als Vormund genügt, die weitere Verantwortung trägst du.
Außerdem würde ich dir raten, Edna von der Schule beurlauben zu lassen, wenigstens, solange das arge Wetter anhält. Sie sieht blaß und überarbeitet aus.
Das wäre alles, was ich dir zu sagen hatte. An dir wird es nun liegen, helfend einzugreifen, wenn es überhaupt noch Zeit ist.«
Damit verbeugte er sich kurz und ging. Die Zurückbleibenden lachten spöttisch hinter ihm drein.
Was er sich eigentlich dachte. Ob er annähme, daß das Geld bei ihnen auf den Tannenbäumen wüchse!
Und dann – überhaupt – eines Hustens wegen so viel Aufhebens zu machen. Aber irgendwie mußte er sich mit seiner Vormundwürde doch wichtig tun.
So steckte Frau Elisa Elke dann ins Bett. Nach einer Woche schien der Husten verschwunden zu sein, und das Kind mußte nach wie vor bei Wind und Wetter die Schule besuchen.
Bis Elke dann zwei Wochen später mit Schüttelfrost und fliegenden Pulsen nach Hause kam.
Da packte die Mutter nun doch die Angst. Und was sie trotz Swens Rat unterlassen hatte, das tat sie jetzt: Sie ließ auf schnellstem Wege den Arzt holen, selbstverständlich nicht Sanitätsrat Melch. Der Gerufene stellte mit sehr ernstem Gesicht eine Lungenentzündung fest und erklärte, daß die Krankheit schon lange in dem zarten Kinderkörper gesteckt haben müßte. Ob die Mutter denn nichts bemerkt hätte?
Da senkte Frau Elisa den Kopf und schwieg.
Es begannen nun Tage, die allen im Waldhause das Herz erzittern ließen. Krankheit kannte man in der Familie kaum vom Hörensagen und war nun, da man einen so bitterernsten Fall vor Augen hatte, um so entsetzter. Jetzt erst fühlte man, wie zärtlich man eigentlich die kleine Elke liebte, da man täglich und stündlich um ihr Leben bangte.
Gar zu hart packte plötzlich das Schicksal die Menschen an, die es bisher vor wirklichem Leid bewahrt hatte, stieß sie hinein in Angst und Not, ließ sie erkennen, daß es Schlimmeres im Leben gibt als das, worum sie verbittert gemurrt und geklagt, daß ein geliebtes Wesen einem Menschen mehr bedeuten kann als Reichtum und ein glänzendes Leben.
Frau Elisas Haar wurde in diesen trostlosen Tagen schneeweiß, und die beiden Mädchen und Bolko standen dem Schmerz, der so plötzlich in ihr Leben getreten war, fassungslos gegenüber. Namentlich an dem Tage, an dem der Arzt erklärte, daß er die Todkranke aufgeben müßte. Und man brauchte das arme, bis zum Skelett abgemagerte Körperchen nur anzusehen, dann wußte man, daß der Arzt die Wahrheit sprach.
Ob denn wirklich keine Rettung mehr möglich sei, fragte die gepeinigte Mutter mit erloschener Stimme. Der Arzt meinte, daß hier vielleicht nur noch eine Kapazität oder ein Wunder der Natur etwas ausrichten könnten; er jedoch sei mit seiner Kunst zu Ende.
Frau Elisa war der Verzweiflung nahe. Wenn Elke starb, dann hatte sie nicht nur den Schmerz um den Verlust ihres Kindes zu tragen; sie mußte sich auch die Hauptschuld an seinem Tode beimessen. Sie hatte den Husten zu leicht genommen, der schon der Anfang zu dieser vernichtenden Krankheit gewesen war. Sie hatte sich auch von Swen nicht warnen lassen.
»Wer ist eigentlich der Vormund des Kindes?« fragte der Arzt plötzlich in ihre trostlosen Gedanken hinein. Und als er hörte, daß das Vormundschaftsgericht den Baron von Hellersen mit diesem Amt betraut hatte, war er sehr erstaunt, daß dieser nicht von der schweren Krankheit seines Mündels in Kenntnis gesetzt worden war.
»Das muß sofort nachgeholt werden!« entschied er, und in seiner Stimme lag etwas, das keinen Widerspruch duldete. »Der Herr Baron ist doch wirklich reich genug, um den hier in Frage kommenden Professor herkommen zu lassen. Und wenn auch der nicht helfen kann, so hat man das beruhigende Gefühl, alles getan zu haben, was in Menschenkräften steht. Ich werde mich sofort mit dem Baron in Verbindung setzen.«
Ohne die Einwilligung Frau Elisas abzuwarten, entfernte er sich aus dem Krankenzimmer, um auf schnellstem Wege den Schloßherrn aufzusuchen.
Und Frau Elisa hielt ihn nicht zurück. Sie war viel zu zermürbt, um sich jetzt noch gegen etwas, was ihrem Kinde Hilfe bringen könnte, aufzulehnen, und selbst wenn diese Hilfe von Swen kommen sollte.
Schon nach kurzer Zeit kam der Arzt wieder – und vier Augenpaare sahen ihm in banger Frage entgegen.
»Alles ist in die Wege geleitet«, berichtete er, ordentlich aufgeräumt. »Der Baron will den berühmten Professor mit einem Flugzeug herkommen lassen. Wenn alles klappt, kann er bereits heute hier sein.«
Dann wartete man, wartete. Und dieses entsetzliche Warten zermürbte fast noch mehr als all die bange Angst vorher. Wenn der Professor nur käme und Elke nicht inzwischen stürbe.
Endlich war der so sehnsüchtig erwartete Mann da, in dessen Begleitung sich eine Schwester befand. Der Baron hatte die Fremden zum Waldhaus geführt und begrüßte nun dessen Bewohner mit einer frostigen Verbeugung.
Er hielt sich schweigend im Hintergrund. Nur als auch der Professor behauptete, daß die Krankheit schon lange in des Kindes Körper gesteckt haben müßte, da sah der Baron Frau Elisa an. Es war ein einziger Blick, der jedoch die allzeit beherrschte Frau so sehr aus der Fassung brachte, daß sie in hilfloses Weinen ausbrach.
Nach der Untersuchung der Todkranken war das Gesicht des Professors undurchdringlich. Er machte den Angehörigen keine Hoffnung, nahm sie ihnen aber auch nicht. Er bemühte sich mit Hilfe des Arztes und der Schwester ganz außerordentlich um die Kranke; es geschah nun alles, was in Menschenkräften stand.
Zwei Tage folgten – zwei lange, bange Tage, die Mutter und Geschwister des kranken Kindes zwischen bitterster Verzweiflung und zagender Hoffnung hin und her schwanken ließen.
Dann erklärte der Professor das Kind für gerettet.
Diese Nachricht nahm man wohl als Befreiung aus tiefster Angst auf, allein so recht von Herzen sich darüber freuen, das vermochte man zunächst noch nicht. Die letzten Tage hatten sie alle zu sehr zermürbt, sie zu jäh und wechselnd durch Höhen und Tiefen gerissen. Erst als man sah, wie Elke sich langsam erholte, da wagte sich die Freude hervor.
Der Professor reiste, sobald die Gefahr vorüber war, sofort wieder ab, ließ jedoch die tüchtige Schwester zurück, die fürs erste bei der Kranken bleiben sollte. Der Baron kam jeden Tag nach dem Waldhause, um sich nach dem Befinden seines Mündels zu erkundigen. Er blieb nie länger als einige Minuten und war von einer so eisigen Unnahbarkeit, daß er allen Scheu einflößte. Und als sich Frau Elisa mit einer ihr sonst fremden Zaghaftigkeit für seine tatkräftige Hilfe bedankte, da erwiderte er nicht gerade unfreundlich, aber sehr kühl, daß er nur die Pflicht seinem Mündel gegenüber erfüllt hätte.
*
»Mama, du mußt es doch begreifen können, daß ich mit zwanzig Jahren nicht länger zur Schule gehen mag!« bat Edna verzweifelt.
Sie war soeben mit der Nachricht nach Hause gekommen, daß sie die Abgangsprüfung nicht bestanden hätte, was die Mutter noch immer nicht fassen konnte.
»Nein, das kann ich durchaus nicht begreifen«, zürnte Frau Elisa. »Das Alter spielt hierbei gar keine Rolle. Es kommt nur darauf an, daß du die Prüfung machst.«
»Wenn ich nur die Notwendigkeit dazu einsehen würde, Mama. Studieren kann und mag ich auch nicht, und um hier müßig herumzusitzen, dazu brauche ich doch wirklich keine Prüfung.
Außerdem macht mir das Lernen keine Freude mehr. Ich bin wohl überhaupt zu dumm, um das alles zu begreifen.«
Sie schwieg verlegen, denn soeben betrat der Baron das Zimmer und hatte die letzten Worte gehört. Frau Elisa begrüßte ihn mit höflicher Zurückhaltung und bot ihm einen Sitz an, den er heute ausnahmsweise annahm.
Seit dem unvergeßlichen Tage, da der Baron den Professor ins Haus gebracht hatte, herrschte eine Art Waffenstillstand zwischen den Verwandten. Man war wohl keineswegs liebenswürdig, eher frostig zueinander, aber man befehdete sich auch nicht mehr, wie man es vor Elkes Krankheit getan.
»Ich komme von Elke«, begann der Baron mit seiner dunklen, befehlsgewohnten Stimme. »Es geht der Kleinen erfreulich gut; jetzt haben wir sie endlich so richtig übern Berg. Ich habe heute übrigens mit dem Professor fernmündlich gesprochen, weil ich mir weitere Vorschriften zu Elkes Behandlung holen wollte. Ich gedachte sie in ein milderes Klima zu schicken; allein der Professor hält gerade unsere Waldluft für Medizin. Die Schwester müßte allerdings wieder in seine Klinik zurückkehren, da er sie dort nötig hat. Und da Elke schon so erfreulich gut vorangekommen ist, wird sie ja die Pflegerin entbehren können.«
»Mir ist es sehr lieb, wenn die Schwester geht«, bekannte Frau Elisa mit einer Unsicherheit, die bei ihrer sonst so überlegenen Art sonderbar anmutete. »Ich weiß nämlich nicht mehr, wie ich die Mehrunkosten bestreiten soll und dir die verauslagte Summe zurückerstatten soll.«
»Tante Elisa, du quälst dich mit Dingen herum, die ganz unnötig sind«, sagte der Baron sehr ernst. »Es wäre ja noch schöner, wenn ich für mein Mündel nicht einmal so viel übrig haben sollte, daß so kleine Auslagen beglichen werden könnten.«
»Es ist aber ein bedrückendes Gefühl, einem Menschen etwas schuldig zu sein«, beharrte sie. »Daher möchte ich dir doch die Auslagen, wenn auch nur allmählich und in kleinen Summen, zurückzahlen. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, Almosen entgegenzunehmen.«
»Wenn du es so bezeichnen willst, Tante Elisa, dann ist es freilich besser, wenn du mir das Geld zurückzahlst«, entgegnete er frostig. »Ich werde dir die Belege zukommen lassen.«
»Ich bitte darum«, versetzte sie aufatmend.
»Übrigens wollte ich mit dir über Edna sprechen«, wechselte sie dann rasch das Gespräch. »Sonst könntest du mir wieder Vorwürfe machen, daß ich über deinen Kopf hinweg Bestimmungen getroffen habe.
Edna hat ihre Abgangsprüfung nicht bestanden und weigert sich nun, die Anstalt weiter zu besuchen. Ich bin jedoch dafür, daß sie es tut. Wie denkst du darüber?« fragte sie, und man merkte es ihr an, wie große Überwindung sie diese Frage kostete.
»Da müßte ich erst Näheres wissen, ehe ich mich dazu äußern kann, Tante Elisa. Wie alt ist Edna?«
»Zwanzig Jahre ist sie vor einigen Tagen geworden.«
»Will sie studieren?«
»Wovon denn? Etwa von den zweihundertfünfzig Mark, die mir monatlich zur Verfügung stehen?«
»Also dann soll sie die Prüfung sozusagen zu ihrem Vergnügen machen?«
»Wenn du es so nennen willst, ja.«
»Um dann hier herumzusitzen wie Gerswint und Bolko?«
»Es steht dir wohl nicht gut an, Kritik über meine beiden ältesten Kinder zu üben, die gottlob deiner Vormundschaft nicht unterstehen«, sagte sie abweisend. »Hier geht es allein um Edna. Ich möchte kurz und bündig deine Meinung hören, damit du mir später keinen Strich durch meine Bestimmungen machen kannst.«
»Also gut, Tante Elisa, höre meine Meinung kurz und bündig: Ich bin dafür, zuerst einmal Edna selber zu fragen, wie sie über ihre Zukunft denkt. Also, bitte, Edna, äußere dich!«
Das Mädchen, das sehr blaß und niedergedrückt neben dem Vormund saß, sah mit müdem Lächeln zu ihm auf.
»Meine Meinung ist ja so unwichtig, Swen; die Mama zwingt mich ja doch mit ihrem Willen.«
»Na, erlaube mal, mein Kind!« fuhr die Mutter entrüstet auf. »Das klingt ja wie eine bittere Anklage. Als wenn eine Mutter nicht immer das Beste für ihr Kind wollte.«
»Bitte, Tante Elisa, so kommen wir nicht weiter«, sagte der Baron energisch. »Und du, Edna, unterlasse alle Nebenbemerkungen. Erkläre kurz, wie du dir dein Leben einrichten möchtest.«
»Alles andere, als hier sitzen und mich halb zu Tode langweilen.«
»Also mit einem Wort gesagt: arbeiten?«
»Wenn sich die Arbeit mit meinen Fähigkeiten vereinbaren läßt, ja. Ich mag nicht länger hier herumhocken und stündlich die Trostlosigkeit im Hause mit ansehen müssen!« rief sie mit einer Leidenschaftlichkeit, die bei dem sonst so gelassenen Mädchen überraschte. »Wenn ich zu Hause bin, bedrückt mich das alles hier namenlos.«
Sie war so erregt, daß sie am ganzen Körper nur so zitterte. Swen fing die bebenden Hände ein und drückte sie warm und beruhigend.
Da senkte sie den Kopf und weinte heiß auf.
»Edna, was soll das! Schämst du dich denn nicht, dich so gehen zu lassen?« fuhr die Mutter sie hart an. Der Mädchenkopf ruckte hoch; die Hände versuchten verzweifelt, sich aus denen des Vetters zu befreien.
»Swen, so laß mich doch!« flehte sie mit einem angstvollen Blick zu der zürnenden Mutter hin. »Es hat ja alles keinen Zweck, ich werde weiter zur Schule gehen.«
»Und dich mit Dingen herumplagen, die dir zuwider sind? Ausgeschlossen! Jetzt spreche ich zu dir als Vormund, der dazu da ist, die Interessen seines Mündels zu vertreten. Daher sprich zu mir, wie dir’s ums Herz ist.«
»Nein, nein, so laß mich doch!« flehte sie immer dringlicher und senkte den Kopf, weil die drohenden Blicke der Mutter ihr unerträglich waren.
»Du siehst, die Mama ist böse.«
»Und ich kann noch böser werden, Edna!« sagte Swen nun in einem so herrischen Ton, daß alle zusammenzuckten. »Ich frage dich zum letztenmal: Welchen Beruf möchtest du ergreifen?«
»Am liebsten würde ich Sekretärin, Rendantin oder so etwas Ähnliches«, stotterte sie eingeschüchtert und verkrampfte die Hände, die der Vormund nun losließ, fest im Schoß.
»Das genügt mir«, versetzte er ruhig. »Es paßt gut, daß bei mir ein solcher Posten zu besetzen ist. Du kannst übermorgen, also am ersten April, als Lernende in meinen Betrieb treten. Mein Sekretär wird dich ausbilden.«
»Das dulde ich auf keinen Fall«, meldete Frau Elisa sich nun entrüstet. »Das hat meine Tochter denn doch nicht nötig, sich von diesem – diesem hergelaufenen Menschen etwas befehlen zu lassen.«
Die Gestalt des Barons straffte sich nur ganz wenig. Eisig war seine Stimme, als er nun sagte: »Du irrst, Tante Elisa. Deine Tochter hat es durchaus nötig – nämlich: zu arbeiten! Genauso nötig hat sie es wie unzählige andere Mädchen auch. Denn sie ist in keiner Weise etwas Besonderes, hat daher auch nichts Besonderes vom Leben zu beanspruchen. Daß du es ruhig mit ansehen kannst, wie zwei gesunde junge Mädchen, wie Gerswint und hauptsächlich Bolko, hier dem lieben Gott die Tage wegstehlen, das ist schließlich deine Sache. Aber daß mein Mündel dieses trostlose Leben nicht auch noch mitzumachen braucht, dafür werde ich als Vormund sorgen. Und was meinen Sekretär betrifft, so ist er kein hergelaufener Mensch, wie du dich auszudrücken beliebst, sondern ein Mann, wie man ihn nur selten im Leben findet. Er verfügt über ein so reiches Wissen, daß er Edna mit Leichtigkeit für ihren späteren Beruf vorbereiten kann. Er ist vielleicht etwas zu ernst, zu schwerblütig und unzugänglich, aber das ist auf eine sehr traurige Jugend zurückzuführen. Als jüngstes Kind eines Offiziers wurde er die ersten Lebensjahre sehr verwöhnt, wie ja die meisten Nachkömmlinge. Um so härter packte ihn das Leben später an. Im Kriege verlor er Vater und Bruder und auch die Schwester, die sich als freiwillige Helferin eine ansteckende Krankheit holte und daran starb. Die Mutter ging aus Kummer und Gram darüber langsam zugrunde. Den zehnjährigen Roger, der als einziger von der Familie zurückblieb, steckte man in ein Waisenhaus, aber in eines, das mehr einer Erziehungsanstalt hoffnungsloser Taugenichtse als einer Heimat elternloser Kinder glich. Für das kleinste Vergehen wurden die bedauernswerten Jungen halb zu Tode geprügelt – und mußten außerdem noch hungern. So was gab es nämlich damals noch. Wieloff spricht nur ganz selten davon, aber er muß unmenschlich gelitten haben, bis er es ganz einfach nicht mehr ertragen konnte und mit fünfzehn Jahren ausrückte. Onkel Leopold fand ihn halbverhungert im Walde, nahm ihn mit nach Waldwinkel und hat aus dem verprügelten Jungen erst einen Menschen gemacht. Und ein wie wertvoller Mensch er geworden ist, ist daraus zu ersehen, daß der Onkel ihn nie mehr von seiner Seite ließ. Ganz hat Wieloff seine trostlose Kindheit freilich nicht vergessen; daher ist er so ernst und verschlossen. – So, dieses zur Richtigstellung, Tante Elisa. Und nun bitte ich dich, mache Edna das Leben nicht unnötig schwer. Es ist anerkennenswert genug, daß sie sich bei der ganz falschen Erziehung, die sie genossen hat, überhaupt zu einem Beruf entschließen kann.«
»Hier nachgeben, hieße meine ganzen Anschauungen umwerfen.«
»Und wäre das so schlimm, Tante Elisa?« lächelte Swen. »Gib du lieber freiwillig nach; denn ich darf es im Interesse meines Mündels nicht.
Also, Edna«, wandte er sich an die Base, »übermorgen trittst du deinen Dienst an!«
»Dienst – mein Gott, dieses Wort!«
»Jawohl, Tante Elisa, Dienst! An dieses Wort wirst du dich schon gewöhnen müssen, da Edna ja nach wie vor bei dir wohnen und dann auch von ihrem Dienst sprechen wird.«
Er erhob sich und wollte nach einer kurzen Verbeugung das Zimmer verlassen, als sein Blick auf Gerswint fiel, die in einem Sessel lehnte und gelangweilt dreinschaute.
Sehr schön, sehr gepflegt, sehr elegant sah sie aus.
Wahrhaftig, wenn der nahe Tod der kleinen Elke die Bewohner des Waldhauses aus ihrer Hoffärtigkeit aufgerüttelt hatte, dieses kalte Bild ohne Gnade war davon unberührt geblieben!
Den Baron würgte es plötzlich im Halse, und er wandte sich rasch ab. Sein Blick traf Bolko, der am Fenster stand und verbissen vor sich hin starrte.
»Nun, Bolko, das Herrendasein ist wohl eine angenehme Sache?« erkundigte er sich spöttisch. Der Vetter sprang auf ihn zu.
»Laß deine geschmacklosen Witze!« schrie er ihn tiefgereizt an. »Hast du für mich vielleicht ein ähnliches Pöstchen wie für Edna auf Lager?«
»Gewiß, wenn du dich darum bemühen willst.«
»Brauchst du vielleicht einen Kuli für deinen Stall?« höhnte er.
»Das nicht gerade, aber einen Eleven für mein Gut. Er braucht kein landwirtschaftliches Studium hinter sich zu haben, denn es sind ja nicht die studierten Leute allein Schlauköpfe. Er muß nur Lust und Liebe zur Arbeit mitbringen. Vielleicht kannst du mir einen solchen jungen Mann empfehlen? Mein braver Oberinspektor Gort würde bestimmt einen ganzen Kerl aus ihm machen.«
Ohne eine Entgegnung abzuwarten, verbeugte er sich und ging.
*
»Swen, einen Augenblick, bitte!«
Der Baron, der gerade durch das von der Waldwiese zum Gutshof führende Seitentor reiten wollte, fuhr überrascht herum, zügelte den Gaul.
»Nanu, Edna, was machst du denn hier?«
»Ich habe hier auf dich gewartet, Swen«, erwiderte sie verlegen. »Ich will dir nämlich sagen, daß ich – daß ich nun bestimmt in deine Dienste trete.«
Swen saß ab und stand nun vor dem immer verlegener werdenden Mädchen.
»Dein Entschluß freut mich, Edna«, sagte er dann ernst. »Denn er zeigt mir, daß du den Willen hast, durch ehrliche Arbeit ein zufriedeneres Menschenkind zu werden als deine hochmütigen Angehörigen. War der Kampf mit der Mama sehr schwer?« fragte er teilnehmend. Sie nickte hastig: »Sehr, Swen. Was gab das für einen heißen Streit. So böse und erzürnt habe ich die Mama noch nie gesehen.«
»Es ist ihr ja von ihren Kindern auch noch nie so ernst widersprochen worden, Edna.«
»Ach, weißt du, Swen, ich mag kaum noch nach Hause gehen«, klagte sie mutlos. »Wenn die Mama nur allein wäre. Aber Gerswint ist bestimmt noch schlimmer als die Mama.«
»Kann ich mir denken«, bestätigte er grimmig. »Aber nun sei vergnügt, Edna. Wir werden dich in der ersten Zeit so lange im Schloß festhalten, daß du nur zum Schlafen nach dem Waldhause zu gehen brauchst. Du bekommst dein eigenes Zimmer im Schloß, wie du dich überhaupt bei mir wie zu Hause fühlen sollst. So langsam wird die Mama sich dann auch an deine veränderte Lebensweise gewöhnen.
Weißt du was, Edna? Komme gleich mit mir! Es ist wohl erst morgen der erste April und dein Antrittstag, aber du kannst dich schon so langsam mit deiner späteren Arbeit vertraut machen.«
»Ich müßte dann erst der Mama Bescheid sagen, sonst ängstigt sie sich um mich.«
»Natürlich, Kleine. Lauf nur hinüber; ich warte hier auf dich. Und wenn es sehr schlimm werden sollte, dann gib mir einen Wink. Ich erscheine dann als Verstärkung.«
Sie hastete davon und kam nach sehr kurzer Zeit wieder.
»Es war gar nicht so schlimm«, lachte sie zu ihm auf. »Mama hat kaum bedacht, was sie mir erlaubte; denn jetzt gerade ist derselbe Kampf mit Bolko entbrannt!«
»Wie soll ich das verstehen, Edna?«
»Daß Bolko deinen Vorschlag, als Eleve in deine Dienste zu treten, annehmen möchte und mit der Mama nun darum kämpft.«
»Also doch«, sagte Swen überrascht. »Das habe ich jetzt noch nicht erwartet.«
»Ach, weißt du, Swen, du hast ja keine Ahnung davon, wie unglücklich Bolko sich oft gefühlt hat; er hat es nur nicht zeigen mögen. Er macht sich doch auch schließlich Sorge um seine Zukunft.«
»Und damit tut er recht, Edna. Er als Mann kann doch seiner Mutter nicht ewig am Rockzipfel hängen! Halten wir also die Daumen, daß er siegreich aus seinem Kampf hervorgeht.«
Sie schritten nun langsam dem Schlosse zu; das Pferd folgte brav nach, doch nur, solange der Stall nicht in Sicht war.
Als es den erst erspäht hatte, galoppierte es wiehernd und auskeilend der Futterkrippe zu.
»Ach ja, reiten möchte ich auch wieder einmal!« seufzte Edna. Sven lachte: »Du wirst vielleicht noch mehr im Sattel sitzen, als es dir lieb ist, Edna; denn zu den Obliegenheiten einer guten Rendantin gehört auch eine gewisse Kenntnis der Außenwirtschaft.«
»Sag mal, Swen, werde ich zu alledem auch nicht zu dumm sein?« fragte sie zaghaft; aber er lachte sie herzlich aus.
»Das ist nun wieder zu wenig Selbstbewußtsein, Edna. Ich glaube, du bist schon zu lange von der Schürze deiner Mutter weg«, neckte er.
Langsam stiegen sie die Stufen zum Schloß empor. Edna überfiel nun doch ein banges Zagen, das sich noch verstärkte, als sie an des Vormunds Seite das Arbeitszimmer des Sekretärs betrat. Der saß so in Arbeit vertieft da, daß er den Eintritt seines Herrn und dessen Begleiterin überhörte. Edna betrachtete sehr eingehend den Mann, der ihr Lehrmeister werden sollte. Sie wollte sehen, was für einen Eindruck er machte. Einen Sekretär hatte sie sich immer anders vorgestellt.
»Nun, Herr Wieloff, wenn Sie auch ein fanatisches Arbeitstier sind, so müßten Sie doch merken, wenn ein Sonnenstrahl persönlich zu Ihnen ins Zimmer huscht«, neckte der Baron und sah schmunzelnd in Rogers überraschtes Gesicht. »Hier bringe ich Ihnen die angekündigte Schülerin. Machen Sie es gnädig mit der Kleinen. Sie soll nämlich bei all dem Wissenskram, den Sie ihr zweifellos beibringen werden, auch noch merken dürfen, daß der Himmel blau und die Sonne im Frühling golden ist.«
Er sah mit heimlichem Vergnügen, wie Edna das Näschen hob und zum Gruß den Kopf neigte.
Ganz wie die Frau Mama, stellte er belustigt fest.
»Herr Wieloff, wir haben gestern ja schon alles besprochen. Führen Sie schon heute Fräulein von Hellersen etwas in ihre Obliegenheiten ein.«
Wohl eine Stunde lang erklärte der Sekretär seiner ihm mit so viel Vertrauen übergebenen Schülerin, was sie zuerst von ihrer Arbeit wissen mußte. Nicht einen Blick warf er auf den reizenden Mädchenkopf, merkte nicht, daß die Augen, die aufmerksam an seinem Munde hingen, wunderschön waren.
Edna dagegen hatte schon längst festgestellt, daß der Sekretär einen schmalen, sehr ausdrucksvollen Kopf mit dichtem Blondhaar, blaugraue Augen und eine sehnige Gestalt besaß, wie sie nur Männer haben, die viel im Sattel sitzen oder Sport treiben.
»Fräulein von Hellersen, Sie passen ja gar nicht auf«, erklang die ungeduldige Männerstimme in ihr Grübeln hinein. Sie zuckte zusammen und bemühte sich, besonders aufmerksam zu sein.
Er übergab ihr eine Liste, in die sie Namen schreiben sollte, und kehrte dann an seinen Arbeitstisch zurück, um sich seiner eigenen Arbeit zu widmen. Es war so still im Zimmer, daß Edna schon annahm, allein zu sein. Umzusehen wagte sie sich jedoch nicht.
»Onkel Roger, aufmachen!« erklang da plötzlich ein süßes Stimmchen von der Tür her, und zwei Kinderfäuste schlugen heftig dagegen. Es war Ilsetraut, die sich, weil sie den Drücker der hohen Türen nicht erreichen konnte, in gewohnter Art Eintritt verschaffen wollte.
Und der eben noch so ernste, unzugängliche Mann war kaum wiederzuerkennen, als er das kleine Mädchen auf die Arme hob und mit einer unendlich zarten Gebärde an sich drückte. In seinen Augen lag ein warmes Leuchten, und seine Stimme klang einschmeichelnd und weich, als er mit dem Kinde sprach.
Nun hatte Ilsetraut Edna entdeckt, und ihre Augen wurden kugelrund vor Staunen.
Die Kleine strebte von seinem Arm und stand gleich darauf vor der neuen Tante, die entzückt in das wunderschöne Kindergesicht schaute.
»Wie heißt du?«
»Edna.«
»Und was willst du hier?«
»Herrn Wieloff bei der Arbeit helfen.«
»Onkel Roger?«
»Ja.«
Edna mußte nun einen sehr langen Blick aus den verträumten Kinderaugen über sich ergehen lassen.
»Kennt der Papa dich, Tante Edna?« forschte sie weiter.
»Ja. Aber du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt.«
»Ach so«, sagte sie entschuldigend. »Ich heiße Ilse Gertraude Hellersen. Heißt du auch Hellersen?«
»Ja.«
»Ach, dann bist du eine von den hochnäsigen Leuten, wie der Onkel Oberinspektor immer sagt, und…«
»Ilsetraut«, rief der Baron, der soeben das Zimmer betreten und die letzten Worte seines Töchterleins gehört hatte, halb lachend, halb ärgerlich. »Solche Gören können einen doch tatsächlich in die tödlichste Verlegenheit bringen. Und das schadenfrohe Lächeln der lieben Base noch dazu.
Na, Kinder, kommt Kaffee trinken. Um euch das zu sagen, habe ich übrigens Ilsetraut hergeschickt. Doch der Fratz hielt es ja für wichtiger, aus der Schule zu plaudern«, blinzelte er zu Edna hin, die vergnügt lachte. Er schob zwanglos seine Hand unter ihren Arm, und so schritten sie, von Roger und Ilsetraut gefolgt, nach einem lauschigen Zimmer, in dessen Erker ein sehr hübscher Kaffeetisch gedeckt war.
»Fein duftet das hier.« Edna hob schnuppernd das Näschen und verneigte sich dann leicht vor einer Dame, die sich bescheiden im Hintergrund hielt.
»Das ist unsere liebe Hausgenossin Frau Wilding, die für unser aller Wohl sorgt«, wandte der Baron sich erklärend an das Mädchen. »Und das ist meine Base Edna von Hellersen, die jetzt täglich mit uns speisen und zum größten Teil auch hier wohnen wird.«
Edna verneigte sich wieder vor der Dame, die ihr mit ihrer zarten Gestalt und den gütigen Augen sehr gefiel. Sie mochte so alt sein wie ihre Mama, aber anders, ganz anders war sie, obgleich auch sie schneeweißes Haar hatte und sehr vornehm aussah.
Es wurde nun eine gemütliche Kaffeestunde, an der auch Ilsetraut teilnehmen durfte. Es war erstaunlich, wieviel Wieloff sich mit dem Kinde beschäftigte, und mit welcher Liebe es an ihm hing. Man plauderte noch eine Weile angeregt, und dann meinte Edna, daß sie nun nach Hause gehen müsse. Swen begleitete sie noch bis zur Wiese, dann lief sie allein dem Waldhause zu.
Im Wohnzimmer saßen die Mutter und Gerswint. Sie sahen kaum auf, als Edna eintrat.
»Mama, es wird alles viel besser gehen, als ich angenommen habe«, erzählte sie freudig erregt, schwieg jedoch betroffen still, als die Mutter sie mit einem Blick musterte, der ihr durch und durch ging.
»Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an; das kannst du dir fortan merken«, sagte Frau Elisa hart. »Du hast dich von dem Augenblick an von uns gelöst, als du auf die andere Seite übertratest.«
»Aber Mama!« bat Edna betroffen. Allein die Mutter winkte entschieden ab.
»Du hast es ja nicht anders gewollt. Nun sei auch zufrieden mit dem, was du dir allein geschaffen hast.«
»Ja, soll ich denn überhaupt nicht mehr hierherkommen?« fragte das Mädchen verzweifelt.
»Das kannst du halten, wie du willst. Ich habe dich gestern vor die Wahl gestellt: deinen Vormund oder mich. Du hast ersteren gewählt; nun rechne dich auch zu ihm.«
Da ging Edna still hinaus. Ihr war recht weh zumute. Hatte sie denn etwas Böses verbrochen, daß die Mutter sie wie eine Verbrecherin behandelte?
Müde stieg sie die Treppe hinauf. Als sie an Bolkos Zimmer vorüberkam, öffnete sich die Tür, und er stand auf der Schwelle.
»Komm herein, Edna«, bat er hastig und zog die Schwester mit sich in das Gemach. »Wie war es, erzähle!«
Edna ließ sich müde auf den nächsten Stuhl sinken.
»Gut war es«, antwortete sie niedergeschlagen. »Man könnte zufrieden sein, wenn die Mama sich anders zu der Sache stellen würde. Wie weit bist du mit ihr gekommen, Bolko?«
»So weit wie du«, gab er kurz zurück. »Sie hat auch mich zum Schluß eines heißen, erbitterten Kampfes vor die Wahl gestellt: Entweder sie oder Swen.«
»Und was wirst du tun, Bolko?« fragte die Schwester bang.
Er zuckte die Schultern.
»Zuerst einmal eine Nacht darüber vergehen lassen. Dann gibt es ja nur zweierlei für mich: entweder zu Swen gehen und aus meinem verpfuschten Leben herausholen, was noch herauszuholen ist, und damit die Gunst der Mama verlieren – oder hierbleiben, ihre Gunst behalten, dafür aber langsam und sicher vor Trübsinn und Langeweile verblöden.«
*
Swen von Hellersen hatte Mühe, ein Lächeln zu unterdrücken, als er am andern Morgen über die Waldwiese reiten wollte, um auf schnellstem Wege zum Oberförster zu gelangen, und genau an derselben Stelle wie gestern Edna seinen Vetter Bolko stehen sah.
»Swen, ich bin gekommen…«, begann er zaghaft. Aber da stand dieser schon vor ihm und reichte ihm die Hand.
»Schlag ein, Bolko!« sagte er ernst. »Weiter ist nichts nötig. Habe erstens Vertrauen zu mir. Dann suche dir ein Wissen anzueignen, wie es jeder Landwirt haben muß. Alles andere findet sich dann von selbst.«
Bolko ergriff die Hand mit festem Druck. Schritt dann neben dem Vetter her, der ihn über den großen Gutshof führte, bis sie auf den Oberinspektor stießen.
»Hier bringe ich Ihnen den angekündigten Schützling, Herr Oberinspektor«, sagte der Baron vergnügt. »Haben Sie ein Herz im Leibe und bedenken Sie, daß er seine Knochen nicht in der Lotterie gewonnen hat.«
»Wird schon – wird schon alles werden«, versprach der gutmütige Alte zuversichtlich, während er seinen neuesten Zögling mit kritischen Augen musterte. »Nur ein bißchen zu sehr – hm, tja…«
»Muttersöhnchen«, half Bolko nicht ohne Bitterkeit aus; da streckte ihm der biedere Gort mit herzlicher Gebärde seine Hand entgegen.
»Also, auf gutes Verstehen, Herr von Hellersen! Und wenn es manchmal ein bißchen heiß hergehen sollte, dann müssen Sie immer daran denken, daß Lehrjahre keine Herrenjahre sind und daß der, der später befehlen will, in erster Linie gehorchen und den Mund halten lernen muß.«
Bolko legte schweigend seine gepflegte Hand in die derbe des Mannes, der ihn mitleidig ansah. Der Baron entfernte sich leichten Herzens, da er den Vetter jetzt in guter Hut wußte.
In der Halle des Schlosses stieß er auf Edna, die nach dem Arbeitszimmer des Sekretärs gehen wollte.
»Ist Bolko gekommen?« fragte sie hastig.
»Er ist da. Unser braver Oberinspektor hat ihn soeben unter seine Fittiche genommen.«
»Hat er sich also doch durchgerungen«, atmete sie tief auf. »Gestern sah es nämlich noch böse genug aus; die Mama hat ihm arg zugesetzt. Wir sind beide ganz gräßlich in Ungnade bei ihr gefallen.«
»Das wird sich wieder geben, kleines Mädel«, tröstete der Vetter. »Jetzt heißt es für euch beide: durchhalten und nicht etwa auf halbem Wege stehenbleiben.«
*
Am nächsten Tag fuhr Hellersen in die Stadt.
In der Hauptstraße hatte er eine Begegnung, die ihn freute. Er stand plötzlich Ellen Hungold gegenüber.
»Hallo, gnädiges Fräulein, das ist aber eine Überraschung!«
»Für mich nicht«, gab sie lächelnd zurück. »Ich weiß ja, daß Waldwinkel hier in der Nähe liegt. Wie es Ihnen geht, brauche ich nicht erst zu fragen. Sie sehen blendend aus!«
»Sie weniger«, bemerkte er mit einem prüfenden Blick in ihr schmalgewordenes Gesicht. »Sind Sie krank gewesen?
Aber ich bitte Sie, gnädiges Fräulein!« rief er bestürzt, als ihr die Tränen in die Augen schossen. »Ist denn irgend etwas Unangenehmes geschehen?«
»Mehr, als Sie ahnen«, erwiderte sie bitter. »Ich kann Ihnen wahre Wunderdinge erzählen, allerdings sehr trostlose«, setzte sie leise hinzu. Er wurde immer bestürzter. Ein Blick auf die Armbanduhr, ein kurzes Überlegen.
»Haben Sie Zeit, gnädiges Fräulein?«
»Wenn ich von allem so viel hätte wie Zeit, Herr Baron.«
»Das kann ich von mir allerdings nicht behaupten. Aber eine Stunde bleibt mir immerhin, um mich ein wenig mit Ihnen zu unterhalten. Kennen Sie das kleine Café in der Wilhelmstraße?«
»Ja, es ist ganz nett dort.«
»Wollen Sie mich dahin begleiten?«
»Von Herzen gern.«
So schritten sie denn nebeneinander der Konditorei zu, und der Baron mußte seine Begleiterin immer wieder verstohlen betrachten. Das sollte Ellen Hungold sein, die kecke, verzogene, temperamentvolle Ellen? Das konnte man kaum glauben.
Dieses Menschenkind, das da so seltsam bedrückt neben ihm her ging, war ein müdes, zerquältes Geschöpf.
Wie hatte das in den wenigen Monaten, seit er sie zuletzt gesehen, geschehen können?
In dem Café fanden sie ein ruhiges Plätzchen, das zum Plaudern wie geschaffen schien. Hellersen half der jungen Dame aus dem Mantel und sah erst jetzt so recht, wie erschreckend elend sie war. Allein er fragte nicht, wartete, bis sie den Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen dazu gegessen hatte, steckte mit ihrer Erlaubnis eine Zigarette an und lehnte sich dann behaglich in seinen Polsterstuhl zurück.
»Wie geht es Ihren verehrten Eltern, gnädiges Fräulein?« erkundigte er sich, aber da ging ein Schatten über ihr Gesicht.
»Meine Eltern wohnen jetzt hier in der Stadt, weil Papa das Gut verkauft hat.«
»Aber wie ist denn das gekommen, gnädiges Fräulein?«
»Daran ist meine unglückliche Ehe schuld«, erklärte sie kurz und lächelte ein wenig, als sie seine maßlose Überraschung sah.
»Sie sind verheiratet?«
»Gewesen. Ich bin bereits wieder geschieden.«
Jetzt legte er seine Zigarette fort; sie schmeckte ihm nicht mehr. Voll tiefen Mitgefühls sah er in das verhärmte Antlitz dieses blutjungen Menschenkindes.
»Ich weiß nicht, ob Sie mir darüber erzählen wollen, gnädige Frau…«, begann er zögernd.
»Warum nicht? Sie würden es ja doch einmal erfahren, und dann gewiß in verzerrter Form. Die Menschen sind schlecht, Herr Baron.«
»Das sagt ein Menschenkind von neunzehn Jahren?«
»Achtzehn sind es«, schaltete sie bitter ein.
»Sogar erst achtzehn, und dann schon so verbittert? Wer hat so böse an Ihnen gehandelt, daß Sie so werden konnten?«
»Alf von Unitz. Er wurde im November vorigen Jahres mein Mann. Im Februar hatte er bereits mit seinen Angehörigen meine ansehnliche Mitgift verbraucht, und seit einer Woche bin ich von ihm geschieden.«
So kurz war das gesagt, und doch lag eine Welt von Tragik in den wenigen Worten. Wie hatte es nur geschehen können, daß gerade die kecke Ellen Hungold an diesen Glücksritter geraten konnte?
»Ich lernte ihn im Oktober auf einem Fest kennen«, erzählte sie, als habe sie seine Gedanken erraten. »Vier Wochen später war ich seine Frau, obgleich meine Eltern mich anflehten, mich nicht so rasch zu binden. Schon auf der Hochzeitsreise lernte ich den wahren Charakter dieses Blenders kennen. Vertrauend hatte ich ihm meine Mitgift in die Hände gegeben. Was verstand ich schließlich von Geld? Ich war selig verliebt, und alles, was mein Mann tat, war in meinen Augen gut und richtig. Als ich jedoch merkte, daß er mein Geld sinnlos verschleuderte, schrieb ich kurz entschlossen an meine Eltern und schilderte ihnen die ganzen Zustände. Sie verlangten unsere sofortige Heimkehr – wir befanden uns ja noch auf der Hochzeitsreise – und der Krach war da. Sie kennen doch meinen Vater, der nimmt kein Blatt vor den Mund. So sagte er denn auch seinem Schwiegersohn ganz gehörig die Wahrheit und nahm fortan all sein Tun unter strenge Kontrolle. Das paßte nun meinem Herrn Gemahl ganz und gar nicht. Und seine Angehörigen, die die reiche Geldquelle plötzlich versiegt sahen, hetzten ihn auf, wo sie nur konnten. Ich habe Höllentage erlebt und auch zuerst schweigend ertragen, weil ich anfangs aus Trotz, dann aus Scham meinen Eltern mit meinen Nöten nicht kommen wollte. Sie hatten mich vor Unitz ja gerade genug gewarnt. Alf muß die Drohungen meines Vaters wohl nicht ernst genommen haben, denn er führte sein verschwenderisches Herrenleben fort und machte Schulden an allen Ecken und Kanten. Er hat wohl angenommen, daß mein Vater es zu keinem Skandal kommen lassen und seine Schulden bezahlen würde. Aber Papa dachte nicht daran. Und als Unitz sich gar mit seinen Angehörigen auf Lorren einnistete und einmal zu einem Bekannten die Äußerung tat, er und seine Geschwister würden meine Eltern langsam aber sicher daraus vertreiben, da verkaufte Papa kurz entschlossen das Gut über die Köpfe der Eindringlinge hinweg, und wir zogen in die Stadt. Das war die beste Lösung, da Papa sich sowieso nicht mehr gesund genug fühlte, um den großen Gutsbetrieb leiten zu können. Und einem Verwalter alles allein zu überlassen, war er zu mißtrauisch. Der Gutsverkauf nahm nun den letzten Rest der Tünche von Unitz und zeigte ihn in seiner ganzen Roheit. Als er es sogar zu Tätlichkeiten kommen ließ, flüchtete ich zu meinen Eltern. Meine Mutter hatte große Mühe, meinen Vater zurückzuhalten, damit er nicht zu dem Rohling ging und ihn zur Rechenschaft zog. Er hätte sich in seiner Aufregung zu Dingen hinreißen lassen, die er später hätte bereuen müssen. Am nächsten Tage reichte ich die Scheidungsklage ein. Es ging alles sehr schnell, da ja die Beweise seiner Schuld reichlich vorhanden waren. Nun wohnen meine Eltern seit Monaten schon in der Stadt und fühlen sich sehr unglücklich, weil sie sich nach dem Lande kranksehnen. Wohl hat mein Vater noch so viel Geld, um wieder ein Gut kaufen zu können. Doch die ständigen Aufregungen der letzten Monate haben ihn so zermürbt, daß er es nicht mehr bewirtschaften könnte. Und nun trage ich nicht nur das eigene Leid, sondern muß auch noch das der Eltern mit ansehen und mir sagen: Du allein bist an allem schuld! Hättest du auf die Eltern gehört und nicht nach deinem eigenwilligen Kopf gehandelt, dann säßen wir heute alle noch auf Lorren. Diese unbarmherzige Reue, sie quält und peinigt mich Tag und Nacht.«
Ein trockenes Schluchzen schüttelte den elenden Körper, und der Baron war aufs tiefste erschüttert.
Wenn er hier doch nur helfen könnte!
»Wissen Sie was, Frau Ellen, ich begleite Sie zu Ihren Eltern«, sagte er nach einer Weile bedrückenden Schweigens. Da zog ein Freudenschimmer über ihr verweintes Gesicht.
So gingen sie denn nach der Hungoldschen Wohnung, wo der Baron mit herzlicher Freude empfangen wurde. Herr und Frau Hungold sahen nicht weniger elend und vergrämt aus als ihre Tochter.
»Das ist aber eine Überraschung, Herr Baron!« sagte der alte Herr so froh wie schon lange nicht mehr. »Sicherlich hat meine Tochter Sie in der Stadt getroffen und dann hierhergeschleift.«
»Die letzte Vermutung stimmt nicht, Herr Hungold«, lachte Hellersen. »Ich bin freiwillig hergekommen.«
»Freut mich um so mehr. Aber famos sehen Sie aus.«
»Es geht mir ja auch gut, Herr Hungold.«
»Will ich glauben. Wenn man so im Paradies sitzt – Felder, Wasser, Wald…«
Er brach ab und begann im Zimmer umherzulaufen. Dann blieb er vor dem Baron stehen, der auf Frau Hungolds Bitte Platz genommen hatte.
»Hat Ellen Ihnen alles erzählt?« fragte er mit einer Kopfbewegung zu der Tochter hin, die niedergeschlagen in der Nähe saß.
»Ja.«
»Schöne Geschichte, was? Das Leben unseres einzigen Kindes verpfuscht und damit auch das unsere. Den Kerl soll der Kuckuck holen!« schalt er grimmig.
»Aber, Herr Hungold«, versuchte Hellersen zu beschwichtigen, doch der alte Herr schüttelte unwirsch den Kopf.
»Sehen Sie sich das Mädel doch an! Das Herz kann sich einem umdrehen vor Jammer. Was war das für ein Prachtkerl. Immer unbändig und fidel, wenn auch manchmal etwas zu wild. Und heute? Jammer und Tränen – Tränen und Jammer ohne Ende. Und dann neben diesem trostlosen Anblick immer noch die quälenden Sorgen, die man sich um ihre Zukunft macht. Meine Frau und ich, wir haben uns durch die ständigen Aufregungen der letzten Monate aufgerieben; es kann daher schnell mit uns zu Ende gehen. Und dann steht das Mädel allein auf der Welt. Mit der Verwandtschaft halten wir nicht zusammen, man weiß ja, wie es in den meisten Fällen unter Verwandten zugeht. Weiter ist aber niemand da, der sich Ellens annehmen könnte. Von einer Ehe will sie begreiflicherweise nichts mehr wissen; sie hat wohl für immer davon genug. Das sind so die Sorgen, die meine Frau und mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Und dabei sitzt man noch in diesem Steinkasten und hat das Gefühl, daß die Mauern einen jeden Augenblick erdrücken können. Stein, Stein und noch mal Stein, wohin man auch schaut! Keine Felder, kein Wasser, kein Land! Ich habe nicht geglaubt, daß man danach so hungern kann!«
»Warum kaufen Sie sich nicht wieder ein Gut, Herr Hungold? Sie haben doch das Geld dazu, wie mir Frau Ellen erzählte.«
»Dann wird sie Ihnen auch erzählt haben, daß ich nicht mehr fähig bin, ein Gut zu bewirtschaften. Und die Leitung einem Verwalter überlassen, dazu könnte ich mich nicht entschließen. Ich würde dem armen Mann mit meinem Mißtrauen das Leben recht sauer machen. Es brauchte ja auch nicht gerade ein Gut zu sein. Was ich mir wünsche, ist ein kleines Haus, das in der Nähe von Wasser und Feld liegt. Einen Garten und einige Morgen Land dazu, Gelegenheit zum Fischen und Jagen in – solcher Umgebung könnte ich noch einmal meines Lebens froh werden. Aber so einen Wohnsitz gibt es nicht, oder besser gesagt: wenn es ihn gibt, ist er nicht verkäuflich. Ich habe mir Mühe genug gegeben, so ein kleines Paradies aufzutreiben. Schließlich bin ich des Suchens müde geworden und habe mich in diesen Steinkasten verkrochen. Das ersehnte kleine Besitztum kann ich mir zum Trost auf Löschpapier malen.«
»Und wenn ich nun wüßte, wo Sie es finden können?« sagte der Baron lächelnd.
Hungold sah ihn mißtrauisch an.
»Passen Sie mal auf, ich werde Ihnen Ihr ersehntes Paradies schildern: Mitten im Walde, dicht an einem See, liegt ein verschwiegenes kleines Haus, das sechs Zimmer, Küche und Keller birgt. Es gibt dort auch einen Stall, in dem man die üblichen Haustiere halten kann, und einen Garten mit den schönsten Obstbäumen und Sträuchern. Dazu zwei Morgen Ackerland, auf dem stadtmüde Herren nach Herzenslust buddeln können. Dann ein mehrere tausend Morgen großes Jagdgelände, das besagten Herren das Jagen gestattet. Und außerdem birgt der Waldsee viele Fische. Und wenn im Winter das Häuschen wie in Watte gepackt daliegt, der dicke Hauskater am warmen Ofen liegt und vor Wohlbehagen schnurrt, die Äpfel in der Ofenröhre brutzeln, der Grog auf dem Tisch dampft, dann sind immer die nötigen Skatbrüder zur Stelle und…«
»Erbarmen, Baron, hören Sie auf!« unterbrach ihn der alte Herr und hielt sich verzweifelt die Ohren zu.
»Wetten, daß ich mir dieses kleine Paradies aus dem Ärmel schütteln kann?« lachte Hellersen herzlich. »Steigen Sie mit Gattin und Tochter in mein Auto, das gleich zur Stelle sein wird, und zehn Minuten später sehen Sie das Haus Ihrer Sehnsucht lieblich und verträumt vor sich liegen.«
»Aber wenn Sie mich zum Narren halten, Baron, dann – dann – soll Sie…«
»Der Kuckuck holen, ich weiß«, ergänzte Swen lachend.
Es dauerte aber doch noch eine Weile, bis Papa Hungold sein Mißtrauen überwunden hatte und mit Frau und Tochter im Auto des Barons Platz nahm.
Schon in dem wunderbaren Wagen durch den Wald zu fahren, war für Hungold ein langentbehrter Genuß. Als dann aber der Wagen vor dem beschriebenen Haus stand, da war der alte Herr so erschüttert, daß ihm die Tränen in die Augen traten.
»Also bitte, Herr Hungold, ich habe den Ärmel geschüttelt.« Der Baron schlug absichtlich einen neckenden Ton an, damit Hungold Zeit hatte, sich zu fassen.
»Zwar sieht das Häuschen nicht besonders verlockend aus, da es einer nötigen Auffrischung bedarf. Aber wenn es erst innerlich und äußerlich ein neues Gewand trägt, dann wird es ebenso schmuck aussehen wie sein Gegenstück.«
Er zeigte nach dem andern Waldhause hinüber, das schneeweiß durch die Bäume schimmerte und kaum hundert Meter entfernt lag.
»Wer wohnt denn dort?« erkundigte sich Papa Hungold, der sich langsam zu fassen begann.
»Meine Verwandten, Frau Elisa von Hellersen nebst Kindern.«
»Ei, verflixt!« entfuhr es dem alten Herrn. Sein Blick suchte rasch seine Tochter, auf deren Gesicht nun ein unsäglich bitterer Ausdruck lag.
»Laß dich dadurch ja nicht beeinflussen, Papa! Ich habe im letzten halben Jahr so vieles gelernt; ich werde auch noch lernen können, Fräulein von Hellersen ruhig zu begegnen.«
»Es gibt doch tatsächlich keine reine Freude«, knurrte Hungold. »Da tut sich vor einem das Tor des Paradieses auf, und schon muß man feststellen, daß es wieder einmal nicht ohne die übliche Schlange ist. In diesem Falle heißt sie Gerswint von Hellersen«, schloß er hart.
»Papa, ich bitte dich!« rief die Tochter erschrocken, doch er winkte unwirsch ab.
»Laß nur, Mädel. Du bist doch daran gewöhnt, daß ich kein Blatt vor den Mund nehme. Oder willst du etwa leugnen, daß an deiner verpfuschten Ehe in erster Linie Fräulein von Hellersen schuld ist?«
»Aber Papa, doch nicht sie selber.«
»Letzten Endes doch sie«, beharrte er aber und wandte sich an den Baron, der mit seltsam finsteren Blicken nach dem Hause hinübersah.
»Ich weiß nicht, was dir einfällt, Papa«, sagte sie in einem Ton, der an die Ellen von einst erinnerte. »Ich habe doch gewiß keine Veranlassung, Fräulein von Hellersen aus dem Wege zu gehen. Außerdem gefällt es mir hier so gut, daß ich traurig wäre, wenn wir nicht hierherziehen würden.«
Ja, wenn das Mädel es so auffaßte, dann sah die Sache erheblich anders aus. Und als ihm auch noch die Gattin verriet, daß sie gerne hier leben möchte, da hatte er nicht mehr die Kraft, auf dieses idyllische Plätzchen zu verzichten.
»Außerordentlich gut gefällt es mir hier«, gestand er. »Schade, daß wir nicht das Haus besichtigen können, da es ja verschlossen ist. Wer ist eigentlich der Besitzer all der Herrlichkeit ringsum. Kennen Sie ihn, Baron?«
»Ach ja, so ungefähr«, entgegnete Hellersen lachend. Da ging dem alten Herrn ein Licht auf.
»Also Sie sind es? Das ist ja einfach großartig! Dann gehört das alles hier zu Waldwinkel?«
»Ganz recht, Herr Hungold.«
»Beneidenswerter Kerl.«
Der Chauffeur, den sein Herr unauffällig nach dem Schlüssel des Waldhauses geschickt hatte, kam soeben zurück, und nun konnte man das Haus besichtigen. Immer begeisterter wurde Papa Hungold und drang stürmisch darauf, den Kauf abzuschließen.
»Dazu muß man Ruhe haben, Herr Hungold«, erklärte der Baron vergnügt. »Zuerst werden wir bei mir zu Abend essen, denn der Hunger wirft mich fast um. Später können wir alles in Ruhe besprechen.«
Der Vorschlag fand vollen Anklang, und einige Minuten später hielt das Auto vor dem Schloß.
Mit heimlichem Vergnügen sah der Baron, einen wie tiefen Eindruck sein Besitz auf den alten Herrn machte, der mit ordentlich andächtigen Augen umhersah.
»Donnerwetter, ja«, sagte er dann verblüfft. »Ich habe in meinem Leben ja schon so mancherlei gesehen, aber dieses ist ganz einfach ein Märchenschloß. Und darin wohnen Sie beneidenswerter Sterblicher nun?«
»Jawohl, Herr Hungold.«
»Und wissen Sie auch, wie glücklich Sie sich schätzen müssen?«
»Auch das. Aber nun wollen wir hier nicht lange Reden halten, sondern uns das Schloß von innen ansehen. Darf ich bitten?«
Er schritt seinen Gästen voran die Freitreppe empor. Als sie die Halle betraten, war Hungold vor Andacht stumm, bis Harras auf ihn zusprang, ihn in Angst und Schrecken versetzte und hinterher Ilsetraut auftauchte und den guten Onkel Hungold mit Jubel begrüßte. Da fand der alte Herr sein Gleichgewicht wieder.
»Ich sage es ja, es ist ein Märchenschloß. Selbst das schwarze Ungetüm, das die Schätze bewacht, fehlt nicht; auch nicht das goldhaarige Elflein, auch nicht der Märchenprinz«, zwinkerte er Hellersen vergnügt zu und hob das kleine Mädchen auf den Arm, das sich zärtlich an ihn schmiegte.
»Großartig, Hummelchen, sofort hast du den Onkel wiedererkannt! Und wer ist das?«
»Die Tante Hungold.«
»Und das?«
Das Kind blickte Ellen lange an und schüttelte dann das Köpfchen.
»Kenne ich nicht.«
»So also hast du dich verändert, daß das Kind dich nicht wiedererkennt!« polterte der alte Herr los, und der Baron umfaßte beschwichtigend seine Schulter.
»Wird schon alles wieder besser werden, Herr Hungold«, tröstete er. »Passen Sie nur auf, das Waldhaus wird Wunder wirken.«
»Wollen’s hoffen«, brummte er, noch nicht ganz überzeugt, und verbeugte sich vor der Dame, die zögernd näher kam.
»Das ist unsere liebe Frau Widding, und dieses sind Herr Hungold mit Gattin und Tochter«, stellte der Schloßherr vor. Und dann, an die Hausdame gewandt: »Hat Franz die Gäste angemeldet, Frau Widding?«
»Sehr wohl, Herr Baron, es ist bereits angerichtet.«
Man ging nach dem »kleinen Speisesaal« hinüber, wo Edna, Bolko und Wieloff schon anwesend waren.
Als der Baron die Base den Gästen vorstellte, traf das Mädchen aus Hungoldschen Augen ein durchdringender Blick.
»Gerswint?« fragte er kurz.
»Nein, Edna heiße ich«, gab sie verwundert zurück, und er atmete erleichtert auf.
Es wurde ein sehr gemütliches Mahl.
Als danach alle in einem lauschigen Gemach beim Mokka saßen, die Herren rauchten und die Damen Süßigkeiten knabberten, kam Herr Hungold wieder auf das Waldhaus zu sprechen.
»Also, mein lieber Baron, das Haus gefällt mir so gut, daß ich es noch heute kaufe. Wollen Sie bitte den Kaufvertrag aufsetzen?«
»Verkäuflich ist das Häuschen leider nicht, Herr Hungold«, erklärte Hellersen bedauernd, »weil ich von dem, was mein Onkel mir hinterlassen hat, auch nicht das kleinste Stück veräußern möchte. Aber vermieten will ich es gern«, setzte er rasch hinzu, als er die sichtliche Enttäuschung des alten Herrn bemerkte. »Sie können darin wohnen, solange es Ihnen gefällt, können ganz wie in Ihrem Eigentum darin schalten und walten. Nur eben, daß es später wieder an Waldwinkel zurückfällt.«
Da hellte sich das Gesicht Hungolds wieder auf, und Frau Hungold, die um ihren Mann schon Angst ausgestanden, griff nach der Hand des Schloßherrn.
»Was sind Sie doch für ein guter Mensch, Herr Baron«, sagte sie leise. »Sie haben meinem Mann die Lust zum Leben wiedergegeben. Es sah trostlos bei uns aus.«
»Mutterchen, nun sprich nicht mehr davon, das ist alles gewesen«, winkte der Gatte lebhaft ab. »Wir müssen jetzt erst über die Zahlungsbedingungen einig werden. Also, lieber Baron, ich zahle Ihnen freiwillig hundertfünfzig Mark Monatsmiete für das verwunschene Waldschlößchen; einverstanden?«
»Na, hören Sie mal, Herr Hungold«, lachte Hellersen herzlich auf, »ich bin doch nicht etwa unter die Wucherer gegangen. Fünfzig Mark Monatsmiete und nicht einen Pfennig mehr.«
»Das ist aber doch der reinste Hohn!« entfuhr es Hungold. »Für meine jetzige Stadtwohnung, die doch nur ein armseliger Steinkäfig im Vergleich zu dem Waldhause ist, zahle ich einhundert Mark im Monat und habe dafür nur die bloße Wohnung, nicht noch einen Stall und zwei Morgen Land dazu.«
»Dafür wohnen Sie auch in der Stadt und nicht auf dem Lande, wo die Wohnungen immer billiger sind. Ich kann Ihnen doch nicht mehr abnehmen, als mir zukommt, Herr Hungold; da mache ich mich ja strafbar«, erklärte der Baron fest. »Also wer wird da wohl nachgeben müssen?«
Papa Hungold brummte etwas vor sich hin, ging dann aber auf die Forderung ein.
»Aber die Instandsetzung des Hauses bezahle ich«, behielt er sich vor, und damit war der Baron einverstanden. Man plauderte dann noch eine Weile, bis Hellersen seine Gäste in seinem Auto wieder zur Stadt bringen ließ.
Edna verabschiedete sich bald.
Die drei Herren saßen noch ein wenig zusammen.
»Sag mal, Swen, was für ein sonderbares Benehmen zeigte Herr Hungold eigentlich während der Vorstellung?« wollte Bolko wissen.
»Das wirst du begreifen, wenn ich erkläre, daß Herrn Hungolds Tochter die geschiedene Frau des Alf von Unitz ist.«
»Donnerkiel!« entfuhr es Bolko verblüfft. »Nun wird mir vieles klar. Man macht Gerswint dafür verantwortlich, daß die Ehe unglücklich wurde?«
»So ähnlich.«
Swen erzählte nun alles, was er vor einigen Stunden von Hungolds erfahren hatte. Als er geendet, schüttelte Bolko sich wie ein begossener Pudel.
»Brrr, mir ist tatsächlich so zumute, wie dem Reiter nach einem Bodenseeritt. Das ist ja eine nette Gefahr, der meine Schwester und ich da entronnen sind. Weißt du, Swen, zum erstenmal bin ich froh, daß Onkel Leopold uns nicht zu seinen Erben eingesetzt hat. So sind wir den Netzen der Geschwister Unitz wenigstens entglitten. Aber meiner lieben Mama, die uns ja durchaus mit ihnen verheiraten wollte, das Geschick der Familie Hungold so recht ausführlich zu schildern, das soll mir eine Wonne sein.«
*
»Gnädige Frau, vor der Haustür stehen ein paar Leute, die durchaus zu uns kommen wollen!« meldete die biedere Frieda ganz aufgeregt; aber Frau von Hellersen sah sie mißbilligend an.
»Frieda, daß Sie doch immer noch so unbeholfen sind. Wer sind sie denn, die mich zu sprechen wünschen?«
»Ich denke, die aus dem Nachbarhaus.«
»Und wo sind sie?«
»Na, draußen vor der Tür.«
»Es gibt Dinge, die Sie nie begreifen werden«, sagte Frau Elisa seufzend und beauftragte die bestürzte Frieda, die Besucher ins Wohnzimmer zu führen. Frieda war als Ersatz für Anna eingestellt worden.
Einige Minuten später begrüßte sie dann die Familie Hungold, die gekommen war, um ihren Antrittsbesuch zu machen. Gern taten sie es zwar nicht; sie hatten hin und her überlegt, ob das überhaupt nötig wäre. Aber die Häuser lagen so dicht beieinander, daß ein Begegnen unausbleiblich war, also hieß es sich überwinden. Wenn die Familie Hellersen einem durchaus nicht zusagte, brauchte man ja keinen Verkehr zu pflegen.
Und daß sie das nicht tun würden, stand sofort bei ihnen fest, als Frau Elisa ihnen gegenübertrat. Nein, das war keine Frau, mit der man warm werden konnte.
Die junge Dame, die nun eintrat, mußte wohl Gerswint sein. Man begriff nicht, wie Alf von Unitz an so viel eisiger Unnahbarkeit hatte Gefallen finden können.
Entzückend war das kleine Mädchen, das sich an die Mutter schmiegte. Aber das war ja auch noch ein Kind. Wenn es erwachsen war, würde es sicherlich genauso hochnäsig sein wie Mutter und Schwester.
Es wurden die üblichen höflichen Redensarten gewechselt; ob man den Umzug gut überstanden, sich in die neuen Verhältnisse schon ein wenig eingelebt hätte, wie ihnen der neue Wohnsitz zusage und andere Dinge mehr. Die Besucher empfahlen sich bald.
*
Bolko von Hellersen trabte auf seinem Gaul gemächlich dahin. Es war ein heißer Tag im Juni und die Heuernte in vollem Gange. Es ging daher hoch her in dem Betriebe. Man hatte so stramm zu tun, daß man kaum zur Besinnung kam. Das war sehr schwer für Bolko; oft mußte er die Zähne zusammenbeißen, um durchhalten zu können; denn in sein Nichtstuerleben zurückkehren wollte er jetzt noch weniger als zu Anfang seiner Lehrzeit. Zu sehr noch hatte er die zermürbende Langeweile in Erinnerung. Die war noch schwerer zu ertragen als hetzende Arbeit. Außerdem machte er so gute Fortschritte, daß der wirklich nicht leicht zufriedenzustellende Gort kürzlich zu Swen geäußert hatte, sein Eleve wäre so rasch vorangekommen, daß er schon zur Not einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten könnte, leichter und besser jedenfalls als mancher Landwirt. Bolko hatte es gehört. Das war ein Ansporn gewesen, der ihm die Arbeit leichter werden ließ. Und schließlich – die anderen arbeiteten doch auch und machten gar kein Aufhebens davon. Ihnen war die Arbeit überhaupt eine Selbstverständlichkeit. Swen war der Tüchtigste von allen, arbeitete unverdrossen tagaus, tagein und fühlte sich noch wohl dabei. Wie würde er wohl vor ihm dastehen, wenn er mutlos die Arbeit hinwerfen wollte? Nein, dann lieber weitergeschuftet; die Lehrjahre würden ja auch einmal ein Ende nehmen, dann kamen auch leichtere Tage für ihn.
Er ritt zum Gutshof hin, wo er absaß und nach dem Schloß und in sein Zimmer eilte. Er mußte sich mit dem Umkleiden sehr beeilen, damit er zur Mittagstafel nicht zu spät kam; er war knapp fertig, als auch schon der Gong das Schloß durchhallte.
Im Speisesaal war es angenehm kühl, und die vortreffliche Frau Widding ließ nur solche Speisen auftragen, die an heißen Tagen angebracht waren. Und nicht nur Edna allein sog nach Tisch mit großem Behagen durch den Halm an ihrem Eiskaffee, sondern auch die Herren ließen ihn sich gut schmecken, weil er sie erfrischte.
Nach dem Essen bat Edna den Baron um ein Gespräch.
»Schau, ich finde es so schön auf dem Lande, daß ich nicht mehr in der Stadt leben möchte. Wenn es durchaus nicht anders geht, dann müßte ich es ja. Aber glücklich und zufrieden könnte ich mich dort nimmermehr fühlen.«
»Wer mir das vor einem halben Jahr gesagt hätte, dem hätte ich glatt ins Gesicht gelacht«, erklärte Hellersen kopfschüttelnd. »Aber ich freue mich über dich, Mädel, unbeschreiblich.«
»Na, siehst du, Swen«, lachte sie verlegen. »Und daher wirst du verständig sein, wenn ich dir nun erkläre, daß ich umsatteln und mich als Wirtschaftslehrling unter Frau Minnas und auch Frau Widdings Fittiche begeben möchte. Nicht, weil ich meiner bisherigen Arbeit überdrüssig bin, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, was lernen zu können. Kannst du mir diesen Wunsch nicht erfüllen, dann will ich ohne Murren eine Lehrstelle in der Stadt annehmen. Alles will ich tun, Swen, alles, nur nicht wieder in die Ungemütlichkeit des Waldhauses zurückkehren.«
»Bravo!« lobte der Vormund erfreut. »Du gefällst mir von Tag zu Tag immer besser, Kleine. Aber weißt du auch, daß die Lehrzeit unter Frau Minna noch anstrengender sein wird als die unter Wieloff?«
»So arg wird es nicht werden, Swen. Frau Minna ist gut und einsichtsvoll, und Frau Widding ist die Güte und Liebe selbst. Ich wünschte, die Mama wäre wie sie«, setzte sie mit schmerzlichem Seufzer hinzu. »Jedenfalls sind beide nicht so streng und unerbittlich wie der Herr Sekretär. Von ihnen werde ich wenigstens ein liebes, aufmunterndes Wort, vielleicht sogar ab und zu eine Anerkennung zu hören bekommen und als Mensch, nicht bloß als Arbeitsmaschine angesehen werden – wie bei diesem schwierigen Herrn. Weißt du, was er ist, Swen? Ein eingebildeter Affe.«
»Damit dürfte dein Urteil über den Armen sich vollends erschöpft haben«, lachte Swen herzlich. »Und nun wollen wir feststellen, wie sich Frau Minna als Lehrmeisterin entpuppen wird.«
»So bist du einverstanden, Swen?«
»Aber sehr, Mädel. Zumal du von dem ganzen Schreibkram nun schon das Notwendigste gelernt hast. Dringe nun also in die Obliegenheiten einer Hausfrau ein, damit man dir später, wenn du selbst eine bist, keinen blauen Dunst vormachen kann. Ich werde mit Frau Widding sowie mit Frau Minna Rücksprache nehmen und glaube nicht fehlzudenken, wenn sie dich gern unter ihre Fittiche nehmen werden.«
So kam es, daß aus dem Schreiberlehrling Edna ein Hauswirtschaftslehrling wurde, was ihr viel mehr zusagte, weil die beiden Frauen, denen sie unterstellt war, immer den rechten Ton für die eigenwillige Kleine fanden. Und der Vormund, der dem Lehrwechsel seines Mündels anfangs doch mit einigen Bedenken gegenübergestanden hatte, atmete erleichtert auf.
*
»Sehen Sie, Friedchen, der Schatz hat wieder nicht geschrieben, dem müssen Sie doch nun wirklich den Laufpaß geben«, neckte der forsche Landbriefträger das Mädchen, das in der Küche des Waldhauses stand und das Frühstücksgeschirr aufwusch. »Nehmen Sie doch lieber mich.«
»Nun hören Sie aber auf! Ein Kerl mit Frau und fünf Kindern!« tat Frieda entrüstet, und ihre Augen lachten. »Reden Sie nicht immer so’n dummes Zeug, rücken Sie lieber mit Ihrem Segen heraus!«
»Wenn Sie so stürmisch werden, muß ich es ja wohl«, schmunzelte der Mann und reichte ihr einen Brief, den sie errötend in Empfang nahm und rasch in die Schürzentasche steckte.
»Und hier ist noch ein Brief für Ihre Gnädige. Sogar ein Einschreibebrief. Sie muß hier unterschreiben.«
Frieda griff schnell nach dem Brief und drehte ihn nach allen Seiten.
Ihre Herrschaft bekam doch so selten Briefe – und nun gar noch so einen, wo man unterschreiben mußte?
»Neugierig sind Sie ja nicht, Friedchen«, lachte der Briefträger hinter ihr her, als sie hinter der Tür verschwand, um das wichtige Schreiben abzuliefern.
Frau Elisa schien der Brief nicht weniger in Erstaunen zu setzen; denn auch sie drehte ihn nach allen Seiten, ehe sie den Zustellungsschein unterschrieb. Und während Frieda zufrieden davontrollte, riß ihre Herrin hastig den Umschlag auf, überflog die wenigen Zeilen des Briefes.
»Ja, was will der denn wieder von uns?« sagte sie, unangenehm berührt, zu Gerswint, die mit einer Handarbeit am Fenster saß und jetzt gespannt zur Mutter hinübersah. »Hier schreibt Justizrat Glang, daß wir uns am 23. September, also morgen, um elf Uhr im Schloß einfinden sollten. Wirst du daraus klug?«
»Nein«, gestand Gerswint. »Vielleicht will man uns zusammentrommeln, um uns neue Maßregeln für unsere Lebensweise zu geben. Sicherlich leben wir noch zu üppig, und man will uns die Rente schmälern, weil doch Edna und Bolko jetzt ganz aus dem Hause sind und Elke sich eigentlich nur noch zum Schlafen hier einfindet, also auch gewissermaßen im Schloß verpflegt wird.«
»Du magst recht haben«, nickte Frau Elisa nun schon ganz gottergeben. »Man ist ja schon daran gewöhnt, daß aus dem Schloß für uns nichts Gutes kommt.«
»Wirst du der Aufforderung Folge leisten, Mama?« fragte Gerswint bang. Die Mutter nickte.
»Ich werde ja wohl müssen. Übrigens gilt die Aufforderung auch für dich und Elke. Weißt du, was ich annehme? Daß morgen eine Gedenkfeier für Onkel Leopold stattfinden soll; morgen ist doch sein Todestag.«
Ach ja, Frau Elisa hatte in dem einen Jahr viel gelernt, hauptsächlich das Geld schätzen. Sie konnte es einfach nicht mehr fassen, wie sie es früher fertigbekommen hatte, das Geld so unsinnig zu vergeuden, überhaupt so gedankenlos in den Tag hineinzuleben. Es war zwar eine harte Schule gewesen, durch die sie im letzten Jahr hatte hindurchgehen müssen; aber heilsam war sie doch gewesen.
Jedenfalls betrat Frau Elisa am nächsten Tage das Arbeitszimmer des Verewigten, das jetzt das Arbeitszimmer des Barons war, viel zuversichtlicher und zufriedener, als sie es vor einem Jahr verlassen hatte.
Alles war genauso wie damals, nur daß die Dienerschaft und Sanitätsrat Melch heute nicht anwesend waren. Man nahm sogar wieder dieselben Plätze ein, und auf dem Tisch stand wieder das mit Kerzen umstellte Bild Leopold von Hellersens.
Justizrat Glang war wieder sehr ernst und amtlich. Und doch war das, was er heute vorlas, so ganz, ganz anders als das im Vorjahre. Frau Elisa las dem Anwalt die Worte förmlich von den Lippen:
Liebe Schwägerin Elisa, liebe Nichten und lieber Neffe!
Wenn Euch im letzten Jahre vieles unerklärlich erschienen sein mag, so ist jetzt die Stunde gekommen, da Ihr Aufklärung erhalten sollt. Ohne daß Ihr es wißt, habt Ihr ein Probejahr hinter Euch, und ich hoffe und wünsche zuversichtlich, daß Ihr es gut bestanden habt und nun fähig genug seid, Euer Erbe, das auf meinen Wunsch heute erst vertrauensvoll in Eure Hände gelegt wird, in meinem Sinn verwalten zu können. Mein Neffe, Swen von Hellersen hat von mir den Auftrag erhalten, in dem Probejahr über Euer Leben zu wachen und Euch, von Euch selbst unbemerkt, auf einen Weg zu führen, der allein eines Menschen würdig ist: auf den Weg der Arbeit und der Pflicht! Ihr sollt lernen, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Dann erst werdet Ihr es zu schätzen wissen und es nicht gewissenlos vergeuden. Ihr sollt zu der Erkenntnis kommen, daß im Leben der Mensch gilt, nicht sein Name und Stand. Wer wirklich vornehm ist, dessen Vornehmheit wird immer von seinen Mitmenschen anerkannt werden, ohne daß es immer und überall hervorgehoben werden muß. Ich bestehe darauf, daß Swen von Hellersen Ednas und Elkes Vormund bleibt, weil ich weiß, daß die Mädchen in seinem Schutz gut geborgen sind.
Swen von Hellersen ist es auch, der darüber entscheiden wird, ob Ihr Euer Probejahr bestanden habt. Im verneinenden Falle fällt meine ganze Hinterlassenschaft an ihn, Baron Swen von Hellersen. Und meine Schwägerin, Frau Elisa von Hellersen, und ihre vier Kinder sind dann mit dem Erbe, das sie bereits vor einem Jahre angetreten, restlos abgefunden. Denn es geht nicht an, daß leichtfertige Verschwender und dünkelhafte Nichtstuer Herrenrechte übernehmen, denen sie nicht gewachsen sind. Ich habe nicht mein Leben lang in rastloser, mühevoller Arbeit Werte geschaffen und aufgebaut, um sie in kurzer Zeit von gewissenlosen Händen niederreißen zu lassen. Sollte jedoch Swen von Hellersen Frau Elisa und ihre Kinder als würdig genug erachten, ihr Erbe anzutreten, und fähig, es in meinem Sinne zu verwalten, so vermache ich, Leopold von Hellersen, aus meiner Hinterlassenschaft wie folgt:
1. Frau Elisa von Hellersen geborene von Ortleff einhunderttausend Mark, über die sie freie Verfügung hat. Außerdem geht das Waldhaus in ihren alleinigen Besitz über.
2. Meinem Neffen Bolko von Hellersen das schuldenfreie Rittergut Hirschhufen mit dem darauf ruhenden Vermögen und den dazugehörigen Vorwerken.
3. Meiner Nichte Edna von Hellersen das schuldenfreie Gut Lützen mit dem darauf ruhenden Vermögen und den dazugehörigen Vorwerken. Das Erbe wird bis zu ihrer Volljährigkeit von ihrem Vormund, Baron Swen von Hellersen, verwaltet.
4. Meiner Nichte Elke von Hellersen das schuldenfreie Gut Wallen mit dem darauf ruhenden Vermögen und den dazugehörigen Vorwerken. Das Erbe wird bis zu ihrer Volljährigkeit von ihrem Vormund, Baron Swen von Hellersen, verwaltet. Aus dem Gut sollen jeden Monat zweihundert Mark Erziehungsgelder für die Erbin gezogen und an Frau Elisa von Hellersen gezahlt werden.
Von meiner Nichte Gerswint von Hellersen erwarte ich, daß sie mir meinen dringenden Wunsch erfüllen und die Werbung, die auf meinen Wunsch von Baron Swen von Hellersen zu erfolgen hat, nicht ausschlagen wird. Sie soll seine Gattin werden, damit wieder ein schönes, gesundes und starkes Geschlecht auf dem Stammsitz der Hellersen erblühe. Sollte sich meine Nichte Gerswint jedoch nicht dazu entschließen können, mir meine Bitte zu erfüllen und die Gattin Baron von Hellersens zu werden, so will ich sie nicht dazu zwingen und bestimme für sie ein Erbteil von einhunderttausend Mark.
Damit schließe ich und wünsche jedem von Euch ein glückliches Leben und ein segensreiches Schaffen.
Leopold von Hellersen.
Der Anwalt schwieg einen Augenblick, und sein Blick ging zu Wieloff hin, der teilnahmslos auf seinem Stuhl saß. Als der Justizrat ihn ansprach, fuhr er nervös zusammen.
»Herr Wieloff, was ich jetzt verlese, betrifft Sie.«
Er griff nach einem neuen Dokument, und wieder setzte die ernste, streng-amtliche Stimme ein:
Ich, Leopold von Hellersen, vermache aus meiner Hinterlassenschaft meinem langjährigen und treuen Mitarbeiter Roger Wieloff ein Erbe von hunderttausend Mark, die er sich in meinen anstrengenden Diensten redlich verdient hat. Ich wünsche ihm, daß sein Leben noch einmal froh und glücklich werden möge.
Leopold von Hellersen.
Jetzt erst schwieg die strenge Stimme ganz, und tiefe Stille herrschte im Raume. Die Augen Frau Elisas und ihrer Kinder hingen voller Angst und Erwartung an dem unbeweglichen Antlitz des Barons; denn er hatte ja das letzte und entscheidende Wort zu sprechen.
Er erhob sich von seinem Sitz, fuhr sich einige Male hastig über Stirn und Augen und wandte sich dann mit einer Verbeugung an Frau Elisa, die wie leblos in ihrem Stuhl lehnte.
»Liebe Tante Elisa! Soeben hat noch einmal der Mann zu uns gesprochen, der nur unser aller Bestes im Auge gehabt hat. Mir hat er mit einem reichen Erbe zugleich eine schwere Verantwortung auf meine Schultern geladen, die ich im vergangenen Jahre mehr als einmal gar drückend und quälend gespürt habe.
Wie oft habe ich mich voll banger Zweifel gefragt: Werden sie es schaffen, werden sie ihr Probejahr so bestehen, daß ich am Abschluß ihnen ruhigen Gewissens ihr Erbe in die Hände geben kann?
Aber heute weiß ich, daß ich es kann, und sage Gott sei Dank!
Denn du, Tante Elisa, hast dich bemüht, mit dem wenigen auszukommen, das dir Onkel Leopold aussetzte, obgleich du früher mit ganz anderen Summen zu rechnen gewohnt warst. Du hast auch tapfer das Leben im Waldhause ertragen, das dir nach dem Großstadtleben doppelt eintönig erscheinen mußte.
Du hast auch arbeiten gelernt; denn dein Hausstand ist in tadelloser Ordnung, was man wohl kaum deiner unbeholfenen Hausgehilfin allein zuschreiben kann. Also hast du die Probe bestanden.
Du Bolko, hast arbeiten gelernt, was dir nach dem verwöhnten Nichstuerleben sauer genug fiel. Du hast in dem einen halben Jahr mehr gelernt als mancher andere während seiner ganzen Lehrzeit.
Du, Edna, hast Pflichten übernommen, die dir alle Ehre machen. Hast es sogar aus dir selbst heraus getan, was um so anerkennenswerter ist.
Und Elke ist ein gewissenhaftes kleines Mädchen, das später bestimmt eine gute Gutsherrin und Hausfrau abgeben wird.
Das ist, was ich euch zu sagen habe.«
»So halten Sie die Erben für berechtigt, ihr Erbe anzutreten, Herr Baron?« fragte der Anwalt in amtlichem Ton, und Swen antwortete mit einem festen »Ja!«
Dann eilte er auf Frau Elisa zu, die noch immer erschreckend blaß war, und beugte sich über ihre Hände, die sie ihm entgegenstreckte.
»Swen, wenn du dich auch nur ein klein wenig mit uns freust, dann vergib und vergiß«, bat sie mit zuckenden Lippen, und in seinen Augen leuchtete es auf.
»Aber gern, Tante Elisa, von Herzen gern«, entgegnete er und drückte gleich darauf Edna an sich, die ihm ganz einfach um den Hals fiel.
»Swen, mein Gott, Swen! Ich verliere noch den Verstand vor Glückseligkeit!« jubelte sie. »Ich bin die Herrin von Lützen?«
»Wovon wir dankend Kenntnis genommen haben«, meinte Bolko trocken in ihren Jubel hinein, schob sie zur Seite und streckte dem Vetter beide Hände entgegen, die so merkwürdig bebten.
»Wie mir zumute ist, kann ich nicht beschreiben, Swen, du Guter«, sagte er mit einer Stimme, der man seine Erregung anmerkte. »Was wären wir jetzt, wenn du nicht selbstlos für uns gesorgt und dich unser angenommen hättest. Wieviel, wie grenzenlos viel haben wir alle dir abzubitten.«
»Bolko, Bengel, werde nicht rührselig!« sagte Swen und hatte doch selbst Mühe, seine Rührung zu verbergen. »Was habe ich viel getan? Ihr habt mir ja alles leicht gemacht.«
»Na, ich danke«, zweifelte Bolko. »Ein prachtvoller Kerl bist du. Ich glaube, ich könnte mich ohne Muck für dich totschlagen lassen.«
»Nur ja nicht«, lachte der Baron herzlich, meinte dann aber wieder sehr ernst: »Wenn ich dir einen Rat geben darf, Bolko: Gehe unbeirrt den Weg weiter, den du so tapfer beschritten hast. Lerne weiter, lerne immerzu! Hirschhufen hat einen ganz vorzüglichen Verwalter, der dir gerne beibringen wird, was er selbst weiß, und das ist gewiß nicht wenig.«
»Swen, ich kann ja gar nicht anders, als diesen Weg weitergehen; sonst würde ich mich ja meines Erbes unwürdig zeigen.
Aber jetzt will ich unser Nesthäkchen zu dir lassen; es scheint mächtig viel auf dem Herzen zu haben«, lachte er und machte der kleinen Schwester Platz, die stürmisch zu ihrem Vormund drängte.
»Sag, Swen, Wallen gehört mir, mir ganz allein?« fragte sie aufgeregt. »Und muß ich nun auch dorthin ziehen und ganz allein dort wohnen?«
»Bis du das kannst, werden immerhin noch einige Jährchen vergehen, du kleinste Herrin«, lachte der Baron. »Zuerst wirst du mal im Schulunterricht fleißig lernen. Und bis du soviel kannst, wie du als Gutsherrin brauchst, dürftest du bereits eine heiratsfähige junge Dame geworden sein. Dann nimmst du dir einen Mann.«
»Und der muß dann tun, was ich will?« fragte sie immer aufgeregter und konnte nicht begreifen, warum alle so lachten.
»Du nimmst dir ja viel vor, Kleines«, schmunzelte der Baron und wandte sich dann an Gerswint, die gleichmütig in ihrem Stuhl lehnte, während alles um sie her in freudigster Erregung war. Was ist das nur für ein sonderbares Menschenkind, schoß es ihm durch den Sinn. Schön und kaltherzig wie eine Seejungfrau. Und sie soll ich nun heiraten?
Brüsk wandte er sich ab.
Nein, es war ihm jetzt nicht möglich, zu ihr zu gehen. Er würde sich zu Worten hinreißen lassen, die besser ungesagt blieben. Also freute er sich weiter mit den andern. Hielt dann später, als sich alle ein wenig beruhigt hatten, eine sehr stimmungsvolle Gedenkfeier für den Verstorbenen ab und führte dann alle Anwesenden in den Speisesaal, wo ein Festessen auf sie wartete.
*
Swen von Hellersen rüstete sich zu einem Gange, vor dem er sich geradezu fürchtete.
Wenn er auch ein Jahr Zeit gehabt hatte, sich mit dem Gedanken abzufinden, Gerswint zu seiner Frau zu machen, so hatte er sich immer noch nicht so weit überwinden können, mit Gleichmut sich in das Unabänderliche zu fügen.
Ich hoffe, Swen, daß es Dich nicht zu große Überwindung kosten wird, Gerswint zu heiraten, hieß es in dem Brief, den Leopold von Hellersen seinem Neffen hinterlassen hatte. Ich wüßte nämlich kein weibliches Wesen, das sich besser als Herrin von Waldwinkel und Mutter Deiner späteren Kinder eignen würde als gerade die kühle, schöne Gerswint. Ich habe ihren Werdegang mit Interesse verfolgt und kann Dir daher mit ruhigem Gewissen sagen, daß Du keine Unwürdige zu Deiner Gattin machen wirst. Ist Gerswint auch hochmütig und kühl, so ist sie doch gesund an Leib und Seele. Ist eine echte Ortleff, die nie vergessen wird, daß sie diesem Geschlecht entstammt, aus dem, bis auf wenige Ausnahmen, nur untadelige Menschen hervorgegangen sind. Und Du, mein lieber Junge, vergiß darum nicht, daß Du ein echter Hellersen bist, denen die Pflicht gegen ihr Geschlecht stets heilig war.
O nein, das würde Swen wohl nie vergessen! Es fiel ihm auch gar nicht ein, die Bestimmung des Onkels als Härte zu empfinden, dazu besaß er viel zuviel Ehrfurcht vor dem Verstorbenen und den alten Überlieferungen seines Geschlechts.
Er persönlich würde mit seiner Ehe ja auch ganz gut fertig werden. Wenn sich sein Herz immer wieder schmerzlich zusammenzog, dann geschah es hauptsächlich wegen Ilsetraut. Er hätte seiner zärtlichen Kleinen eine andere Mutter gewünscht als gerade die hochmütige, gefühlsarme Gerswint. Swen konnte sich nicht denken, daß sie eine gute Mutter sein würde, geschweige denn eine gute Stiefmutter.
Schnell und hastig, als dürfe er keine Minute mehr verlieren, ging er nach dem Waldhause hinüber, wo er Frau Elisa antraf, deren Blick unauffällig über seine feierliche Kleidung glitt.
»Tante Elisa, kann ich Gerswint sprechen?«
»Bitte, ich werde sie sofort verständigen.«
Das war aber nicht mehr nötig, denn das Mädchen trat soeben ein – sehr blaß, sehr kühl und hochmütig. Hellersen sprang auf, um die Base zu begrüßen, beugte sich über ihre Hand und erschrak vor deren Eiseskälte. Frau Elisa verließ leise das Zimmer, und die beiden jungen Menschen standen sich allein gegenüber.
»Gerswint, ich bin gekommen…«, begann der Mann mit belegter Stimme. Doch sie winkte kurz ab, wies ihm einen Sitz an, indem sie ihm gegenüber Platz nahm.
»Ich weiß ja, warum du gekommen bist, Swen«, versetzte sie in gewohnter Gelassenheit. »Daher wäre es lächerlich, wenn ich dich erst viele Worte machen ließe.«
»Und wie hast du dich entschlossen, Gerswint?«
»Ich bin selbstverständlich bereit, mich der Bestimmung des Onkels zu fügen.«
Also doch! Es war, als drücke eine unsichtbare Hand ihm die Kehle zu, als würde er gefesselt an Händen und Füßen. Er biß die Zähne zusammen, und ein rascher Blick ging über das Mädchen hin, das ihn mit unverhohlenem Spott ansah.
Wie konnte er sich auch nur so gehen lassen. Gerswint mußte ihm seine Gedanken ja förmlich vom Gesicht ablesen.
Er riß sich mit aller Kraft zusammen und hätte in die Erde sinken mögen vor Scham, als das schöne Mädchen nun in Worte faßte, was er soeben gedacht und empfunden hatte.
»Ich weiß, Swen, mein Entschluß enttäuscht dich«, sagte Gerswint in fast geschäftsmäßigem Ton. »Du hast sicherlich immer noch gehofft, daß ich das ausgesetzte Geld einer Ehe mit dir vorziehen würde. Aber das kann ich nicht, Swen. Ich könnte, lehnte ich mich gegen die Bestimmung des Onkels auf, das Gefühl nicht loswerden, ein Unrecht zu begehen. Ich habe ganz einfach nicht den Mut dazu, mich über seinen Willen hinwegzusetzen«, bekannte sie mit einer Offenheit, die ihn überraschte. »Wenn du jedoch den Mut dazu hast…«
»Um Himmels willen, Gerswint, nur keine Mißverständnisse aufkommen lassen!« unterbrach er sie in dringendem Ton. »Mir ist der Gedanke, das Gebot des Onkels zu übergehen, auch nicht einmal gekommen. Ich kann doch unmöglich auf seinem hinterlassenen Besitz leben und seine Wünsche übergehen.
Außerdem hat Onkel Leopold es dir allein überlassen, zwischen dem ausgesetzten Geld und einer Ehe mit mir zu wählen. Ich bin gar nicht um meine Meinung gefragt worden. Von mir hat der Onkel es als selbstverständlich angenommen, daß mir sein Wunsch heilig ist. Und da du entschlossen bist, dich mir anzuvertrauen, so ist ja alles geklärt.
Also schlag ein, Gerswint! Je mehr Geduld wir miteinander haben, um so friedlicher wird sich unsere Ehe gestalten.«
»Und je weniger wir voneinander erwarten, um so weniger wird sie uns enttäuschen«, setzte sie mit tiefem Spott hinzu. Er hatte Mühe, einen Seufzer zu unterdrücken, und beugte sich über die Hand, die zart und fein in der seinen lag.
»Ich danke dir, Gerswint, meine kleine Braut«, sagte er herzlich und sah, wie sie zusammenzuckte und tief erblaßte. Er war froh, als Frau Elisa das Zimmer betrat; denn er hatte das Gefühl, in den letzten Minuten eine nicht eben glänzende Rolle gespielt zu haben.
»Wie ich sehe, seid ihr einig, Kinder«, sagte sie wärmer, als man es an ihr gewohnt war. »Laßt euch alles Glück der Erde wünschen.«
Sie umarmte die Tochter und reichte Swen die Hand, über die er sich ehrfürchtig neigte.
»Liebe Tante Elisa – oder vielmehr, liebe Mama, du hättest gewiß einen anderen lieber an Gerswints Seite gesehen und bist nun…«
»Du täuschst dich, Swen«, unterbrach sie ihn ruhig. »Ich habe dich im letzten Jahr erst richtig kennengelernt und weiß daher, daß Gerswint gut bei dir aufgehoben sein wird. Außerdem ist es für mich eine Genugtuung, daß meine Tochter es ist, die in Waldwinkel als Herrin einziehen wird. Ich glaube, Onkel Leopold wußte genau, was er tat, als er euch füreinander bestimmte.«
»Das glaube ich auch, Mama. Wir alle sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Und wir können seiner nicht dankbarer gedenken, als daß wir alles, was er für uns bestimmte, von Herzen gutheißen.
Zu seiner Bestimmung gehört nun auch, daß Gerswint mir noch in diesem Jahr angetraut wird. Und so wollte ich dich sowie meine Braut fragen, ob ihr damit einverstanden seid, daß die Hochzeit schon in drei Wochen stattfindet.«
»So bald schon, Swen?«
»Wir haben keinen Grund, die Hochzeit aufzuschieben, Mama. Eine Aussteuer, deren Anschaffung ja immer viel Zeit in Anspruch nimmt, braucht Gerswint nicht mit in die Ehe zu bringen, da sie im Schloß alles in überreichlichem Maße vorfindet. Und ihre persönlichen Anschaffungen kann sie gut in dieser Zeit bewältigen. Ich möchte, daß wir Weihnachten schon wieder von der Hochzeitsreise zurück sind. Was meinst du zu dem allem, Gerswint?«
»Ich bin damit einverstanden, Swen, und wüßte nicht, warum Mama etwas dagegen haben sollte.«
»Das wüßte ich auch nicht, mein Kind«, fiel Frau Elisa ein. »In drei Wochen läßt sich schon vieles ausrichten. Wenn wir in den nächsten Tagen nach Berlin fahren, können wir in aller Ruhe sehr gut alles Erforderliche für dich aussuchen.«
»Die Kosten dafür trage ich selbstverständlich, Mama.«
»Nein, Swen«, wehrte sie ganz entschieden ab. »Du mußt dich schon damit abfinden, daß ich meine Tochter selbst ausstatte.«
»Es ist mir aber nicht recht, daß du es von deinem Gelde nimmst, Mama«, beharrte er. »Dir bleibt ohnehin nicht viel.«
Ein Zug trat in ihr Gesicht, den er sich nicht zu deuten wußte, ein Gemisch von Bitterkeit und Ironie.
»Lieber Swen«, begann sie in ihrer gelassenen Art. »Im vergangenen Jahre haben sämtliche Bewohner des Waldhauses – in den ersten Monaten wenigstens – mit zweihundertfünfzig Mark monatlich auskommen müssen. Jetzt steht mir an Zinsen fast das Doppelte allein zur Verfügung, da Elke ja ihre Erziehungsgelder bekommt und Edna und Bolko glänzend versorgt sind. Also wird es mir weiter nicht schwerfallen, Gerswint wenigstens für ihren persönlichen Bedarf auszustatten.«
Der Baron mußte ihr recht geben und hielt es daher für angebracht, kein Wort mehr über die Angelegenheit zu verlieren! Er wechselte daher das Gespräch und erkundigte sich, wie die Damen über die Verlobungsfeier dächten.
»So klein und ruhig wie möglich soll sie begangen werden, da Onkel Leopold ja erst in zwei Tagen ein Jahr unter der Erde liegt«, erklärte Gerswint, und die Mutter nickte bekräftigend dazu. »Hungolds werden wir allerdings bitten müssen, denn sie würden sich mit Recht übergangen fühlen.«
»Das ist ein vernünftiger Entschluß, Gerswint«, atmete Hellersen tief auf. »Um so glänzender wird unsere Hochzeitsfeier ausfallen; auch das hat Onkel Leopold bestimmt. Waldwinkel soll wieder die gesellige Stätte werden, die es zu Lebzeiten seines Vaters gewesen ist. Ich werde also Familie Hungold bitten, daß sie am Nachmittag im Schloß erscheint.«
*
»Da überstürzen sich also die Ereignisse nur so in unserer allernächsten Nähe, und wir haben keine Ahnung davon«, schmunzelte Papa Hungold, als er die Familie Hellersen im Schloß begrüßte. »So werde ich langsam mit meinen Glückwünschen rausrücken; denn hier muß ja jeder einzeln beglückwünscht werden.«
Ilsetraut betrat das Zimmer. Sie trug ein Festkleidchen und hielt in der einen Hand einen Rosenstrauß, während die andere im Halsband Harras’ steckte. Das Kind sah sich mit einer an ihm fremden Schüchternheit im Kreise um.
»Komm her, mein kleines Mädchen«, sagte der Vater zärtlich. »Begrüße deine neue Mutter. Sage ihr, daß du immer brav und folgsam sein willst.«
»Mutter?« sagte das Kind wie träumend und sah den Vater zweifelnd an. »Ich habe wirklich eine Mutti wie andere Kinder auch?«
»Ja, mein Liebchen«, bestätigte er mit einer Stimme, die nicht ganz klar klang. »Schau mal, dort sitzt sie. Geh und mach hübsch artig deinen Knicks?«
»Aber der Harras auch?«
»Wenn es sein muß.«
Ilsetraut nickte, zog ihren vierbeinigen Spielgefährten zu der neuen Mutter hin und war erst zufrieden, als dieser seine dicke Pfote in die schlanke Hand Gerswints gelegt hatte.
»Streichele ihn doch, Mutti, dann wird er dich nicht beißen. Muttis dürfen nicht gebissen werden, das weiß Harras auch.«
Erst als der Hund gestreichelt war, duldete das Kind, daß er sich zu Füßen seines Herrn streckte. Dann wandte es sich der neuen Mutter zu und sah sie aus den wunderschönen Kinderaugen unentwegt an.
»Du bist meine Mutti?«
»Ja, Ilsetraut.«
Sie reichte Gerswint den Strauß.
»Der ist vom Papi. Schau mal nach, da steckt noch was drin.« Und schon hatte sie aus den Blumen eine Kette gezogen, deren Kostbarkeit Gerswint mit einem Blick erfaßte.
»Die ist auch von Papi. Komm, ich will sie dir umbinden.«
Mit ihren dicken Patschen mühte sie sich, die Kette um den schlanken Nacken der Mutter zu legen.
Als ihr das gelungen war, mußte Gerswint wieder einen langen Blick über sich ergehen lassen. Dann ein abgrundtiefer Seufzer, ein Nicken des lockigen Köpfchens.
»Du siehst viel schöner aus als die anderen Muttis alle. Keiner hat so eine schöne Mutti wie ich. Ich will dich liebhaben.«
»Na also«, bekräftigte Papa Hungold, der genau wie die anderen die Annäherung zwischen Mutter und Tochter mit atemloser Spannung beobachtet hatte.
»Also scheint das Töchterlein Ihre Wahl zu billigen, Baron«, schmunzelte der alte Herr und hatte sein Vergnügen daran, es rot auf der Stirn des Mannes aufflammen zu sehen. Hellersen zog seine Tochter hastig zu sich heran – wie es schien, um seine Verlegenheit zu verbergen.
»Hummelchen, du mußt jetzt wieder zu deinem Fräulein oder zur Barbe zurückkehren.«
»Ach, Papi, Papilein«, schmeichelte die Kleine. »Nur einmal auf Muttis Schoß sitzen will ich.«
»Kind, das ist doch unmöglich! Schau doch mal, ein wie schönes Kleid die Mutti anhat. Du würdest es ihr verderben.«
»Schadet nichts«, lachte das Kind unbekümmert. »Dann kaufst du ihr ein neues.«
Und schon war sie bei der Mutter, die sie lächelnd auf den Schoß hob.
»Mutti, ich will dir doch nur einen Kuß geben«, schmeichelte das Kind und drückte ihr Mündchen auf Gerswints Lippen. »Darf ich noch ein wenig hier sitzen, Mutti?«
»Wenn du magst, Ilsetraut.«
»Siehst du, Papi, die Mutti hat’s erlaubt«, lachte die Kleine zum Vater hin und setzte sich auf der Mutter Schoß zurecht.
»Aha, Baron, abgesetzt sind Sie jetzt«, lachte Papa Hungold behaglich. »Die erste Stelle nimmt jetzt die Mutti ein.«
»Das scheint mir fast so«, lächelte Swen und wandte sich seiner Braut zu.
»Das Kind ist dir doch nicht lästig, Gerswint?« fragte er beunruhigt; aber sie sah ihn verwundert an.
»Wie kommst du auf diesen Gedanken, Swen? Ich weiß doch, daß ich an diesem Kinde Mutterstelle vertreten muß.«
Das klang so einfach, so selbstverständlich, daß der Baron die Lippen beschämt auf die feine Hand drückte, die seit heute seinen Verlobungsring trug.
*
Die Wochen bis zur Hochzeit waren schnell vergangen. Erst zwei Tage vorher kehrten Frau Elisa und Gerswint von Berlin zurück. Sie waren vergnügt wie schon lange nicht und schienen die vorwurfsvollen Blicke des Barons, mit denen er sie im Waldhause begrüßte, nicht zu sehen.
»Es ist doch dem Menschen recht bekömmlich, wenn er hin und wieder Großstadtluft genießt«, sagte Frau Elisa, als sie am Abend mit ihren Kindern – selbst Edna und Bolko waren dabei – zusammensaß.
»Du hast ja jetzt die Mittel, wieder in die Großstadt zu ziehen, Mama«, bemerkte Swen kühl. Allein Frau Elisa winkte lächelnd ab.
»Das will ich ja gar nicht. Ich habe mich im Gegenteil im Trubel Berlins nach dem stillen Waldhause gesehnt. Ja, mein lieber Swen, man wird eben alt«, setzte sie mit Humor hinzu, als sie das verdutzte Gesicht ihres Schwiegersohnes sah.
»Ich verstehe dich wirklich nicht, Mama.«
»Wirst du gleich, mein Sohn, wenn ich dir erkläre, daß mein ständiger Wohnsitz weiter das Waldhaus bleiben wird. Ich werde mir alles genauso einrichten wie Hungolds; ich werde mir ein Auto halten, mit dem ich dann fahren kann, sooft ich Stadtluft genießen will.«
»Ist das dein fester Entschluß, Mama?«
»Mein ganz fester, Swen. Ich finde es auf die Dauer nicht mehr schön in der Stadt. Außerdem will ich doch in der Nähe meiner Kinder bleiben.«
»Mama, wenn ich alles erwartet habe, das nicht«, sagte der Baron überwältigt. »Daß ich mich über deinen Entschluß freue, das brauche ich dir ja wohl nicht noch zu sagen.«
»Nein, Swen, denn dazu kenne ich dich jetzt zu gut. Ich habe mich einst vermessen, auf dich herabzusehen. Daß ich das jetzt offen und frei bekenne, soll die Sühne für meine Anmaßung sein. Heute weiß ich, daß, wärest du nicht gewesen, wir nicht so sorgenfrei in die Zukunft schauen könnten; denn dein eiserner Wille ist es gewesen, mit dem du uns bezwungen und auf den Weg geführt hast, auf dem Onkel Leopold uns haben wollte.«
»Mama, wenn du das einsiehst, dann mußt du auch verstehen können, daß Edna und Bolko nicht anders handeln konnten und darfst ihnen nicht länger zürnen«, bat er mit seiner warmen Stimme. »Schau mal, Mama, die beiden können ja nie von Herzen froh werden, solange du ihnen noch gram bist.«
Frau Elisa sah in die blitzenden blauen Männeraugen und lächelte.
»Du magst recht haben, Swen. Kommt her, Kinder!«
»Mama!« jubelte Edna und schmiegte sich freudezitternd an die Mutter, während Bolko die feine Frauenhand zärtlich küßte. So eng verbunden war die stolze Frau noch nie mit ihren Kindern gewesen, so zärtlich hatte sie noch nie in die schönen klaren Gesichter geschaut wie jetzt.
Und so glücklich und zufrieden war sie auch noch nie in ihrem Leben gewesen.
*
Zwei Tage später fand die Hochzeit Gerswints und Swens statt. War die Verlobungsfeier nur schlicht und klein gewesen, so war jetzt die Hochzeitsfeier um so glänzender und größer.
Der Baron hatte außer sämtlichen Verwandten auch die Gutsnachbarn und maßgebenden Persönlichkeiten der Stadt geladen. So hatte es Onkel Leopold gewünscht. Es herrschte ein gar frohes Leben und Treiben in Waldwinkel, das Jahrzehnte hindurch jedem Frohsinn unzugänglich gewesen war.
Bei dieser Hochzeitsfeier konnte Frau Elisa wieder einmal beweisen, daß sie Feste zu veranstalten verstand wie kaum eine andere Frau. Es war alles so schön, so festlich und harmonisch, daß die Gäste noch wochenlang mit Begeisterung von dieser Hochzeitsfeier sprachen.
Als man die Braut sah, hielt man buchstäblich den Atem an vor Entzücken. Konnte es überhaupt so etwas Wunderschönes geben?
Nur der Bräutigam – der eine so gute Figur machte, daß er sich mühelos neben der reizvollen Braut behaupten konnte – war ihnen viel zu gelassen. Sie konnten nicht verstehen, daß ihm das Glück, eine solche Frau sein eigen zu nennen, nicht aus den Augen strahlte.
Der gequälte Mann hatte nur den einen Wunsch, daß alles erst vorüber wäre, und atmete befreit auf, als er sich in seine Räume zurückziehen konnte, um sich für die Reise umzukleiden. Als er damit fertig war, ging er nach dem Kinderzimmer hinüber, um Abschied von seiner kleinen Tochter zu nehmen. Es war die erste längere Trennung von seinem Kinde, und sie fiel ihm bitter schwer. Man hatte die Kleine schon zu Bett gebracht. Allein sie dachte nicht daran, einzuschlafen, sondern schluchzte jämmerlich und wollte durchaus zu ihrer Mutti.
»Die Mutti, die Mutti soll kommen!« beharrte das kleine Mädchen eigensinnig und schob Edna, die sich besorgt über sie beugte, heftig zurück.
»Und warum laßt ihr das Kind so bitterlich weinen?« fragte Edna verständnislos. »Warum holst du Gerswint nicht, Swen? Sie ist doch schon fertig angekleidet.«
»Ich wollte sie nicht belästigen.«
»Na, hör einmal, Swen, das ist doch nun wirklich übertriebene Rücksichtnahme«, versetzte sie unwillig und eilte davon, um schon einige Minuten später mit Mutter und Schwester zurückzukehren.
»Mutti, liebe Mutti«, stammelte Ilsetraut, müde und erschöpft von dem heißen Weinen und streckte der jungen Frau die kleinen Arme entgegen. »Du sollst doch nicht wegfahren, du bleibst wieder so lange wie damals. Wozu habe ich denn jetzt eine Mutti, wenn sie immer wegfährt und mich allein läßt!«
»Ich komme bald wieder, Ilsetraut«, versprach Gerswint und trocknete die Tränen von dem verweinten Kindergesicht. »Wenn du mir verspricht, nicht mehr zu weinen und dich brav hinzulegen, dann erzähle ich dir auch etwas Schönes.«
Damit legte sie das Kind in die Kissen zurück und sprach leise auf die Kleine ein. Erzählte, daß sie bald wiederkäme, daß sie der braven kleinen Ilsetraut auch etwas ganz Wunderschönes mitbringen werde und daß sie dann nie wieder von ihr ginge.
Zuerst fragte das Kind noch mißtrauisch dazwischen, dann wurden die Fragen immer seltener und verworrener, die Kinderaugen verschleierten sich und fielen schließlich zu. An den tiefen Atemzügen merkte Gerswint, daß die Kleine fest schlief. Sie verharrte noch einige Minuten und löste dann vorsichtig die Hände aus den festhaltenden Kinderpatschen.
»Ich glaube, daß wir jetzt gehen können«, sagte sie lächelnd zu den Umstehenden. Der Vater warf noch einen zärtlichen Blick auf das festschlafende Kind. Dann schärfte er der Erzieherin und Barbe eindringlich ein, gut auf die Kleine zu achten, drückte dem Fräulein abschiednehmend die Hand, streichelte die Wange der alten Barbe, küßte Elke, die ihn schmeichelnd umhalste, tätschelte den großen Kopf des Hundes und eilte dann erst den andern nach, die das Zimmer bereits verlassen hatten. Er ging in die Räume seiner jungen Gattin, wo er sie allein antraf.
»Gerswint, ich danke dir«, sagte er herzlich und zog ihre Hände an die Lippen. »Es wäre ungemein beunruhigend für mich gewesen, das Kind in so jammervoller Verfassung zurückzulassen.«
»Ich verstehe nur nicht, warum du mich nicht schon früher riefest«, sagte sie befremdet.
»Ich hatte ja keine Ahnung, daß du mit dem Kinde so gut fertig werden würdest«, gab er verlegen zurück. »Du hast doch nie mit Kindern Umgang gehabt, und Ilsetraut ist besonders schwer zu behandeln.«
»Wenn man den richtigen Ton für sie findet, dann ist sie es gar nicht«, widersprach die Gattin lächelnd.
»Ich wundere mich ja auch sehr darüber, daß du mit ihr so gut umgehen kannst«, verriet er ihr. »Nie hätte ich dir das zugetraut. Ich habe immer angenommen, Kinder wären dir lästig.«
»Du bist ja sehr aufrichtig, Swen«, meinte sie mit einem rätselhaften Lächeln. »Aber besser so als anders. Ich glaube, du hast zuviel Schauergeschichten von bösen Stiefmüttern gehört und gelesen.«
»Und ich glaube, ich habe dir bitter unrecht getan.«
»Nicht zu früh das eingestehen«, winkte sie mit einem reizenden Lächeln ab. Er starrte sie wie verzaubert an und streckte die Hände nach ihr aus.
Doch da trat sie mit einem hastigen Schritt zurück.
»Komm, Swen, das Auto ist schon längst vorgefahren«, mahnte sie gelassen. Er fuhr wie aus tiefer Versunkenheit auf und fuhr sich ruckartig über Stirn und Augen.
Es gab nun noch einen kurzen, herzlichen Abschied von Mutter und Geschwistern, dann fuhr das junge Paar im Auto davon, während im Schloß die Feier weiterging.
*
»Die wären also gut untergebracht«, bemerkte Bolko, der mit der Mama und Edna in die Festräume zurückkehrte, die von frohen, lachenden Menschen erfüllt waren.
Sein Blick ging über die zahlreichen Gäste, bis er an einer Gestalt im weißen Spitzenkleide haften blieb.
»Wie gefällt dir Ellen?« fragte er die heute ganz besonders reizende Edna, die ihn zuerst verblüfft ansah und dann verstehend lächelte.
»Wenn ich ›schlecht‹ sage, dann verprügelst du mich unter Garantie«, neckte sie ihn. »Also bleibt mir nichts anderes übrig, als mit ›gut‹ zu antworten. Nur zu blaß ist sie für meinen Geschmack, zu blaß und zu traurig. Sorge dafür, daß die bleichen Wangen sich röten, daß die verschleierten Augen leuchten; ich glaube, dann könnte man Ellen als bildschön bezeichnen.«
»Soll gemacht werden, Schwesterlein«, nickte er ihr herzlich zu und bahnte sich durch die tanzenden Paare einen Weg zu Ellen hin, die im Kreise ihrer Eltern und einiger anderer ältlicher Herrschaften saß und mit todtraurigen Augen in das frohe Treiben rings umher blickte. Er verbeugte sich vor ihr und bat um einen Tanz, und es schien einen Augenblick, als wolle sie dankend ablehnen. Dann jedoch erhob sie sich und ging mit ihm. Zuckte heftig zusammen, als sein Arm sie umschlang, und lehnte sich so weit zurück, wie es nur eben anging.
Eine Weile ließ er es auch ruhig geschehen; dann zog er sie jedoch mit einem Ruck an sich und hielt sie mit stählernem Arm fest an sich gedrückt.
»Herr von Hellersen, was fällt Ihnen ein? Sofort lassen Sie mich los!« sagte sie empört. Doch er lachte sie nur aus und hielt sie unerbittlich fest.
»Liebe, kleine, dumme Frau«, sagte er zärtlich. »Ihr Sträuben nützt Ihnen gar nichts. Halten Sie lieber fein still. Es ist der Arm eines arbeitsgewohnten jungen Mannes, der Sie hält. Und der gibt nicht heraus, was er halten will.«
Da gab sie endlich nach, weil sie kein Aufsehen erregen wollte. Hielt die Augen beharrlich gesenkt und sah daher nicht das spitzbübische Lachen in seinem Gesicht. Merkte auch nicht, wie er sie allmählich aus der Reihe der Tanzenden führte; sie wurde erst aufmerksam, als die Musik schwächer und immer schwächer zu ihnen herüberklang. Und als sie nun erschrocken aufsah, da erst bemerkte sie, daß er mit ihr aus dem Saal getanzt war.
»Herr von Hellersen, ich verbitte mir das!«
Er lachte jedoch immer übermütiger, wirbelte mit ihr im wahren Eiltempo davon, bis sie weit genug von der Gesellschaft entfernt waren. Dann hob er sie kurz entschlossen auf seine Arme und stürmte mit ihr davon.
In einem Zimmer, in dem die Musik nur noch ganz gedämpft zu hören war, ließ er sich in einen Sessel sinken, ohne sie aus den Armen zu lassen, und verschloß ihr mit seinen Lippen den Mund. Küßte sie so lange, bis sie einsah, daß ihr alle Empörung nichts nützen würde und sie ruhig in seinen Armen lag.
»Siehst du, warum nicht gleich so?« lachte er glückselig. »Anders ist dir mißtrauischem, kleinem Wesen ja doch nicht beizukommen; man muß dich einfach überrumpeln. Nun sage noch: ›Lieber Bolko, ich habe dich ganz schrecklich lieb und will sehr bald deine Frau werden‹, dann bin ich ganz sittsam und vernünftig.
Aber, was hast du denn, Liebstes?« fragte er erschrocken, als sie heiß aufweinte. »Bist du mir so böse? Sprich doch endlich, quäle mich doch nicht unnötig!«
Da hob sie den Kopf und schmiegte ihre Wange an die seine.
»Ich kann doch deine Frau nicht werden, Bolko!« sagte sie so traurig, daß es ihm ins Herz schnitt. »Schau, ich bin doch eine geschiedene Frau und…«
»Und ein großes Dummerchen«, unterbrach er sie aufatmend. »Was kannst du dafür, daß du an einen gewissenlosen Lumpen herangeraten mußtest?«
»Nichts, da hast du recht. Aber deine Mutter ist sehr stolz und wird niemals damit einverstanden sein.«
»Dann ist ihr nicht zu helfen. Und weiter?«
»Du kannst doch eine ganz andere Frau bekommen als mich.«
»Darauf habe ich nur gewartet«, lachte er herzlich. »Und wenn ich nun keine andere will als gerade dich?«
»Dann – dann…«
»Dann ist man hübsch ruhig, läßt sich küssen, küßt wieder und freut sich, daß man einen Menschen gefunden hat, den man von ganzem Herzen liebt. Oder tust du das etwa nicht?«
»Oh, Bolko, ich und dich nicht lieben.«
»Oder nimmst du noch immer an, daß es dein Geld ist, das dich mir wertvoll macht?«
Da senkte sie beschämt den Kopf.
»Ich weiß, womit du dich noch herumquälst, Ellen«, sagte er nun ernst. »Du hast Angst, eine zweite Ehe einzugehen, weil die erste ein Martyrium für dich war. Stimmt’s?«
Ein heftiges Nicken.
»Siehst du, so gut kenne ich dich schon. Aber ich bin kein Alf Unitz, Gott sei Dank. Und daß ich es nicht bin, das verdanke ich meinem Onkel Leopold und meinem famosen Schwager Swen. Sie sind es gewesen, die mich erst zu einem Menschen gemacht haben, der Achtung vor sich selber haben kann. Das heißt, wenn ich auch noch der alte wäre, der in vielen Ansichten Alf Unitz glich, so hätte ich doch niemals meine Frau so behandeln können, wie dieser Rohling es getan hat, auch wenn ich die Frau ohne Liebe und des Geldes wegen geheiratet hätte.
Und nun, da ich so ganz anders geworden bin, eine ganz andere Auffassung vom Leben habe, dich dazu noch aus heißer Liebe heraus wähle, wie könnte ich da jemals anders als gut zu dir sein?«
Das leuchtete der mißtrauischen Ellen ein. Aber dann machte sie sich energisch frei und stand nun vor ihm – verwirrt, beglückt und so unglaublich reizend anzuschauen, daß er sie immer wieder küssen mußte.
»Bolko, ich muß mich jetzt bei meinen Eltern sehen lassen«, sagte sie bittend. »Sie ängstigen sich sicherlich schon um mich, sind ja in ständiger Sorge, daß ich mir ein Leid antun könnte.«
»Warum denn das?« fragte er verständnislos.
»Weil ich so sehr um meine Liebe litt, daß ich keine Lust zum Leben mehr hatte«, bekannte sie.
»So. Und da plagt eine so dumme kleine Ellen sich mit Herzschmerzen herum, anstatt mir auch nur den kleinsten Wink zu geben.«
»Wie konnte ich das, Bolko.«
»Na, laß gut sein«, winkte er ab. »Das ist ja nun gottlob alles vorbei und bald vergessen. Aber zu deinen Eltern müssen wir gehen, das sehe ich ein, obgleich ich ja viel lieber mit dir allein bliebe.«
Sie sahen sich beseligt in die Augen und gingen dann endlich zu den Festräumen zurück, wo sie zuerst auf Edna stießen. »Nun, wie gefällt dir Ellen jetzt?« fragte Bolko verschmitzt.
»Ausgezeichnet!« lachte sie. »Herzlichen Glückwunsch, Schwägerin Ellen!«
Ehe jedoch die junge Frau ihrem Erstaunen darüber Ausdruck geben konnte, standen auch schon die Eltern vor ihr – verängstigt, besorgt und vergrämt.
»Nichts als Sorge und Not hat man mit dem Gör«, brummte Papa Hungold. Doch die Mutter vergaß, ihrem Kinde die verdienten Vorwürfe zu machen; sie war von Herzen froh, daß es wieder da war.
»Hören Sie mal, mein lieber Herr von Hellersen, ich möchte doch gerne wissen, warum Sie meine Tochter so innig umarmt halten?« fragte der alte Herr unwirsch.
Bolko lachte ihn vergnügt an.
»Weil Ihre Tochter nichts dagegen hat, Papa Hungold!«
»Soso, nichts dagegen hat«, brummte er mißtrauisch. »Ellen, ich will doch hoffen…«
»Oh, Papa, was hast du für eine lange Leitung!« lachte die Tochter übermütig. Da verstand er, und ein vergnügtes Schmunzeln zog über sein Gesicht, während Frau Hungold, die nun auch die Sachlage erfaßt hatte, ihr Kind gerührt in die Arme zog.
»Papa Hungold, ich glaube, ich brauche da nicht viele Worte zu machen«, wandte Bolko sich an seinen künftigen Schwiegervater. »Ich liebe sie, sie liebt mich.«
»Punktum! Dann man rein ins Ehejoch, mein Sohn. Warum soll es dir besser gehen als mir?« lachte Papa Hungold behaglich und drückte die Hand des jungen Mannes, daß er schmerzend das Gesicht verzog. »Viele Worte zu machen ist nie meine Art gewesen. Daher will ich dir nur sagen, daß ich mich über Ellens Wahl herzlich freue.«
»Und ich bin dafür, daß wir auf die neueste Verlobung mit einem Glase Sekt anstoßen«, schlug Edna vor, und dieser Vorschlag wurde mit Begeisterung aufgenommen. Man suchte sich ein einigermaßen ruhiges Plätzchen. Man prostete mehr, als unbedingt nötig gewesen wäre.
*
»Nun, Edna, du bist sicherlich schon recht müde, da du so blaß aussiehst«, sagte Frau Elisa fast zärtlich. »Ich würde dir raten, eine Tasse Mokka zu trinken; der wirkt wunderbar belebend.«
»Ja, Kindchen, tun Sie das!« riet ihr auch eine weißhaarige Dame. »Ich werde auch eine Schale davon trinken, obgleich ich weiß, daß ich danach nicht schlafen kann. Schauen Sie, hier ist ein Tisch, hinter Blattpflanzen halb verborgen.
Ah!« unterbrach sie lächelnd. »Das sieht ja fast wie eine Verlobung aus«, und sie zeigte auf ein junges Paar, das sich selbstvergessen küßte. Edna überlief es eiskalt, und ihr banger Blick ging zu der Mutter hin, die gleich ihr Ellen und Bolko sofort erkannt haben mußte; denn sie wurde erschreckend blaß.
»Bolko!« sagte sie laut. Da fuhr er erschrocken auf. Doch dann lachte er vergnügt und zog Ellen, deren Gesicht wie in Blut getaucht aussah, mit festem Griff zu sich heran.
»Hier, Mama, stelle ich dir meine Braut vor.«
»Das ist tüchtig, Herr von Hellersen«, lachte die weißhaarige Dame, und auch die anderen Herrschaften lachten vergnügt. »Es wäre ja auch kein rechtes Hochzeitsfest gewesen, wenn es nicht eine Verlobung nach sich gezogen hätte.«
Die Selbstbeherrschung, die Frau Elisa ein Leben lang geübt, kam jetzt wieder einmal glänzend zur Geltung. Sie bekam es fertig, liebenswürdig zu lächeln, sogar dem Brautpaar zu gratulieren.
Was blieb ihr auch anderes übrig, als sich ins Unabänderliche zu fügen? Sollte sie den Leuten, die hier neben ihr standen, erklären, daß sie von der Verlobung ihres einzigen Sohnes keineswegs entzückt war? Sollte sie es ihnen zeigen, wie ihr zumute war und damit nicht nur sich, sondern auch ihren Sohn lächerlich machen?
Nein, das konnte Frau Elisa nicht. Also mußte sie gute Miene zum bösen Spiel machen; sie konnte sich sogar so weit überwinden, lächelnden Mundes die Verlobung ihres Sohnes den jubelnden Gästen zu verkünden.
Sie war auch immer noch gleichmütig, als sie, nachdem die Gäste das Schloß verlassen hatten, noch eine kleine Stunde mit dem Brautpaar, dem Ehepaar Hungold und Edna zusammensaß.
Doch Edna und Bolko, die ihre Mutter genau kannten, wußten, daß diese nicht so ruhig war, wie sie scheinen wollte. Bolko wurde es doch recht bang zumute, und er wappnete sich mit aller Willenskraft, um später den Vorwürfen der Mama standhalten zu können.
Und die kamen, nachdem Hungolds sich verabschiedet hatten. In schroffen, vernichtenden Worten machte Frau Elisa ihrem Sohn klar, daß sie eine andere Wahl von ihm erwartet hätte.
»Schau doch, Mama, ich liebe sie ja«, fuhr er weicher fort. »Ist dir das Gefühl, deine Kinder glücklich zu wissen, nicht mehr wert als alles andere? Außerdem ist doch gar nichts an Ellen auszusetzen. Sie ist schön, jung und gesund, ist wirtschaftlich, liebt mich. Ich wüßte also wirklich nicht, warum ich sie nicht zu meiner Frau machen sollte.«
Doch Frau Elisa winkte ab: »Ich sehe, mein Sohn, dir ist nicht mehr zu helfen. Werde also glücklich mit deiner Ellen. Vielleicht – vielleicht finde ich mich auch noch einmal mit deiner Wahl ab.«
*
Die jungen Ehegatten befanden sich schon fast sechs Wochen auf der Hochzeitsreise, die hauptsächlich der Baron mit so viel Unlust angetreten hatte. Allein schon in den ersten Tagen der Ehe mußte er die Beobachtung machen, daß es sich mit Gerswint recht gut leben lassen würde. Launen schien sie nicht zu kennen; sie war immer gleichmäßig freundlich und entgegenkommend, war überhaupt eine vorbildliche Gattin. Bei ihr machte sich eben überall die Erziehung der Mutter bemerkbar, in der Selbstbeherrschung erstes Gesetz gewesen war. Wohl war sie von großer Zurückhaltung und ließ ihn nie einen Blick in ihr Inneres tun. Aber das wollte er ja auch gar nicht. Und wenn Gerswint immer so blieb, wie sie in den ersten sechs Wochen ihrer Ehe gewesen, dann wollte er wohl zufrieden sein.
Es konnte sogar vorkommen, daß er seine zweite Frau mit der ersten verglich – und er konnte sich nicht helfen, der Vergleich fiel zugunsten Gerswints aus. Er wollte es zuerst kaum fassen, aber es war tatsächlich so: Die stolze Gerswint war anspruchsloser, als es die schlichte Ilse gewesen war. Mit allem, was er vorschlug und tat, war sie einverstanden; sie machte ihm auch nie Vorwürfe, wenn ein Unternehmen mißlang, kannte keine Ermüdung und hielt stets mit ihm Schritt, wenn er auch noch so große Strapazen von ihr forderte.
Doch heute erhob sie sich, schritt zu dem Toilettentisch, blieb jedoch auf halbem Wege stehen – und sank mit einem Wehlaut zusammen.
Ganz furchtbar erschrocken war der Mann, der nun zusprang, die weiße Gestalt auf seine Arme hob und sie auf den Diwan legte. Er holte Kölnisch Wasser und rieb ihr damit die Schläfen, da schlug sie die Augen wieder auf.
»Gerswint, Liebstes, was machst du mir nur für Sorge!« sagte er angstvoll. »Ich werde sofort veranlassen, daß ein Arzt herkommt.«
»Laß nur, Swen«, wehrte sie und hielt ihn am Ärmel zurück. »Ich brauche keinen Arzt, ich bin nicht krank. Nur so ein wenig müde und matt. Es wird ja bald vorüber sein. Verstehst du mich nicht, Swen?«
Ja, jetzt verstand er, und in seinen Augen leuchtete es auf. Er setzte sich zu ihr, griff nach ihrer Hand, die sie ihm jedoch sogleich entzog.
Sie sah ihn an – lange, unentwegt. Er wußte sich den Blick nicht zu deuten.
Hörte auf nichts, was er sprach, so daß er schließlich ärgerlich wurde und das Zimmer verließ.
*
»Swen, was sollen wir eigentlich noch auf Reisen, wenn du mir alles und jedes verbietest«, sagte einige Tage später Gerswint zu dem Gatten, mit dem sie nach dem Essen noch ein wenig zusammensaß. »Du gestattest mir keine weiten Spaziergänge, besuchst keine Feste mit mir; ich weiß vor Langeweile überhaupt nicht mehr, was ich anfangen soll.«
»Das klingt aus dem Munde einer jungen Frau, die sich auf der Hochzeitsreise befindet, ziemlich merkwürdig«, versetzte er spöttisch. »Es gibt doch noch genug Dinge, die dich unterhalten und dir nicht schaden können.«
»Ich bin doch aber auf Reisen gegangen, um etwas zu sehen und mitzumachen. Im Schneckentempo spazierengehen, im Zimmer sitzen und lesen, auf dem Diwan liegen, das kann ich zu Hause alles doch besser und bequemer.«
»Also willst du nach Hause fahren?«
»Ja.«
»Zehn Wochen wollten wir unsere Hochzeitsreise ausdehnen; jetzt sind gut sechs Wochen vergangen. Man wird sich zu Hause über unsere schnelle Rückkehr den Kopf zerbrechen.
Na, egal, wie du willst. Ich will dich gewiß nicht zu etwas zwingen, das du nicht magst.«
Er sprach höflich und kühl, wie auch seine ganze Haltung ihr gegenüber jetzt schon seit Tagen war. Gerswint jedoch war sich gleichgeblieben.
»Du langweilst dich doch auch, Swen; gib es doch zu!« sagte die junge Frau lächelnd.
»Gewiß, ich langweile mich.«
»Na, also! Das ist ja auch kein Wunder. Für dich, der du an strenge Tätigkeit gewöhnt bist, muß es doch eine Qual sein, nichts weiter zu tun, als mir Gesellschaft zu leisten.«
»Ich habe mich noch nie darüber beklagt, Gerswint.«
»Nein, und wirst es auch nicht, soweit kenne ich dich nun schon. Zu Hause hast du deine Arbeit, und auch ich werde dort Beschäftigung finden.«
»Gut, dann fahren wir morgen. Aber langsam und mit größeren Unterbrechungen.«
»Einverstanden, du Tyrann«, lachte sie hellauf, was sehr selten geschah, ihn jedoch immer über die Maßen entzückte, weil es so ein weiches, von Herzen kommendes Lachen war.
Am nächsten Tage reisten sie ab. Swen achtete scharf darauf, daß die Gattin nicht überanstrengt wurde; nach einigen Stunden Fahrt ordnete er immer eine Rast an. Gerswint wußte ganz genau, daß seine übertriebene Sorge nicht ihr galt; trotzdem aber widersprach sie nie, sondern fügte sich seinen Anordnungen ohne Murren.
Nach drei Tagen langten sie zu Hause an und wurden von den Angehörigen freudig begrüßt. Hauptsächlich Ilsetraut war selig, ihre Mutter wieder bei sich zu haben, und Harras gebärdete sich wie toll über die Heimkehr Herrchens.
»Du bist blaß und schmal, mein Kind«, sagte Frau Elisa, als sie die Tochter begrüßte. »Und Swen sieht aus, als hätte er eine Krankheit überwinden müssen. Ihr wart sicherlich zu eifrig, habt keine Sehenswürdigkeiten der bereisten Orte unbesehen lassen wollen und habt euch weder Ruhe noch Rast gegönnt.«
»So wird es wohl sein, Mama«, gab Gerswint gelassen zur Antwort. »Jedenfalls bin ich glücklich, wieder zu Hause zu sein.«
Wenn Gerswint jedoch angenommen hatte, daß der Gatte sich in Waldwinkel weniger um sie kümmern würde als auf der Reise, dann irrte sie sich. Er umsorgte sie in zarter Weise und wachte ängstlich über ihre Gesundheit. Gleich in den ersten Tagen nach ihrer Rückkehr hatte er Sanitätsrat Melch nach Waldwinkel gerufen. Der hatte die junge Frau untersucht und bestätigt, was die Gatten schon wußten. Hatte Verhaltungsmaßregeln erteilt, und nun wachte der Baron darüber, daß diese auch gewissenhaft befolgt wurden. Er nahm seine Pflichten sehr ernst.
Soeben betrat der Baron das Wohnzimmer der Gattin. Sie saß an dem zierlichen Schreibtisch und war dabei, die Haushaltungsbücher zu prüfen. Bei seinem Erscheinen schob sie diese, wie bei einem Unrecht ertappt, hastig zur Seite und ging ihm mit gewohnter Gelassenheit entgegen.
»Also, Gerswint, ich komme aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus«, bekannte er überwältigt. »Ich habe geglaubt, ein zimperliches Mädchen zu heiraten, das jeder Arbeit im großen Bogen aus dem Wege geht, und nun muß ich die Feststellung machen, daß du dich um alles kümmerst und dich als regelrechter guter Hausgeist entpuppst. Kind, wo hast du das bloß her?«
»Angeboren, Swen«, gab sie schulterzuckend zurück.
»Hm, ja, das ist ja alles hübsch und gut, ich freue mich auch riesig über deine Betätigung, bin aber dadurch in eine unangenehme Lage geraten.
Schau mal, Gerswint, bevor ich dich näher kannte, habe ich natürlich angenommen, daß es dir nicht einmal im Traum einfallen würde, hier Hausfrauenpflichten und Mutterpflichten zu übernehmen. Und als mich Frau Widding kurz vor der Hochzeit fragte, ob sie sich nicht nach einer anderen Stellung umsehen müßte, da Waldwinkel ja nun in Kürze eine Herrin bekäme, da habe ich sie um ihr Bleiben gebeten.
So ähnlich war es mit der alten Barbe. Die meinte, sie wäre jetzt, da Ilsetraut nun eine Mutter bekäme, doch ganz überflüssig hier geworden, und trug sich daher mit dem Gedanken, in ein Stift zu gehen. Nun hängt die Alte aber sehr an dem Kinde; ich weiß nicht, wie sie eine Trennung ertragen würde.
Ach, Gerswint, ich weiß nicht, ob du mich verstehst?«
»Nur zu gut, Swen. Und ich weiß nicht, warum du dich mit Dingen herumquälst, die doch so einfach zu lösen sind. Meinst du wirklich allen Ernstes, daß ich den Mut haben könnte, die alte Barbe von dem Kinde zu trennen? Ach, Swen, wie wenig kennst du mich doch! Ich werde schon den richtigen Ton der Alten gegenüber finden; da kannst du ganz ruhig sein. Ich werde ihr auch zu erklären wissen, wie nötig Ilsetraut sie immer noch hat. Ich kann mich ja nicht ständig um das Kind kümmern, und das kann wiederum bei seiner Lebhaftigkeit nicht ohne Aufsicht bleiben. Fräulein Herta kann sich auch nicht immer mit der Kleinen beschäftigen, da sie ja in erster Linie Elkes Lehrerin ist. Also wird es immer die alte Barbe sein, die das Kind am meisten zu betreuen hat.
Und Frau Widding? Ich bin noch viel zu unsicher in meiner Hausfrauenwürde und möchte diese gütige und sehr tüchtige Frau um alles nicht missen. Ich habe ja noch so vieles von ihr zu lernen. Sie ist mir in Wissen und Erfahrung weit überlegen, wird aber trotzdem nie vergessen, daß ich die Hausfrau bin. Und ich werde nie vergessen, daß sie eine feinempfindende, sehr einsame Frau ist, die allein auf der Welt steht und in Waldwinkel eine Heimat gefunden hat. Ich bringe die Angelegenheit mit deinen beiden Sorgenkindern schon in Ordnung, Swen«, schloß sie mit ihrem bezaubernden Lächeln. Er starrte sie wie ein Wunder an.
»Gerswint, ich bin einfach überwältigt. Ja, Kind, wenn es so ist, dann will ich wohl zufrieden sein. Aber eines sage ich dir: Ich werde nie wieder über einen Menschen urteilen, bevor ich ihn nicht kenne.«
Er zog ihre Hände an die Lippen, eine um die andere, immer wieder. Drückte auch seine Augen darauf und sah daher nicht das gequälte Lächeln in ihrem Gesicht.
Und Gerswint hielt Wort, sie brachte die Angelegenheit mit den beiden Frauen in taktvoller Weise in Ordnung, und die Folge davon war, daß sie von ihnen fortan vergöttert wurde.
So herrschte eine schöne Harmonie im Schloß. Tagsüber ging man seiner Beschäftigung nach, doch am Abend gab es manche gemütliche Stunde, an der nicht nur alle Hellersen, sondern oft auch Hungolds teilnahmen. Daß Wieloff nie fehlte, das war ja selbstverständlich. Mit Behagen gab man sich den gemütlichen Plaudereien hin, während der Dezembersturm das Schloß umtoste.
An einem dieser Abende erklärte Bolko, daß er seine Hochzeit Weihnachten feiern wollte, und hatte für die Erregung, die seine Eröffnung hauptsächlich bei Mama Hungold hervorrief, kein Verständnis.
»Aber Ellen, das geht doch gar nicht«, jammerte die alte Dame händeringend. »Es ist mir doch unmöglich, so schnell deine Aussteuer zu beschaffen.«
»Du tust doch seit Wochen überhaupt nichts anderes mehr, als die Aussteuer für Ellen herbeizuschleppen, Mamachen«, lachte Bolko sie liebenswürdig an. »Einmal mußt du doch damit fertig werden.«
»Du sprichst, wie du es verstehst, mein Junge. Einen so großen Gutshaushalt, wie Hirschhufen ihn hat, auszustatten, ist gar nicht so einfach; da gibt es tausenderlei zu bedenken. Wenn Ellen mir wenigstens zur Hand gehen möchte! Aber die hat ja für nichts anderes mehr Sinn als für dich.«
»Das wird sich auch so gehören, Mamachen. Aber nun sei mal hübsch lieb und nett und sage ja und amen. Wir haben es uns nur einmal in den Kopf gesetzt, eine andere Hochzeit zu haben als die meisten Leute. Denk mal, Mamachen, so eine Hochzeit in der Waldwinkler Kapelle im Schein der Weihnachtskerzen. Kein Trubel, keine Gäste, nur die Angehörigen – Schluß! Hinterher die Bescherung, ein Festessen, anschließend ein Plauderstündchen, und dann fahren Ellen und ich ganz langsam im Schlitten nach Hirschhufen.«
»Verflixt, Bengel, da wird einem ja ganz warm ums Herz«, schmunzelte Papa Hungold. »Sei kein Spielverderber, Mutterchen, erkläre dich einverstanden! Sei froh, daß es noch so empfängliche Gemüter gibt, wie unser Sohn eines hat.«
Was blieb da Frau Hungold anderes übrig, als beizustimmen? Zum Dank dafür wurde sie von der erfreuten Tochter halb zerdrückt. Und als sie gar Bolkos strahlendes Gesicht sah, da tat es ihr nicht mehr leid, nachgegeben zu haben.
»Also, Weihnachten ist Hochzeit. Gar nicht so übel«, lachte der Baron. »Aber da eine Hochzeit immer eine Verlobung nach sich zu ziehen pflegt, so müssen wir sehen, daß wir bis dahin für Edna einen Mann auftreiben.«
»Laß doch die geschmacklosen Witze!« fuhr das Mädchen ihn zornig an, sprang auf, stürmte aus dem Zimmer.
»Ja, was hat sie denn?« fragte der Schloßherr betreten.
»Das möchte ich auch gerne wissen«, sagte Frau Elisa beunruhigt. »Edna gefällt mir schon seit Wochen nicht mehr. Nicht allein, daß sie blaß und irgendwie vergrämt aussieht, sie ist auch manchmal von einer krankhaften Gereiztheit.«
»Da bleibt doch eigentlich nur die eine Deutung, daß die Kleine verliebt ist«, sagte Papa Hungold nun trocken.
»Kann man gar nicht wissen, Mama«, meinte Bolko verschmitzt. »Umsonst ist Edna nicht jeden Tag in Lützen, das augenblicklich einen gar schneidigen Verwalter hat.«
»Wie kommst du auf den geschmacklosen Einfall, daß Edna sich ausgerechnet in einen einfachen Verwalter verlieben könnte?« meldete sich Frau Elisa, die trotz aller erfreulichen Veränderungen doch noch ab und zu ihren alten Hochmut herauskehrte. Und unwillkürlich gingen aller Augen zu Wieloff hin, der ganz unberührt dasaß.
Wie konnte die Mama nur! Wahrhaftig, es gab Minuten, da die Kinder sich ihrer stolzen Mutter schämen mußten!
Es geschah gottlob nicht mehr oft, daß Frau Elisa in ihren alten Fehler zurückfiel. Sie schien sich auch mit der Verlobung des Sohnes ausgesöhnt zu haben; denn sie war zu Ellen und deren Eltern, wenn auch nicht gerade herzlich, so doch von einer gleichbleibenden Freundlichkeit.
Aber daß Edna womöglich einen Verwalter heiraten könnte?
Um das gutzuheißen, so weit war Frau Elisa noch nicht!
Wenn sie nur gewußt hätte, mit welchem Herzweh die Tochter sich augenblicklich quälte!
Sie lag nämlich in ihrem Zimmer auf dem Diwan und war unzufrieden mit sich und der ganzen Welt. Sie wollte ihrem Herzen, das sie mit großer Hartnäckigkeit immer weiter an den Rand der Verzweiflung trieb, durchaus klarmachen, daß es andere Wege zu gehen hätte als die, die es schon lange eingeschlagen hatte.
Das Herz schlug ihr nämlich immer seltsam schwer in der Brust, sobald die hohe Gestalt des Sekretärs nur auftauchte.
Und das wollte ihr Stolz doch nicht zulassen.
Also standen Stolz und Herz der armen Edna gegeneinander in erbitterter Fehde und machten der geplagten Besitzerin das Leben damit zur Hölle!
Oftmals schien es allerdings so, als wenn das Herz siegen würde; sonst wäre es ihr doch einerlei gewesen, daß der Sekretär ernste Heiratsabsichten zu haben schien. Sonst wäre es ihr doch nicht eingefallen, dem Mann oft heimlich zu folgen, um festzustellen, ob er sich wieder mit der Auserwählten treffen würde.
Wenn sie dann sah, wie Wieloff das Mädchen lächelnd begrüßte, dann allerdings stieg der Stolz ganz gewaltig in ihr hoch und machte ihr das Herz mit wenigen Streichen kampfunfähig.
Einen Sekretär? Für eine Edna von Hellersen konnte Wieloff nichts anderes als der Sekretär ihres Schwagers sein. Mochte er also dieses Fräulein Bottich heiraten, das paßte zu ihm.
Wie man überhaupt Bottich heißen konnte!
Wieloff allerdings schien dieser Name nicht zu stören; denn er wollte, wie sie aus sicherster Quelle zu wissen glaubte, um das Mädchen werben. Das war überhaupt ein offenes Geheimnis; man sprach in der ganzen Umgegend davon.
Fräulein Bottich hatte nämlich schon zwei Jahre hintereinander den Sommer auf dem Gute ihres Onkels, das einige Kilometer von Waldwinkel entfernt lag, verlebt. Dort hatte sie auch den Sekretär kennengelernt und kein Hehl daraus gemacht, wie gut ihr der vornehme Mann gefiel.
Wieloff war ja nun zu Geld gekommen und konnte sich selbständig machen, zumal auch Fräulein Bottich über erhebliche Geldmittel verfügte. Sie ging bereits bei ihrer Tante im Gutshaushalt ernstlich in die Lehre, um sich alles das anzueignen, was eine Gutsfrau verstehen mußte. Auch das hatte Edna einwandfrei ermitteln können. Aber warum sie darüber so bitterlich weinen mußte, das wußte sie selber nicht.
*
»Gerswint, willst du mir nicht erklären, was das zu bedeuten hat?« fragte der Baron eines Tages die Gattin, als er das Wohnzimmer betrat, in dem Gerswint mit einer Handarbeit beschäftigt war. »Ich habe nämlich heute zu meinem Befremden feststellen müssen, daß du von deinem Bankkonto, das ich dir eingerichtet habe, noch nicht einen Pfennig abgehoben hast, obwohl wir bald ein Vierteljahr verheiratet sind. Hast du denn keine persönlichen Ausgaben?«
»Da ich mich weder pudere noch schminke, noch sonst einen Schönheitskult treibe«, gab sie spöttisch zur Antwort. »Mit Kleidern bin ich ja auf eine Weile versorgt, für Essen und Trinken brauche ich ebenfalls nicht zu sorgen.«
»Aber trotzdem hat man doch Ausgaben, Gerswint, da kannst du mir doch nichts vormachen. Hat die Mama dir etwa noch eine Summe zur Aussteuer mitgegeben?«
Gerswint zögerte einen Augenblick lang, doch dann trat ein entschlossener Zug in ihr Gesicht.
»Das nicht gerade«, versetzte sie ruhig. »Ich bekomme aber von Mama ein monatliches Taschengeld.«
»So! Und warum, wenn ich fragen darf?«
»Warum? Mein Gott, Swen, du mußt nicht so tun, als ob du so schwer von Begriff wärest. Muß ich denn wirklich in Worte kleiden, was nicht nur wir allein wissen, sondern was ein offenes Geheimnis ist?«
»Ich bitte darum, da ich tatsächlich nicht weiß, was du meinen könntest.«
»Swen, dir ist durch den Willen des Onkels eine Frau aufgehalst worden, die du dir aus eigenem Willen heraus nie und nimmer erwählt hättest. Trotzdem bist du gut und ritterlich zu dieser Frau, und dafür ist sie dir von Herzen dankbar.
Ich hätte mich gegen das Gebot des Onkels ja auflehnen können; aber ich tat es nicht, weil wir Ortleffs ein stark ausgeprägtes Pflichtgefühl besitzen – wie ja die Hellersen auch.
Ich wurde also deine Frau und habe damit Pflichten übernommen, denen ich auch gerecht werden möchte. Ich bemühe mich, deinem Hause die Herrin zu sein, deinem Kinde die Mutter zu ersetzen, ich werde Waldwinkel den Erben schenken.
Aber mein Leben, so mein eigenes, tiefinnerliches, das möchte ich doch allein leben. Und dazu gehört auch mein eigenes Geld.«
Er taumelte auf, als habe sie ihn geschlagen. Sein Gesicht war aschfahl. Sie standen sich gegenüber wie Feinde.
»Also, das bist du – richtig du, Gerswint Hellersen«, sagte er sehr langsam, sehr schwer. »Gut, daß ich nun weiß, woran ich bin. Wenn du dich auch in einem Jahr sehr verändert hast, hochmütig bist du geblieben.«
»Warum hochmütig? Ich bemühe mich doch redlich, meine Pflicht zu tun, wie du auch.«
»Pflicht, Pflicht und noch mal Pflicht!«
Er starrte sie sekundenlang an, dann wandte er sich ab und stürmte hinaus. Eilte unverweilt in seine Zimmer, die er zuerst wie ein Wilder durchlief, um zuletzt in seinem Arbeitszimmer wie vernichtet in einen Sessel zu sinken.
Das war es also, woran er herumgerätselt hatte! Kurz, knapp und klar war ihm die Lösung nun ins Gesicht geschleudert worden: Pflicht!
Natürlich, das war ja so einfach zu erklären. Auch daß ihm darüber das Herz fast in Stücke gehen wollte. Das war ja so einfach.
Jetzt erst wurde ihm zur Gewißheit, was er zuerst mit ungläubigem Staunen unklar gefühlt hatte. In dieser Minute erst wurde es ihm mit vernichtender Deutlichkeit klar, jetzt, da ihm alles zerschlagen war: Er liebte seine schöne, spröde Frau, liebte sie mit aller seiner Mannessehnsucht. Er hatte sich an ihrer Schönheit, an ihrer köstlichen Reinheit Herz und Seele verbrannt.
Stöhnend barg er das Gesicht in den Händen.
*
Man aß heute zeitig, denn schon um 15 Uhr sollte die Trauung in der Kapelle stattfinden. Von der standesamtlichen Trauung war das junge Paar schon zurück, und Ellen befand sich im Hause ihrer Eltern, aus dem Bolko sie zum Altar führen wollte.
Es hatte niemand so rechten Appetit, weil sie alle erregt waren.
Man hatte Edna den Sekretär als Brautführer gegeben.
Es wurde wirklich eine unvergleichlich stimmungsvolle Trauung. Der nur mit weißem Christbaumschnee geschmückte Baum sah aus, als hätte man eine schneebedeckte Tanne aus dem Walde geholt, in die Kapelle gestellt und mit Kerzen besteckt. Die Braut davor sah in ihrem schneeigen Hochzeitskleide wie ein Weihnachtsengel aus.
Nach der Trauung gab es nur ein kleines Essen und hinterher die Bescherung der Gutsleute. Zwischendurch wurde ein Imbiß gereicht; anschließend kam dann die Bescherung im engsten Kreise.
Die ganzen Vorbereitungen dazu hatte Gerswint getroffen, nur den Diener Christian hatte sie dabei zur Hilfe gehabt. Aber was sie da in dem großen Saale geschaffen, übertraf jede Erwartung.
Die hohe Tanne, die hier stand, war im Gegensatz zu der weißgeschmückten in der Kapelle von köstlicher Buntheit. Gerswint hatte an die beiden Kinder gedacht, als sie den Baum schmückte, und Dinge darangehängt, die ein Kinderherz und -auge entzücken mußten.
Da gab es leuchtendbunte Schaumkugeln, glitzernde Ketten, Lametta und Engelshaar, rotwangige Äpfel, vergoldete Nüsse, Naschwerk aller Art und Kerzen, Kerzen ohne Zahl.
Dazu war der Saal weihnachtlich geschmückt, und die Geschenke waren geschmackvoll aufgebaut.
Nicht nur Elke und Ilsetraut standen beim Betreten des Saales wie gebannt da, auch die Erwachsenen fühlten sich von einer wundersamen Stimmung ergriffen. Ihre Blicke hingen an Gerswints weißgekleideter Gestalt am Harmonium. Sie wirkte heute überaus zart und holdselig.
Mit so viel Andacht hatte man selten das alte Weihnachtslied gesungen, und erst der Jubel der Kinder, mit dem sie ihre Geschenke begrüßten, brachte die andern in die Wirklichkeit zurück. Auch bei der Auswahl der Geschenke hatte Gerswint sich selbst übertroffen. Sie hatte Lieblingswünsche erlauscht und sie zu erfüllen versucht, soweit es nur in ihrer Macht stand. Sie konnte sich jetzt kaum des Dankes, mit dem die Beschenkten sie überschütteten, erwehren, hatte wieder ihr entzückendes Schelmenlächeln im Gesicht, das alle bezauberte.
Eben stand sie bei Roger Wieloff und lächelte zu ihm auf.
»Nun, Herr Wieloff, hoffentlich habe ich das Rechte für Sie getroffen?«
»Frau Baronin, ich bin einfach überwältigt. Ich weiß nicht, womit ich so viel Gunst verdient habe. Meine sämtlichen Lieblingswünsche sind erfüllt.«
Voll Verehrung beugte sich der schmale Männerkopf über die feine Hand.
Gerswint schritt weiter, blieb bei dem Gatten stehen, der ihr mit so seltsam flimmerndem Blick entgegensah. In seinen Augen stand keine Freude.
»Mach ein anderes Gesicht, Swen! Es paßt nicht zu all der Freude ringsum«, lächelte sie. »Du und Edna, ihr zeigt wahre Trauermienen. Und heute ist doch nicht nur Weihnachten, sondern auch Hochzeit. Oder habe ich irgend etwas verkehrt gemacht? Dann ließe sich deine Verstimmung allerdings erklären.«
»Ich habe noch nie ein so stimmungsvolles Weihnachtsfest verlebt, Gerswint.«
»Dann bin ich zufrieden, Swen. Du weißt, ich bin stets bestrebt, dir dein Heim so behaglich wie möglich zu machen. Um so ein wenig die Dankesschuld abzutragen, die ich dir gegenüber habe.«
Sie lächelte ihn an, schritt weiter, und er sah ihr mit düsteren Blicken nach. Dankbarkeit und Pflicht – das waren zwei Dinge, die diese Frau sehr ernst nahm. Er sollte eigentlich froh sein, daß es so war, sollte sich nicht mit unsinnigen Wünschen zerquälen. Das Leben erfüllt nun mal nicht alle Wünsche. Und er konnte sich doch wahrlich nicht beklagen, daß er vom Schicksal vernachlässigt wurde. Ihm fiel doch förmlich alles in den Schoß, was andern Sterblichen nie zuteil wurde.
Seufzend wandte er sich wieder seinen reichen Geschenken zu. Aber ihm selbst unbewußt, irrte sein Blick gleich wieder ab und suchte die Gattin, die jetzt bei Edna stand. Sie hatte den Arm um die Schultern der Schwester gelegt, die den Kopf tief gesenkt hielt. Langsam trat der Baron zu den Schwestern heran und bemerkte jetzt auch, wie blaß das Mädchen war.
»Edna, Kind, bist du krank?« fragte er besorgt. Doch sie schüttelte den Kopf.
»Nein, Swen. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Eben hat Gerswint mir die gleiche Frage gestellt.«
»Ja, Mädel, wenn eine so miesepetrig aussieht wie du, dann muß man doch wohl annehmen, daß dir irgend etwas fehlt. Anstatt daß deine Augen heute mit den Kerzen um die Wette strahlen…«
»Das tun die des jungen Paares schon für mich mit«, spottete sie, und Swen mußte lachen.
»Allerdings, da hast du recht. Schrecklich verliebt sind die Leutchen. Ich glaube, sie sehen nur sich, alles andere ist für sie versunken.«
Er schob seine Hand leicht unter den Arm der Gattin und zog sie mit sich fort. »So, du reizender Weihnachtsengel, ehe du mir wieder entschlüpfst, um eine deiner hundert Pflichten zu erfüllen. Es heißt ja wohl: ›Geben ist seliger denn nehmen‹, aber ganz reizlos ist das Nehmen auch nicht.«
Damit führte er sie an den Platz, wo er seine Geschenke für sie aufgebaut hatte. Da war so ziemlich alles, was ein Frauenherz erfreuen konnte, und Gerswint stand davor wie gebannt.
»Gerswint, nimm es gnädig hin. Komm mir heute nicht mit deinem falschen Stolz, du würdest mich namenlos verletzen!«
Er sah, wie sie mit sich rang. Doch dann sah sie auf, sah seine Augen mit dem flehenden Blick. Da lächelte sie und strich ihm über die Augen mit unendlich weicher Gebärde. Er hielt die schmeichelnde Hand fest, preßte seine Lippen darauf.
»Ich danke dir, Swen. Ich finde nur, daß du mich sträflich verwöhnst.«
»Kind, gönne mir doch wenigstens diese Freude! Wen soll ich denn verwöhnen, wenn nicht meine Frau? Du hast doch ein erstes Recht darauf.«
Mit Befriedigung sah er, wie sie sich an den Gaben, die er mit so viel Liebe und Sorgfalt für sie ausgesucht hatte, zu erfreuen schien. Konnte keinen Blick wenden von diesem weichen Antlitz, das von einer leichten Röte überhaucht war, die es so köstlich jung und süß erscheinen ließ.
»Ich muß dieses Armband doch einmal Edna zeigen«, meinte sie eifrig, verstummte jedoch, als ihr Blick auf die Schwester fiel, die regungslos an ihrem Tisch stand, sich unbeobachtet glaubte und selbstvergessen in eine bestimmte Richtung blickte. Gerswint folgte dem Blick und sah in des Sekretärs gesenktes Gesicht. Er blätterte in einem Buch, schien jedoch nicht bei der Sache zu sein; denn immer wieder schweiften seine Augen darüber weg.
So viel stummer Schmerz, so viel Qual lag in den Männeraugen, daß Gerswints Herz sich vor Mitgefühl zusammenzog.
Ihr Blick ging zu Edna zurück. Und auch, was sie in deren Augen las, erschütterte sie tief.
Sie sah den Gatten an und bemerkte, daß auch er die beiden beobachtete. Vor Erregung zitternd, umfaßte sie seinen Arm.
»Swen, schau, auf wen als auf die beiden Menschen könnte dies besser passen: Sie tragen beide auf der offenen Stirn das Zeichen derer, die um Liebe leiden? Swen, sag, ist das nicht schrecklich?«
»Warum denn, kleine Frau? Ich kann nichts Schreckliches dabei finden. Werde vielmehr dem lieben Roger mal gehörig ins Gewissen reden.«
»Er ist aber doch nicht mehr frei, Fräulein Bottich scheint Rechte an ihn zu besitzen. Arme kleine Edna!«
»Und armer lieber Roger. Irgend etwas stimmt da nicht. Aber eine Frage, Gerswint: Hättest du etwas gegen Wieloff als Schwager einzuwenden?«
»Nein, Swen. Er wäre mir der liebste von allen.«
»Das wollte ich nur hören. Und nun will ich doch mal sehen, ob ich da nicht ein wenig nachhelfen kann.«
Lächelnd strich er seiner Frau über die Augen, die jetzt angstvoll zu ihm aufsahen, und schlenderte dann langsam auf Wieloff zu, der bei dem Erscheinen seines Herrn das Buch weglegte und eine höfliche Haltung annahm.
»Zufrieden mit dem Weihnachtsmann, Wieloff?« fragte er liebenswürdig, und ein freudiger Schein ging über des Sekretärs Gesicht.
»Sehr, Herr Baron. Ich habe noch nie ein so schönes Weihnachtsfest verlebt.«
»Freut mich zu hören. Aber was sagt das Fräulein Braut dazu, daß Sie es am heutigen Abend allein lassen?«
»Meine Braut? Ach so«, meinte er dann mit leichtem Lächeln. »Der Herr Baron haben wie viele andere gedacht, daß ich mich mit Fräulein Bottich verloben würde?«
»Selbstverständlich, lieber Wieloff, beängstigend genug sah es ja aus. So sind Sie nicht verlobt?«
»Nein.«
»Merkwürdig. Die junge Dame machte einen arg verliebten Eindruck. Also kann es nur an Ihnen liegen, daß die Verlobung nicht zustande kam. Und warum?«
»Fräulein Bottich entspricht nicht meinem Frauenideal.«
»Kann ich verstehen. Aber wäre es taktlos, zu fragen, wie Sie sich das vorstellen?«
Unwillkürlich ging Wieloffs Blick zu Edna hin. Der Baron merkte es und lachte.
»Ich bin schon im Bilde. Und dann können Sie Barbar es so ruhig mit ansehen, daß die Kleine so todestraurige Augen hat?«
»Herr Baron, das Schicksal hat schon so manchem, der vermessen genug war, nach den Sternen zu greifen, gehörig auf die Finger geklopft«, kam es voll tiefer Bitterkeit zurück. »Edna von Hellersen – und ein Sekretär? Ich mache mich nicht gern lächerlich.«
»Lieber Roger, ich hätte Sie für vernünftiger gehalten. Genügt es, wenn ich Ihnen sage, daß ich die kleine Edna, deren Vormund ich ja noch bin, keinem lieber geben würde, als gerade Ihnen? Und daß meine Frau genauso denkt? Sehen Sie mich nicht so ungläubig an, es ist genauso, wie ich es Ihnen sage. Und nun Glück auf, lieber Roger! Seien Sie kein Narr, der die Pforte nach seinem Paradiese mit eigenen Händen zuhält.«
Damit ließ er ihn stehen und ging zu der Gattin zurück, die ihm mit erwartungsvollen Augen entgegensah.
»Was ich augenblicklich tun konnte, ist getan. Hoffentlich gibt es bald zwei glückliche Leute mehr auf der Welt.
Ah, da erscheint ja auch unser lieber Christian und will sicher melden, daß das Festessen angerichtet ist.«
Nach dem Essen verabschiedeten sich die Neuvermählten, um mit dem Schlitten durch den Winterwald nach Hirschhufen zu fahren. Mama Hungold nahm einen so tränenreichen Abschied von ihrer Tochter, als gälte es eine Trennung für Jahre; auch Papa Hungold war sehr rührselig.
Ellen lachte sie aber aus und winkte vergnügt zu den Angehörigen hin, die sie alle hinausbegleitet hatten; dann kuschelte sie sich im Schlitten fest an die Seite des jungen Gatten.
Wieloff, der auch mit den anderen draußen stand, bemerkte im hellen Schein der Bogenlampen, daß ein Strang am Pferdegeschirr zu locker saß, und bückte sich, um ihn festzubinden. In dem Augenblick aber zogen die nervösen Gäule an, und er erhielt einen so heftigen Hufschlag gegen den Kopf, daß er taumelte. Er spürte, wie ihm das Blut über das Gesicht rann, und trat zurück, um von den anderen nicht gesehen zu werden; er wollte ihnen die Stimmung nicht verderben.
Allein Edna hatte den Unfall bemerkt und blieb zurück, während die andern lebhaft plaudernd die Freitreppe emporstiegen und im Schloß verschwanden. Sie stand nun zitternd und bebend vor ihm und sah ihn aus angsterfüllten Augen an.
»Herr Wieloff, Sie sind verletzt?«
»Kaum von Bedeutung, gnädiges Fräulein«, versuchte er sie zu beruhigen. »Ich werde mir die kleine Schramme verbinden lassen.«
»Schöne kleine Schramme!« sagte sie fast weinend und zeigte mit zitternder Hand auf die Wunde am Kopf, aus der unaufhörlich Blut sickerte. »Ich werde sogleich veranlassen, daß Sanitätsrat Melch herkommt.«
»Und den andern damit die frohe Stimmung verderben? Das dulde ich auf keinen Fall.«
»So wollen Sie also verbluten?« fragte sie und weinte nun wirklich aus Angst um den geliebten Mann. »Kommen Sie wenigstens ins Schloß, damit ich Ihnen einen Notverband anlegen kann. So«, sagte sie aufatmend, als ein geschickt angelegter Verband seinen Kopf umgab. »Jetzt werde ich den Sanitätsrat herbeirufen, ohne daß die anderen etwas merken.«
»Gnädiges Fräulein, zuerst möchte ich Ihnen danken.«
Tief beugte er sich über die zitternden Mädchenhände, küßte sie ganz leise und zart und hielt sie auch noch fest, als er den Kopf hob.
Blick ruhte in Blick, unlöslich fest.
Jäh schluchzte das Mädchen auf, einmal nur doch das ganze qualvolle Leid vergangener Wochen lag darin.
»Edna, süße kleine Edna.«
Ganz leise klang es, ganz leise und unendlich zärtlich.
Da war es um ihre Beherrschung geschehen! Sie warf die Arme mit leidenschaftlicher Heftigkeit um seinen Hals, wühlte den Kopf an seine Brust, als müsse er dort eindringen, und weinte dann so bitterlich, daß es dem erschütterten Mann ins Herz schnitt.
Er setzte sich, behielt sie auf den Knien und wartete geduldig, bis das heiße, verzweifelte Weinen verstummte.
»Edna, kleiner trotziger Liebling, du darfst nie wieder so furchtbar weinen«, begann er vorsichtig und sah auf den Mädchenkopf nieder, der da wie selbstverständlich an seiner Schulter lag. »Kannst du dir denn nicht denken, wie weh mir das tut?«
Jetzt ruckte der Kopf hoch.
»Ich… Wir… Fräulein Bottich…«, stammelte sie; doch da ging ein Lächeln über sein zuckendes Gesicht.
»Ich… Wir… Das stimmt, kleiner Trotzkopf. Aber Fräulein Bottich? Was geht sie uns an?«
»Sind Sie denn nicht…?«
»Nein, ich bin nicht. Wo werde ich nach einem Fräulein Bottich schauen, wenn ich eine Edna Hellersen haben kann! Ich hoffe doch, daß diese mich ein wenig lieb hat. Oder habe ich mich getäuscht?«
»Ein wenig? Das genügt wohl nicht zum Glücklichsein.«
»Also sehr?«
»Bis zur Demütigung.«
»Dann will ich nicht länger grübeln und zweifeln; denn dieses beglückende Geständnis gibt mir die Kraft selbst mit dem Teufel um dich zu kämpfen, denn du bist mein Glück, meine Seligkeit, mein alles!«
»Roger!«
Es war ein jubelnder Schrei, der ihm durch und durch ging. Er preßte seine Lippen auf den frischen Mädchenmund, und all das Leid, das diese beiden Menschen umeinander getragen hatten, ging unter in der Glückseligkeit, sich endlich gefunden zu haben.
*
»Im Kinderzimmer bist du, Gerswint? Hier habe ich dich kaum vermutet«, sagte der Baron und trat leise an das Kinderbett, über das die Gattin sich gebeugt hatte.
»Was hat denn Ilsetraut? Sie ist doch nicht etwa krank?«
»Nein, nur sehr unwillig war sie«, gab Gerswint leise Auskunft und deckte das festschlafende Kind, das zärtlich ein Puppenbaby an sich gedrückt hielt, noch einmal sorgsam zu; dann richtete sie sich auf. »Sie war übermüdet und wollte durchaus nur von mir zu Bett gebracht werden. Es dauerte dann eine ganze Weile, bis sie einschlief. Das kleine Herz war zu voll von all der Freude und mußte sich in vielen Worten erleichtern. – Wolltest du etwas von mir, da du mich überall suchtest, Swen?«
»Das eigentlich nicht«, gab er zurück und streichelte zärtlich über das wirre Lockenhaar seines Kindes. »Ich vermißte dich unten und befürchtete, daß dir etwas zugestoßen sein könnte.«
»Aber, Swen, du sollst doch nicht immer so ängstlich sein«, sagte sie vorwurfsvoll. »Wenn es nach dir ginge, dann würdest du mich wahrhaftig in Watte wickeln und in den Glasschrank stellen. Stimmt’s?«
»Auffallend, mein spöttisches Kind. Aber so seid ihr Frauen. Sorgt man sich um euch, dann spottet ihr. Tut man es nicht, beklagt ihr euch.«
Er schob seine Hand unter ihren Arm und zog sie mit sich fort zu ihrem Wohnzimmer hin. Drückte sie dort in einen Sessel, ohne auf ihr Sträuben zu achten.
»So, jetzt wirst du erst einmal eine halbe Stunde ganz ruhig sitzen, ehe du zu den andern zurückkehrst. Ich fürchte ernstlich, daß du dich heute überanstrengt hast, du leichtsinnige kleine Frau.«
»Du hast recht, Swen, es ist schön, eine Weile so ruhig zu sitzen«, gab sie offen zu. »Es war heute schon reichlich viel Trubel.«
»Gut, daß du das einsiehst. Du solltest heute überhaupt nicht mehr nach unten gehen.«
»Das muß ich aber, Swen. Die Mama und auch Hungolds würden gekränkt sein. Das Amt der Hausherrin ist nicht immer leicht, wenn auch schön und befriedigend.«
»Ganz wundervoll hast du dich eingelebt, Gerswint, bist jetzt eine vorbildliche Hausherrin. Und wie du den Trotzkopf Ilsetraut zu dir herangezogen hast, das macht dir sobald keiner nach. Mir hat die eigenwillige kleine Person nie so recht gehorchen wollen. Bei dir geschieht es aufs Wort. Kaum zu fassen ist das!«
»Du mußt mich nicht überschätzen«, wehrte sie errötend ab. »Ich habe für Ilsetraut nichts Besonderes getan.«
»Du sollst deine Vorzüge nicht so ängstlich verstecken«, gab er lächelnd zurück. »Ich kann dir jedenfalls nicht genug danken, daß du dich meines Kindes so liebevoll angenommen hast.«
»Aber, Swen, ich kann mich doch nicht einer Pflicht entziehen, die ich mit meiner Ehe übernommen habe«, sagte sie befremdet; Swen aber hatte Mühe, eine Entgegnung zurückzuhalten.
Pflicht! Da war dieses Wort wieder, das er bereits zu hassen begann. Dabei wollte sie ihn nicht etwa kränken, wenn sie es ihm immer wieder vorhielt. Sie nahm eben ihre Pflichten sehr genau. Er war ein Narr, wenn er hoffte, daß sie auch einmal etwas tun könnte, das einem anderen Gefühl entsprang als dem der Pflicht – oder der Dankbarkeit.
Wofür war sie ihm denn eigentlich dankbar? Daß er sie mit Rücksicht behandelte, wie es nun wiederum seine Pflicht war? Sie zu umsorgen, wie es ihm ums Herz war, das durfte er ja nicht wagen, ohne von ihr zurückgewiesen zu werden.
»Du machst ein Gesicht, als ob du mich nächstens fressen wolltest«, neckte Gerswint ihn. »Und nun komm, laß uns nach unten gehen. Ich habe ganz einfach keine Ruhe, hier zu sitzen, während unsere Gäste sich vielleicht langweilen.«
Sie erhob sich mit einer ihr sonst fremden Hast.
Er ließ sie gewähren und ging mit ihr nach den unteren Räumen, wo sie jedoch nur das Ehepaar Hungold und die Mama vorfanden. Elke war zu Bett gegangen, aber wo waren Edna und Wieloff?
Gerswint wollte über deren Abwesenheit gerade ihr Befremden aussprechen, als die Tür förmlich aufgerissen wurde, Edna ins Zimmer stürzte und an der Seite der Mutter niedersank.
»Mama, liebe, liebe Mama, Roger und ich…«, stammelte sie und zitterte dabei am ganzen Körper. »Sei gut, Mama, sag ja! Oder ich müßte dich wieder kränken; denn von Roger lasse ich nicht. Eher bringe ich mich um.«
Nach diesen eindringlichen, zu Herzen gehenden Worten war es im Zimmer so still, daß einer des andern Atemzüge hörte. Aller Augen hingen an der Männergestalt, die in der Nähe der Tür hochaufgerichtet stand. Das Gesicht todblaß, um den Kopf die Binde, durch die das Blut gesickert war, doch in den Augen ein glückliches Leuchten.
Frau Elisa sah den Mann lange an, dann neigte sie das Haupt wie gottergeben.
»Ich bin ja nun schon langsam daran gewöhnt, von meinen Kindern vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden«, sprach sie endlich, und es klang sehr bitter. »So bleibt mir ja nichts anderes übrig, als ja zu sagen.«
Daß alles so glatt gehen würde, das hätte Edna nicht erwartet. Und doch konnte sie sich nicht von ganzem Herzen darüber freuen; etwas in der Haltung der Mutter bedrückte sie.
»Mama, er ist der beste Mann der Welt«, beteuerte sie eifrig. »Lerne ihn nur näher kennen, und du wirst mir recht geben müssen.
Laß ihn doch nicht so stehen, Mama. Sage ihm doch ein gutes Wort!« bat sie leise, als die Mutter noch immer stumm und steif dasaß. »Kannst du dir denn gar nicht denken, wie du mich quälst?«
Da raffte Frau Elisa sich auf und streckte dem Mann, der noch immer regungslos an seinem Platz verharrte, die Hand entgegen.
»Sie haben eine gute Fürsprecherin, Herr Wieloff«, sagte sie mit leichtem Lächeln. »Sie müssen schon entschuldigen, daß ich ein wenig fassungslos bin.«
»Das kann ich verstehen, gnädige Frau«, erwiderte Wieloff, indem er sich tief über die feine Frauenhand beugte. »Ich wünschte, ich könnte den heißen Dank, den ich jetzt für Sie im Herzen trage, einmal beweisen.«
»Dazu werden sie schon noch Gelegenheit haben, Herr Wieloff.«
Die anderen kamen hinzu, gratulierten voll Herzlichkeit und wollten Näheres über den Unfall wissen. Wieloff erklärte ihn kurz, wobei Edna kleinlaut eingestand, daß sie ja den Arzt hatte benachrichtigen wollen.
»Also, da spielen sich in unserer nächsten Nähe die aufregendsten Dinge ab, die uns ganz schnöde vorenthalten werden«, beklagte sich Papa Hungold. »Sie sind ein ganz Scheinheiliger, Freund Wieloff. Läßt uns der Mensch seelenruhig in dem Glauben, daß er unlöslich in Fräulein Bottichs Netzen zappelt, und wirft in Wirklichkeit seine eigenen Netze nach der allerliebsten Edna aus. Ich habe Sie mehr als einmal in Gedanken einen armen Verblendeten genannt, was ich Ihnen jetzt von ganzem Herzen abbitte. Da hat also der Baron recht behalten, daß eine Hochzeit immer eine Verlobung nach sich zieht.«
*
Das alte Jahr verging; das neue kam und brachte viel Eis und Schnee mit sich. Waldwinkel lag wie in weiße Watte gebettet da und bot einen verträumten Anblick.
So gingen die Wochen dahin. Und an einem wunderschönen Sonnentage im Juli wurde der kleine Erbherr auf Waldwinkel geboren. Ein prächtiges Kerlchen, auf das hauptsächlich Sanitätsrat Melch sehr stolz war.
Der Baron, der heute ganz besonders blaß und verhärmt aussah, schaute stumm auf seinen Sohn, von dem der Arzt behauptete, es sei das schönste und gesündeste Kind der Welt.
»Und ein Hellersen bis ins kleinste. Den hätte unser Freund Leopold sehen müssen; ihm wäre das Herz aufgegangen vor Freude und Wonne – und vor Stolz und Glück.«
Swen tat die Freude des alten Herrn irgendwie weh, und er schritt langsam nach dem Nebenzimmer, wo die junge Mutter zu Tode erschöpft in ihren Kissen ruhte. Das feine Antlitz war wie Marmor so kalt und weiß, und so regungslos lag sie da, als wäre kein Leben in ihr.
Jäh verhielt Swen den Schritt. Eine unsinnige Angst sprang ihn an. Vergessen waren die Wochen vorher, alles ging unter in der Angst um die Frau, die er in Gefahr glaubte.
Mit wenigen Schritten stand er vor dem Bett und faßte behutsam nach der Hand, die so leicht und durchsichtig wie ein Blumenblatt in der seinen lag.
Da schlug sie die Augen auf und sah ihn an. Unergründlich und rätselhaft war ihr Blick.
Und dann ihre Stimme – so müde, so zerquält, so unendlich bitter: »Der Erbe ist geboren. Ich glaube, nun habe ich meine Pflicht restlos erfüllt.«
Er zuckte zusammen wie unter einem Hieb. Und die vielen herzlichen und reumütigen Worte, die er auf den Lippen gehabt, blieben unausgesprochen. Er zog ihre Hand nur leicht an die Lippen, murmelte einen Dank und ging dann rasch hinaus. Fiel in seinem Arbeitszimmer buchstäblich in einen Sessel, wühlte mit beiden Händen im Haar und stöhnte wie ein Tier.
»Mein Gott, das ertrage ich nicht! Ich ertrage es einfach nicht länger! Ich werde entweder wahnsinnig – oder ich bringe mich um! Etwas anderes ist kaum noch möglich.«
Wenn nur endlich erst das Herz Ruhe geben wollte! Dieses bohrende, nagende, ätzende Gefühl mußte den Menschen ja mit der Zeit wahnsinnig machen.
Es war, als höre er wieder einmal die brüchige Stimme des Onkels: »Du bist ein echter Hellersen, und die sind nie von der Liebe verschont geblieben. Sie müssen durch Himmel und Hölle.«
Sein verzweifelter Blick suchte das Bild des Heimgegangenen.
»Durch den Himmel bin ich nicht gegangen, Onkel Leopold«, murmelte er mit zuckenden Lippen. »Aber durch die Hölle werde ich geschleift. Jetzt weiß ich, wie du gelitten haben mußt und kann deinen Haß und deine Menschenscheu verstehen.«
*
Das alte ehrwürdige Waldwinkler Schloß prangte in festlichem Schmuck; denn der Erbe wurde heute getauft.
Es hatten sich fast ebenso viele Menschen eingefunden wie zur Hochzeit. Überall herrschte frohe Erwartung und emsiges Treiben.
Frau Elisa hatte die Festgestaltung wieder zuverlässig in ihre Hände genommen, und daher klappte alles ganz ausgezeichnet. Sie war sehr stolz auf den erstgeborenen Enkel und erzählte jedem mit Genugtuung, daß er ein echter Hellersen sei.
Die junge Mutter war eben dabei, mit Hilfe der Pflegerin dem Täufling das kostbare Kleid, das schon viele kleine Hellersen vor ihm zur Taufe getragen hatten, anzuziehen. Dabei mußte sie noch die unzähligen Fragen beantworten, die Ilsetraut, die schon im Festkleide neben ihr stand, mit bewundernswerter Ausdauer stellte. Sie galten natürlich alle dem Brüderchen, das ihr Entzücken von Tag zu Tag immer mehr erregte.
Die Tauffeierlichkeit in der Kapelle war ergreifend schön. Man konnte keinen Blick wenden von der wunderschönen Mutter, die ihr Kind so stolz und frei hielt, während sie einen Arm um das Töchterlein geschlungen hatte, das sich zärtlich an sie schmiegte.
Bolko und Roger waren Pate und entledigten sich ihres Amtes mit viel Würde und Stolz. Wieloff hatte sich in der Ehe so verändert, daß er kaum wiederzuerkennen war. Der düstere Ernst war von ihm gewichen, und es gab Stunden, da er sogar lustig sein konnte. Bolko war vollends wie ein ausgelassener Junge.
»Du siehst aus, als wenn du jeden Tag das große Los gewännest«, neckte ihn der Baron später, als man sich nach dem Festessen in den prächtigen Räumen tummelte, mit leichtem Spott. Der Schwager lachte ihn vergnügt an.
»Tue ich auch. Mit einer Frau wie Ellen ist das gewiß kein Kunststück. Übrigens, du, unterm Weihnachtsbaum wird in Hirschhufen Taufe gefeiert. Bei uns findet alles unterm Weihnachtsbaum statt.«
»Großartig, du mußt immer etwas Besonderes haben! Und wie ist es mit Roger?« fragte er ihn, der lächelnd dabei stand.
»Der wird sich selbstverständlich nicht lumpen lassen«, antwortete Bolko für ihn. »Der feiert Taufe am Frühlingsanfang. Stimmt’s, Schwagerherz?«
»Auffallend, Bolko.«
Swen lachte und ging weiter seinen Gastgeberpflichten nach, die heute gewiß nicht leicht waren, zumal ihm miserabel zumute war.
Sein finsterer Blick ging zu Gerswint hin, die in einer Gruppe ältlicher Damen stand und lebhaft mit ihnen plauderte.
Wie unwiderstehlich sie dieses frische, unbekümmerte Lachen machte! Überhaupt hatte die Mutterschaft sie noch frischer und köstlicher gemacht.
Auch weicher schien sie geworden zu sein, milder und zugänglicher. Allerdings nicht zu ihm. Er wurde strenger denn je mit Blick und Wort in Schach gehalten, damit er ja nicht die ihm gesetzte Schranke überschritte. Sie war keineswegs unfreundlich zu ihm, manchmal sogar liebenswürdig. Aber darauf brauchte er sich beileibe nichts einzubilden.
Pflicht, Pflicht und nochmals Pflicht!
Sein Gesicht verfinsterte sich immer mehr, und es waren gar rebellische Gedanken, die sich hinter seiner Stirn jagten.
Jetzt machte er endgültig Ernst; er wollte wissen, woran er war. Entweder ließ sich seine verpfuschte Ehe in die gewünschte Bahn bringen, oder er ging auf und davon.
Mit Ungeduld sehnte er das Ende des Festes herbei und war froh, als er sich in seine Zimmer zurückziehen konnte. Dort vertauschte er den Frack mit dem Hausrock und begab sich unverzüglich in die Räume seiner Gattin. Ein Ausdruck entschlossener Härte lag ihm um Augen und Mund, wie eingemeißelt, und seine Gestalt war gestrafft, als gelte es einen erbitterten Kampf auszutragen.
In ihrem Zimmer war Gerswint nicht; er hörte jedoch ihre Stimme aus dem Kinderzimmer. Kurz entschlossen ging er dorthin und blieb in der Tür stehen.
Also so konnte seine Frau sein, so heiter und vergnügt. Konnte so strahlende Augen haben und so köstlich froh lachen! Und wie betörend sie aussah! Wie sie mit dem kleinen Knaben, den die Pflegerin umbettete, scherzte und koste.
Er stand regungslos da, und das Herz wurde ihm immer schwerer. Ein tiefer Seufzer klang auf und ließ Gerswint erschrocken herumfahren. Sofort verschwand das strahlende Lächeln von ihrem Gesicht, da sie den Gatten in der Tür stehen sah. Sie drückte rasch einen Kuß auf die kleine Kinderhand und ging Swen entgegen, der jetzt langsam ins Zimmer trat.
»Suchst du mich, Swen?«
»Ja.«
Das klang hart und schroff, und Gerswint sah voll banger Sorge in sein finsteres Gesicht, das sich auch nicht aufhellte, als er zu seinem Jungen trat. Er verweilte, bis das Kind in seinem Bettchen lag, und verließ dann mit einem kurzen Gruß das Gemach. Gerswint sprach noch hastig einige Worte mit der Pflegerin und folgte dann dem Gatten, der in ihrem Wohnzimmer den Schritt verhielt.
»Möchtest du noch mit mir plaudern?« fragte sie, nicht wissend, was sie von seiner eisigen Haltung zu erwarten hatte.
»Ja. Das heißt nur, wenn du es nicht als Pflicht auffaßt.«
Sie errötete bis zur Stirn hinauf und wies ihm stumm einen Sessel zu, während sie ihm gegenüber Platz nahm. Sie war so unbeholfen und verlegen, wie er sie noch nie gesehen hatte, und errötete und erblaßte in raschem Wechsel unter seinem unentwegten Blick.
»Swen, ich weiß nicht…«, begann sie endlich ratlos. Da lachte er kurz auf: »Nein, du weißt nicht, selbstverständlich nicht. Ich sitze eigentlich hier, um dir endlich für den Jungen zu danken, weiß aber nicht, wie ich meine Worte wählen soll, ohne von dir mit der Bemerkung, daß du nur deine Pflicht erfüllt hättest, zurückgewiesen zu werden.«
»Ist es aber nicht so, Swen? Ich gebe mir doch alle Mühe, meine Pflichten zu erfüllen und mich nicht zu beklagen wie – du. Ich bin…«
»Das Vorbild einer Herrin und Mutter«, warf er hart ein. »Nur das einer Gattin bist du nicht. Und das ist es, worüber ich mich beklagen muß.«
»Swen, ich bitte dich, wohin soll das führen, wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist?« stellte sie ihm eindringlich vor. »Es nützt dir doch alles nichts, und wenn du noch so sehr an deinen Ehefesseln zerrst. Du kannst ja doch nicht loskommen.«
»So. Und das sagst du mir so ganz ruhig ins Gesicht? Und wenn ich doch loskomme, was dann?«
»Dann kann ich dich natürlich nicht halten«, entgegnete sie müde. »Es muß jeder sein Tun selbst verantworten. Glaube nur nicht, daß mir das Leben so leicht fällt. Ich sage mir aber, daß alles Murren und Aufbegehren mir doch nichts nützen würde und sehe daher zu, mir mein Los so erträglich wie möglich zu gestalten.«
»Ach, sieh mal einer an! Ich hätte nicht geglaubt, daß du eine so große Lebenskünstlerin bist«, spottete er. »Natürlich, wer so wenig temperamentvoll ist wie du, der kann alles von der hohen Warte der Ruhe und Gelassenheit aus betrachten.«
»Swen, du mußt nicht über Menschen urteilen, die du so wenig kennst wie mich«, sagte sie wohl immer noch ruhig, aber an den ruckartigen Bewegungen, mit denen sie die Hände in dem Schoß verkrampfte, sah er, daß sie lange nicht so ruhig war, wie sie scheinen wollte.
»Du kannst ja gar nicht wissen, ob es nicht auch für mich Stunden gibt, in denen ich trotz aller Vernunft, die ich mir immer wieder predige, an den Ehefesseln so sehr zerre, daß sie nicht nur ins Fleisch, sondern auch ins Herz schneiden. Glaube doch nicht, daß es leicht für mich zu ertragen ist, an einen Mann gefesselt zu sein, der noch immer mit jeder Faser seines Herzens an seiner ersten Frau hängt. Der an ihrem Bild Trost und Halt sucht, wenn die Fesseln seiner Pflichtehe ihn gar zu sehr drücken. Ich – ich habe doch schließlich auch ein Herz und das Recht auf Glück und auf…«
Ihre Stimme brach. Mit einer unendlich verzweiflungsvollen Gebärde drückte sie ihr Gesicht in die Polster des Sessels. Ein so hemmungsloses Schluchzen erschütterte ihren Körper, daß Swen zu Tode erschrocken aufsprang und die weinende Frau umfaßte. Er merkte, wie sie unter seiner Berührung zusammenzuckte, umschloß sie jedoch nur noch fester mit beiden Armen und richtete die haltlose Gestalt vorsichtig auf.
»Dumme kleine Frau«, schalt er zärtlich. »Sich so zu erregen.«
Er wischte ihr behutsam die Tränen vom Gesicht, drückte sie tiefer in den Sessel hinein und schob ihr ein Kissen in den Nacken. Mit tiefer Unruhe beobachtete er, wie sie immer wieder zusammenschauerte. Las nur zu deutlich tiefe Qual aus dem marmorweißen Antlitz.
Er faßte nach der verkrampften Hand in ihrem Schoß, und als sie sie ihm widerstandlos ließ, griff er auch nach der andern. Er sprach kein Wort, wollte ihr erst Zeit lassen, sich zu beruhigen. Eine unsinnige Angst schnürte ihm Herz und Kehle zusammen. Ihm war zumute wie ein Verbrecher, der sein Urteil erwartet. Was würde er in den nächsten Minuten zu hören bekommen? Denn er wollte jetzt Klarheit schaffen um jeden Preis! Mochte eine restlose Aussprache das Ende seiner Hoffnungen bringen, er hielt dieses zermürbende Hangen und Bangen nicht länger aus.
Jetzt schlug Gerswint die Augen auf und sah ihn mit einem Blick an, der ihn erschütterte.
»Swen, ich benehme mich wie ein ungezogenes Kind«, verspottete sie sich selbst und wandte ihren Kopf unter seinem rätselhaften Blick zur Seite; sie versuchte ihre Hände aus den seinen zu ziehen; doch er hielt sie eisern fest.
»Gerswint, heute entschlüpfst du mir nicht!« sagte er mit schwerem Ernst. »Heute will ich endlich Klarheit zwischen uns schaffen. Denn soeben ist mir mit erschütternder Deutlichkeit klargeworden, daß nicht nur ich an dieser Ehe langsam aber sicher zugrunde gehe, sondern daß es dir auch so geht. Deine straffe Selbstbeherrschung hat mich bisher so täuschen können, daß ich dich für eine gefühlsarme Natur gehalten habe. Daß du das aber nicht bist, das habe ich in dieser Stunde erkennen müssen.
Gerswint«, bat er warm und eindringlich, »sieh bitte in mir den Menschen, der es von allen auf der Welt am besten mit dir meint. Laß mich einen Blick in dein Herz, in dein Gefühlsleben tun, damit ich doch weiß, woran ich bin. Und sollten mich deine Offenbarungen auch noch so vernichtend treffen, ich werde mich so oder so mit ihnen abfinden.«
Da ging ein unsäglich bitteres Lächeln über ihr bleiches Gesicht.
»Gut, Swen«, sagte sie entschlossen und richtete sich aus ihrer haltlosen Stellung auf. »Ich soll dir mein Herz erschließen? Das ist doch so einfach, Swen. Es ist mir trotz aller erbitterten Fehde, in der ich mit meinem Herzen lag, nicht gelungen, es zu besiegen. Ich bin nun kampfesmüde geworden. Lache mich aus, nenne mich einen Schwächling, aber ich – ich…«
Weiter kam sie nicht; denn Swen riß sie in seine Arme und preßte seine Lippen auf ihren zuckenden Mund. Lachte wie ein übermütiger Junge in ihre entsetzten Augen hinein.
»Gerswint, liebe kleine Frau, du brauchst nichts mehr zu sagen. Ich will ja nichts weiter, als daß du mich liebhast – nur einen Teil so lieb, wie ich dich liebe.«
»Ja, aber Ilse?«
»Werde ich stets ein liebevolles Gedenken bewahren«, fiel er ihr ernst ins Wort. »Aber mein Herz, mein ungestümes heißes Herz, das hat sich schon längst von ihr gelöst. Eigentlich schon in dem Augenblick, da ich dich zum erstenmal in meinen Armen hielt. Und als du dann die Schranke zwischen uns errichtetest, da litt ich, litt bis zum Wahnsinn.«
»Oh, mein Gott, Swen, da habe ich mich ja schwer versündigt«, bekannte sie voll tiefer Scham und ließ den Kopf an seine Schulter sinken.
»Das hast du auch, du grausame, kleine Person! Aber wie ich hoffe, wirst du das nun doppelt gutmachen.«
»Und wie gern, Swen. Ich wußte zuletzt nicht mehr aus noch ein. Wie sehr ist es mir da zustatten gekommen, daß meine Mutter mich seit frühester Kindheit an die Kunst der Selbstbeherrschung gelehrt.«
»Mir wäre weniger Selbstbeherrschung lieber gewesen«, bekannte er trocken. »Dann hättest du dich nicht so zusammennehmen können, und ich hätte dich früher durchschaut. Nun ist doch aber alles restlos geklärt, Liebste?«
Sie preßte ihren Kopf an seine Brust, und er zog sie fest an sich.
»Gerswint, du mein Herzliebstes«, sagte er mit verhaltener Stimme. »Jetzt erst soll unser Leben schön werden; denn es wird von heißer Liebe durchflutet sein. Jetzt haben wir es nicht mehr nötig, unsere Herzen zu befehden, sondern können die Liebe darin walten lassen.
Und jetzt erst kann ich Onkel Leopold für sein Erbe von ganzem Herzen dankbar sein und voll Verehrung und Liebe seiner gedenken.«