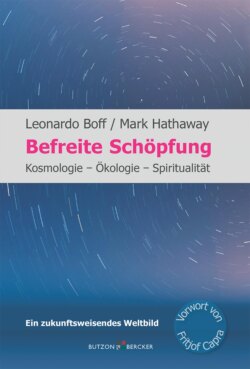Читать книгу Befreite Schöpfung - Leonardo Boff - Страница 10
ОглавлениеTeil I: Erkundung der Hindernisse
2. Ein pathologisches System entlarven
In Einklang mit dem Tao
ist der Himmel klar und rein,
die Erde ist in ruhiger Heiterkeit und ganz,
der Geist wird mit Kraft erneuert,
Flussbette werden wieder gefüllt,
die Myriaden von Kreaturen der Welt gedeihen und leben in Fröhlichkeit,
Anführer sind auf Frieden bedacht,
und ihre Länder werden in Gerechtigkeit regiert.
Wenn die Menschheit in das Tao eingreift,
wird der Himmel trüb,
die Erde wird ausgebeutet,
der Geist erschlafft,
Ströme trocknen aus,
das Gleichgewicht gerät aus den Fugen,
Kreaturen werden ausgelöscht …
(Tao Te King § 39)
Wenn Herrscher im Glanz leben und Spekulanten gedeihen,
während Bauern ihr Land verlieren und die Kornspeicher sich leeren;
wenn Regierungen Geld für Prunk und Waffen ausgeben;
wenn die Oberschicht extravagant und verantwortungslos ist,
nachsichtig mit sich selbst, und mehr besitzt, als sie jemals benutzen kann,
während die Armen nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.
All das ist Raub und Chaos,
es hat mit dem Tao nichts gemein.
(Tao Te King § 53)
Ein erster Schritt auf dem Weg hin zu einer Welt, in der Leben, Schönheit und Würde wirklich gedeihen können, besteht darin, die jetzige Wirklichkeit unseres Planeten zu verstehen. Wie wir bereits gesehen haben, leben wir in einer Zeit, in der die Ökosysteme der Erde in raschem Tempo zerstört werden, wobei eine kleine Minderheit der Menschheit ihr Monopol auf den weltweiten Wohlstand behauptet. Inzwischen vollziehen sich tiefgreifende und rasche Veränderungen in der Organisationsweise der Gesellschaft. In vieler Hinsicht stehen wir vor einem Scheideweg. Technische Durchbrüche auf den Gebieten der Kommunikation, der Computertechnik und der Gentechnik vergrößern die Macht des Menschen wie niemals zuvor. In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Welt auf allen Ebenen dem Diktat des „Marktes“ und des Profitstrebens unterworfen. In politischer Hinsicht entwickeln sich die transnationalen Konzerne zu den beherrschenden Mächten der Welt. Dabei erhalten sie Rückendeckung von der militärischen Macht der Länder, die ihren Interessen zu Diensten sind. In kultureller Hinsicht setzen die Massenmedien die Werte und Sehnsüchte des Konsumismus weltweit durch.
Vielen gilt diese Art von „Globalisierung“ als unvermeidlich. Und in der Tat versichern uns diejenigen, die als Sprachrohr der beherrschenden Mächte fungieren, dass sich dies so verhält. Es gibt keine Alternative.
Aber was wäre nun, wenn die Krisen der Armut und der ökologischen Zerstörung, mit denen wir es zu tun haben, nicht einfach nur zufällige Nebeneffekte oder „Kinderkrankheiten“ unseres wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Systems sind? Was wäre, wenn sie nicht einfach durch einige kleinere Reparaturarbeiten zu beheben sind? Wenn eine innere Erkrankung das Wesen dieser Krisen ausmacht? Wären wir dann nicht gezwungen, den Weg, auf dem wir uns befinden, neu zu überdenken und nach Alternativen zu suchen? Stünden wir dann nicht vor der Herausforderung, in neuer, kreativer Weise unser Denken und Handeln darauf auszurichten, zu verändern, was bisher als unvermeidlich galt?
Tatsächlich sind wir davon überzeugt, dass dem System selbst, das zurzeit unsere Welt beherrscht und ausbeutet, eine tief liegende Erkrankung innewohnt. In diesem Kapitel werden wir versuchen, dieses pathologische Phänomen aufzudecken. Dabei verfolgen wir nicht die Absicht, unsere Leser ohnmächtig oder überfahren zurückzulassen. Ganz im Gegenteil, der erste Schritt zur Genesung ist es, zu akzeptieren, dass wir krank sind, und diese Krankheit zu verstehen. In gewissem Sinne leben wir alle in einer Art kollektivem Wahn, in dem das, was sowohl unlogisch als auch zerstörerisch ist, als normal und unvermeidlich gilt. Natürlich mag es für diejenigen, die am meisten an dieser Erkrankung zu leiden haben, völlig klar sein, dass wir es mit einer grundsätzlichen Störung zu tun haben: für die Kreaturen, deren Lebensraum zerstört wird, und für die große Mehrheit der Menschheit, die an den Rändern unserer neuen globalen Wirtschaft lebt. Andererseits mag es für diejenigen, die (wenigstens kurzfristig) von den Vorteilen des Systems profitieren, weniger klar sein, dass wir es mit einer Krankheit zu tun haben. Für alle aber wirft eine gründlichere Analyse des Systems Erkenntnisse ab, die uns allen helfen können, die herrschende (Un-)Ordnung10 herauszufordern und Alternativen ins Auge zu fassen.
Worin besteht nun die Erkrankung unserer Welt? Ein erster Schritt besteht darin, die Symptome dieser Krankheit, die unseren Planeten heimsucht, näher zu betrachten – eine Krankheit, die in der Art und Weise ihren Ursprung hat, wie die Gesellschaft zurzeit organisiert ist. Konkret werden wir sowohl die Probleme von Armut und Ungleichheit als auch die ökologischen Probleme näher betrachten, die daraus resultieren, dass wir durch Raubbau und Verschmutzung über die Grenzen der Erde „hinausschießen“.
Krankheitssymptome
Armut und Ungleichheit
Ein erstes Krankheitssymptom ist die größer werdende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Viele mögen dagegen einwenden, dass finanziell gesehen die Menschheit heute reicher ist als jemals zuvor in ihrer Geschichte. Wir leben in einer Welt voller Wunder, die sich unsere Vorfahren vor einem Jahrhundert kaum vorstellen konnten: schnelles Reisen und rasche Kommunikation, eine hoch entwickelte Medizin, Maschinen, die Arbeit einsparen, und komfortabler Luxus. Einigen Schätzungen zufolge gibt es zurzeit eine größere Vielfalt an Konsumgütern als an lebenden Arten. Insgesamt produzieren die Menschen jetzt fast fünfmal so viel pro Kopf als vor hundert Jahren. (Little 2000)
Doch dieses schier unglaubliche Wachstum von Wohlstand hat nicht zur Ausrottung oder wenigstens zu einer deutlichen Verringerung der menschlichen Armut geführt. Tatsächlich blieb der Anteil der Menschen, die in Armut leben, während der letzten fünfzig Jahre relativ konstant. (Korten 1995). Einen echten Fortschritt gab es im Hinblick auf die Kindersterblichkeit, die Verlängerung der Lebenserwartung, der Alphabetisierungsrate und verbessertem Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung. Dennoch lebt fast ein Drittel der Weltbevölkerung immer noch von einem US-Dollar am Tag. Wenn man genauer hinsieht und insbesondere das Wegbrechen traditioneller Kulturen, Lebensweisen und der diese tragenden Ökosysteme betrachtet, dann gelangt man zur Feststellung, dass sich die tatsächliche Lebensqualität von vielen der Armen dieser Welt verschlechtert hat.
Inzwischen hat sich der Gegensatz zwischen Arm und Reich zu einer tiefen Kluft ausgeweitet. Relativ gesehen sind Asien, Afrika und Lateinamerika tatsächlich ärmer als wir vor hundert Jahren. Weltweit hat sich die Disparität der Einkommen zwischen Reichen und Armen verdoppelt. Schlimmer noch: Immer noch werden große Mengen an Reichtum von den ärmeren in die reicheren Länder transferiert. Für jeden Dollar an Entwicklungshilfe fließen drei als Schuldendienst in den Norden zurück. Der Nettotransfer von Reichtum ist sogar noch größer, wenn man die unfairen „Terms of trade“ (d. h. das Austauschverhältnis von Import- und Exportprodukten; d. Übers.) betrachtet, die die armen Länder zu niedrigen Löhnen und niedrigen Warenpreisen zwingen.
Wenn man den Wohlstand betrachtet, dann ist die Größenordnung der Ungleichheit sogar noch schockierender. Die drei reichsten Menschen der Welt verfügen über ein Vermögen, das das Bruttosozialprodukt der 48 ärmsten Länder zusammengenommen übersteigt. Wie wir bereits angemerkt haben, verfügen die Milliardäre zusammen über ein Vermögen von 2,4 Billionen US-Dollar; das ist mehr als das jährliche Einkommen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung. Im Vergleich dazu betrügen die Gesamtkosten für eine Grundschulbildung, eine medizinische Grundversorgung, angemessene Ernährung, sauberes Trinkwasser und Kanalisation für all diejenigen, die dies alles bislang nicht haben, bloß 40 Milliarden US-Dollar im Jahr, das heißt weniger als 2 % des Vermögens der weltweit Reichsten. (UNDP-Bericht 1998) Vor Kurzem wurden die zusätzlichen Kosten für die Millennium-Ziele der Entwicklungspolitik – die über die bereits angeführten Ziele hinaus noch die Eindämmung von HIV/Aids und der Malaria und die Erhaltung der Umwelt umfassen – von der Weltbank auf 40 bis 60 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt. Das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) rechnet dagegen hoch, dass im Jahr 2007 weltweit jede Woche (!) 25 Milliarden US-Dollar für militärische Zwecke ausgegeben wurden.
Der unmittelbare Eindruck, der sich aufdrängt, wenn man diese Tatsachen bedenkt, ist, dass die Armut innerhalb der menschlichen Gesellschaft grundsätzlich nicht auf einen Mangel an Reichtum oder Ressourcen zurückzuführen ist, sondern eher auf die beschämende Verteilung der Reichtümer der Welt. Gandhi sagte: „Die Erde hat genug, um die Bedürfnisse aller zu befriedigen, aber nicht genug, um die Gier derjenigen zu stillen, die einem unvernünftigen Konsum nachjagen.“
Ein zweiter Gedanke, der einem in den Sinn kommt, ist: Während die Armut an sich unsagbares Leid hervorruft, wird dieses durch die Ungleichheit noch verschlimmert. Dies gilt besonders für die heutige Welt, in der selbst die ärmsten Menschen mit Radio, Fernsehen und Werbung konfrontiert sind. Je mehr die Massenmedien das Bild eines „Konsumparadieses“ für wenige verbreiten, umso stärker wachsen Entfremdung und Verzweiflung unter den Armen. Die Suggestion der Medien untergräbt auch die traditionellen Ressourcen des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Kultur, Familie, Tradition). Während die ökologische Verwüstung ihren Lauf nimmt, schwindet auch der materielle und spirituelle Halt, den traditionelle Lebensweisen sowie die Schönheit der Natur geboten haben.
Raubbau an der Erde
Das zweite Leitsymptom der Erkrankung ist die rasch voranschreitende Ausplünderung der Reichtümer der Erde, darunter sauberes Trinkwasser, saubere Luft, fruchtbares Ackerland und eine reichhaltige Vielfalt von Lebenszusammenhängen. Dieselbe Gier, die die Armut von Menschen verursacht, lässt auch die Erde selbst verarmen. Der Konsum der Menschen beansprucht einen immer größeren Teil der natürlichen Reichtümer der Erde. Dabei handelt es sich um einen Reichtum, dessen Wert nicht in Geld ausgedrückt werden kann, weil er die Basis des Lebens selbst ist. In einer eher technischen Sprache heißt das, dass wir Zeugen der Erschöpfung der „Ressourcen“ der Erde sind. Unsere Welt tritt gerade in eine Periode des „Niedergangs“ ein, in der die Menschheit die allen gemeinsamen Güter der Erde schneller verschlingt, als diese sich erneuern können.11
Dieser Prozess des „Niedergangs“ bedroht unsere Fähigkeit, die Nahrungsmittelproduktion aufrechtzuerhalten. Die moderne Agrarwirtschaft benutzt Chemikalien, um das Wachstum der Pflanzen zu fördern und die Erträge kurzfristig zu vergrößern, doch dabei gehen Nährstoffe verloren, die nicht rechtzeitig ersetzt werden können. Dies führt zur Verschlechterung der Böden und der Qualität der Nahrungsmittel. Der Boden wird einfach als „Wachstumsmedium“ behandelt und nicht als ein komplexes Ökosystem, in dem jedes Gramm Erde eine Milliarde Bakterien, eine Million Pilze und Zehntausende von Protozoen enthalten kann. „Der Boden bringt Leben hervor, weil er selbst lebendig ist.“ (Suzuki/McConnell 1997, 80) Es dauert fünfhundert Jahre, bis eine 2,5 cm hohe Schicht von Ackerboden entsteht, und dennoch verlieren wir 23 Milliarden Tonnen Boden jedes Jahr. Das heißt, dass wir in den letzten zwanzig Jahren fruchtbaren Boden in der Größenordnung verloren haben, wie sie dem Ackerland Frankreichs und Chinas zusammengenommen entspricht. Jedes Jahr benutzen oder zerstören wir 40 % von den 100 Milliarden Tonnen fruchtbaren Bodens, den die Ökosysteme der Erde schaffen.
Die extensive Bewässerung führt inzwischen zu einer weit verbreiteten Versalzung, und der Maschineneinsatz auf Randflächen hat weitere Bodenerosion zur Folge. Nimmt man dazu noch die Auswirkungen des Klimawandels, dann führen all diese Faktoren zu einem Verlust bebaubaren Landes und dessen Verwandlung in Wüste: Zwischen 1972 und 1991 ging mehr Ackerland an die Wüste verloren als die Fläche, die in China und Nigeria zusammengenommen bestellt wurde. Man schätzt, dass nun 65 % des einst bebaubaren Landes bereits Wüste sind.
Die in biologischer Hinsicht reichhaltigsten Ökosysteme an Land, die Wälder, werden ebenfalls zerstört. Im Lauf der letzen zwanzig Jahre war von der Entwaldung eine Fläche betroffen, die größer ist als die Vereinigten Staaten östlich des Mississippi. Mehr als die Hälfte der Waldbestände, die 1950 noch existierten, sind nun abgeholzt. Es geschieht auch einiges an Wiederaufforstung. Doch diese neu gepflanzten Wälder sind oftmals nicht viel mehr als Baumplantagen, die eine weitaus geringere Vielfalt und Dichte lebendiger Arten beherbergen als die alten Wälder, die sie ersetzen sollen. Es überrascht daher nicht, dass Hunderttausende von Pflanzen- und Tierarten für immer verschwunden sind und weitere tausendmal schneller aussterben als jemals zuvor seit dem Verschwinden der Dinosaurier.
Auch die Ozeane, die 99 % des Lebensraums auf unserem Planeten ausmachen und in denen 90 % aller Arten leben, sind tiefgreifenden Veränderungen unterzogen. Mindestens ein Drittel des CO2 und 80 % der Wärme, die durch den Klimawandel entsteht, werden von den Ozeanen absorbiert. Dies wiederum ändert den Säuregehalt, die Eisdecke, das Volumen und den Salzgehalt der Meere und kann möglicherweise Meeresströme verändern, die einen großen Einfluss auf das Klima haben. Ein Viertel aller Korallenriffe – die Ökosysteme mit der größten Artenvielfalt im Meer – wurde bereits zerstört, und gut die Hälfte der noch existierenden sind gefährdet. Die tiefgreifenden chemischen Veränderungen in den Ozeanen können wahrscheinlich auch das Plankton gefährden, das eine Hauptnahrungsquelle für andere Meerestiere darstellt und auch die wichtigste Lunge des Planeten ist, da es ganze 50 % des Sauerstoffs produziert. (Mitchell 2009)
Grundwasser, das sich über Millionen von Jahren in riesigen grundwasserführenden Schichten angesammelt hat, wurde im Lauf des letzten Jahrhunderts rasch verbraucht, und wahrscheinlich wird sich die Rate der Entnahme im nächsten Vierteljahrhundert um weitere 25 % erhöhen. Viele Menschen sehen sich jetzt schon mit chronischem Wassermangel konfrontiert, und diese Probleme werden sich in vielen Regionen der Welt im Lauf des nächsten Jahrzehnts wahrscheinlich verschärfen. Erdöl und Kohle, die im Laufe von 500 Millionen Jahren entstanden sind, könnten zur Mitte des nächsten Jahrhunderts völlig erschöpft sein (und der Kohlenstoff, den die Erde so sorgfältig in sich eingeschlossen hat, um ihre Atmosphäre stabil zu halten, wird wieder freigesetzt). Wir sind bereits sehr nah am „Peak oil“, das heißt dem Fördermaximum von Erdöl, und die Nachfrage wird sehr bald das Angebot übertreffen. Dazu kommt, dass viele wichtige metallische Rohstoffe wie Eisen, Bauxit, Zink, Phosphat und Chrom im Lauf dieses Jahrhunderts nahezu völlig erschöpft sein werden.
Jede Minute eines jeden Tages
– verlieren wir – meist durch Brandrodung ‒ eine Fläche an tropischem Regenwald, die fünfzig Fußballfeldern gleichkommt;
– verwandeln wir einen halben Quadratkilometer Land in Wüste und
– verbrennen so viele fossile Brennstoffe, dass die Erde zehntausend Minuten bräuchte, um diese wieder mithilfe des Sonnenlichts zu produzieren. (Ayers 1999 b)
Es wird geschätzt, dass bereits jetzt die reichsten 20 % der Menschheit mehr als 100 % dessen verbrauchen, was die Erde nachhaltig hervorbringt, während die verbleibenden 80 % weitere 30 % davon verbrauchen (und dabei handelt es sich um eher vorsichtige Schätzungen). Mit anderen Worten: Wir sprengen jetzt schon die Grenzen der Erde. Es leuchtet unmittelbar ein, dass ein relativ kleiner Teil der Menschheit für diese Situation verantwortlich ist. Der übermäßige Konsum der Wenigen lässt die gesamte planetarische Lebensgemeinschaft verarmen. Einige Ökologen schätzen, dass in den fünfundzwanzig Jahren zwischen 1970 und 1995 ein Drittel des „natürlichen Kapitals“ der Erde verloren ging (Sampat 1999). Und die Ausbeutungsrate hat sich seither weiterhin beschleunigt. Es ist klar, dass eine solche Ausplünderung des Reichtums unseres Planeten nicht ohne ernsthafte, lebensbedrohende Folgen für uns alle weitergehen kann.
Die Vergiftung des Lebens
Das dritte Krankheitssymptom könnte die größte Bedrohung für uns alle darstellen. Da wir einen stetig wachsenden Berg von Abfall produzieren, überschreiten wir die Kapazitäten der natürlichen „Senken“ des Planeten, Schadstoffe zu absorbieren, unschädlich zu machen und wieder dem natürlichen Kreislauf zuzuführen. Noch schlimmer: Wir bringen chemische und nukleare Schadstoffe in die Umwelt ein, die langfristig bleiben, und wir verändern die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre selbst. Diese Probleme der Tragfähigkeit des Planeten untergraben die Gesundheit aller Lebewesen und deren Lebensräume in ernsthafter Weise. Dazu folgende Beispiele:
– Siebzigtausend vom Menschen produzierte Chemikalien wurden in die Luft, das Wasser und den Boden freigesetzt, die meisten davon in den letzten fünfzig Jahren, und jedes Jahr werden etwa tausend neue Chemikalien erzeugt. Die jährliche Produktion synthetischer organischer Stoffe hat von sieben Millionen Tonnen im Jahr 1950 auf fast eine Milliarde Tonnen heute zugenommen (Karliner 1997). Davon wurden 80 % niemals auf ihre Toxizität hin getestet. (Goldsmith 1998). Jede Minute sterben fünfzig Menschen an Vergiftung durch Pestizide (Ayers 1999 b), und jeden Tag werden eine Million Tonnen gefährliche Abfälle produziert (Meadows et al. 1992).
– Weiterhin wird Atommüll produziert, ohne dass man sichere Lagerstätten dafür hat. Teilweise bleibt dieser Müll 250.000 Jahre lang radioaktiv. In der ganzen Welt gibt es mehr als 1800 Tonnen Plutonium. Dieses Element ist so giftig, dass bereits eine Millionstel Unze davon für einen Menschen tödlich sein kann. Bloß acht Kilogramm davon genügen, um eine Bombe daraus herzustellen, die dieselbe Zerstörungskraft wie die von Hiroshima hat.
– Wir haben riesige Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt, und zwar dreimal so viel, wie die natürlichen Kreisläufe normalerweise absorbieren können. Dadurch wurde ein gefährlicher Kreislauf globaler Erwärmung und Destabilisierung des Klimas in Gang gesetzt. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass dies die stärkste Veränderung des Erdklimas seit dem Beginn des Eozäns vor etwa 55 Millionen Jahren ist (Lovelock 2008). Gleichzeitig haben wir durch die Zerstörung der Wälder und der maritimen Ökosysteme die Fähigkeit der Erde, Kohlendioxid aus der Luft zu binden, ernsthaft vermindert. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist nun höher als jemals zuvor in den letzten 160.000 Jahren, und die weltweite Durchschnittstemperatur ist bereits um 5 Grad Celsius angestiegen. Bei den derzeitigen Emissionsraten wird sich der CO2-Gehalt in den nächsten fünfzig Jahren verdoppeln, und die globale Durchschnittstemperatur wird um weitere 2 bis 5 Grad Celsius ansteigen. (IPPC, Intergovernmental Panel on Climate Change). As Folge davon wird das Wetter chaotischer werden, und Verwüstungen durch Stürme werden zunehmen. Die Zahl der Menschen, die von wetterbedingten Katastrophen betroffen waren, stieg von 100 Millionen im Zeitraum von 1981 bis 1985 auf 250 Millionen im Zeitraum von 2001 bis 2005 (Worldwatch 2007).
Die Probleme der Tragfähigkeit stellen eine besondere Herausforderung aufgrund ihrer langfristig andauernden Auswirkungen dar. Selbst wenn wir die Produktion giftiger Chemikalien morgen einstellen würden, selbst wenn wir alle Atomanlagen sofort abschalten würden, selbst wenn wir aufhören würden, Treibhausgase wie Methan und CO2 zu emittieren, blieben die schädlichen Folgen Jahrhunderte und Jahrtausende lang bestehen, im Fall des Atommülls sogar hunderte Millionen Jahre lang. Doch die Produktion vieler dieser Substanzen wächst weiterhin, in manchen Fällen sogar beschleunigt. James Lovelock (2008) bemerkt sogar, dass einige der Veränderungen, die wir verursacht haben, irreversibel zu werden drohen. Wenn wir zum Beispiel die Treibhausgase nicht bald reduzieren, könnten wir einen Umschlagpunkt erreichen, vom dem ab sich das Klima für unseren Planeten dauerhaft erwärmen könnte.
Manchmal mögen wir die Zusammenhänge zwischen den Problemen der Tragfähigkeit, der Erschöpfung von Ressourcen, der Armut und Ungleichheit nicht unmittelbar sehen. Insbesondere kann es schwierig sein, die Zusammengehörigkeit von ökologischen und sozialen Dimensionen der Krise zu erfassen. Teilweise ist dies darauf zurückzuführen, dass die Massenmedien die Themen oftmals so darstellen, als ob eine Art Konkurrenz zwischen menschlichen Bedürfnissen und dem Schutz der Ökologie bestünde. Sollen wir zum Beispiel einen alten Wald erhalten oder ihn abholzen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen? Sollen wir einen Fluss, in dessen natürlichen Verlauf bislang nicht eingegriffen wurde, schützen, oder ein Bergwerk bauen, um eine schlechte Wirtschaftslage zu verbessern? Sollen wir Chemikalien und Gentechnik einsetzen, um die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen? Sollen wir einen neuen Staudamm bauen, um Energie für die industrielle Entwicklung bereitzustellen?
Fast immer jedoch, wenn wir einen Schritt zurücktreten und einen weiteren Blickwinkel zulassen, stellt sich diese Vorstellung, dass wir entweder die Armut bekämpfen oder die Ökosysteme schützen können, keineswegs aber beides zugleich, als eine Lüge heraus, die gebetsmühlenartig von jenen wiederholt wird, die die Erde und den ärmsten, verwundbarsten Teil der Menschheit zugleich ausbeuten. Um dies deutlicher zu sehen, wollen wir die sechs wesentlichen Charakteristika unserer derzeitigen Welt(un-)ordnung, wie sie vom Kapitalismus des industriellen Wachstums geschaffen wird, näher untersuchen:
– Die Verschreibung an ein grenzenloses Wachstum
– Ein verzerrtes Verständnis von Entwicklung
– Wachsende Unterwerfung unter die Herrschaft der Konzerne
– Verschuldung und Spekulation als die Hauptquellen des Profits
– Die Tendenz, Wissen zu monopolisieren und eine weltweite Einheitskultur durchzusetzen
– Der Rückgriff auf Macht im Sinne von Beherrschung, wozu militärische Macht und Gewalt gehören.
Krebsartiges Wachstum
„In gewissem Sinne ist der gemeinsame Glaube ans Wachstum gerechtfertigt, weil Wachstum ein wesentliches Charakteristikum des Lebens ist […]. Was an den heutigen Anschauungen über wirtschaftliches und technologisches Wachstum jedoch falsch ist, das ist das Fehlen jeglicher Qualifizierung. Allgemein wird angenommen, alles Wachstum sei gut, ohne zu erkennen, dass es in einer endlichen Umwelt ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Wachstum und Niedergang geben muss. Während einige Dinge wachsen, müssen andere abnehmen, damit ihre Bestandteile wieder freigesetzt und neu verwendet werden können. Der größte Teil des wirtschaftlichen Denkens unserer Zeit beruht auf der Idee des undifferenzierten Wachstums. Auf den Gedanken, dass Wachstum hinderlich, ungesund oder krankhaft sein kann, kommt man gar nicht. Wir brauchen daher dringend eine Differenzierung und Qualifizierung des Wachstumsbegriffs.“ (Capra 2004, 233–234)
Heute ist Wachstum gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Gesundheit geworden. Wenn das Wachstum stagniert oder, schlimmer noch, wenn die Wirtschaft „schrumpft“, dann befinden wir uns in der Rezession, und darauf folgen mit Sicherheit Arbeitslosigkeit und andere soziale Missstände. Nur wenige von uns stellen die alte Weisheit infrage, die die Notwendigkeit einer sich immer weiter ausdehnenden Ökonomie behauptet.
Doch wirtschaftliches Wachstum im herkömmlichen Sinn bedeutet den Verbrauch von mehr natürlichen Ressourcen und die Produktion von mehr gefährlichen Nebenprodukten wie chemische und nukleare Abfälle. Dabei unterliegen, wie wir bereits gesehen haben, viele wesentliche Rohstoffe für eine wachsende Wirtschaft einem rasch fortschreitenden Prozess der Erschöpfung. Obwohl einige „Optimisten“ davon ausgehen, dass man hierfür synthetische Ersatzstoffe finden wird, gibt es wenige oder kaum Anzeichen dafür, dass diese Hoffnung begründet wäre.
Die Crux dieser Angelegenheit besteht darin, dass der Planet, auf dem wir leben, endlich ist. Es gibt nur eine bestimmte Menge an sauberer Luft, trinkbarem Wasser und fruchtbarem Boden. Auch die Menge an verfügbarer Energie ist begrenzt (sie wird durch die Sonne erneuert, aber in einem festgelegten Maß). Da alle Ökonomien und alle Menschen Anspruch auf diese begrenzten wesentlichen Voraussetzungen erheben, liegt es klar zutage, dass es Grenzen des Wachstums gibt.
Warum aber beharren die meisten Wirtschaftswissenschaftler weiterhin darauf, dass ein grenzenloses, undifferenziertes Wachstum der Wirtschaft sowohl nötig als auch gut sei? Teilweise ist dieser Glaube auf eine Verwechslung von Wachstum und Entwicklung zurückzuführen. Herman Daly stellt klar: „Wachsen heißt an Größe zunehmen durch Einverleibung oder Hinzufügung von Material, während entwickeln meint, die Möglichkeiten zu erweitern oder zu verwirklichen, in einen reichhaltigeren, großartigeren, besseren Zustand zu bringen.“ (1996, 2) Unsere Wirtschaft muss in diesem qualitativen Sinne, aber nicht unbedingt quantitativ wachsen. Tatsächlich „entwickelt sich unser Planet im Lauf der Zeit, ohne zu wachsen. Unsere Wirtschaft, ein Subsystem dieser endlichen, nicht-wachsenden Erde, muss ein ähnliches Entwicklungsmuster übernehmen“ (1996, 2).
In früherer Zeit, als die Menschen eine relativ kleine Population auf der Erde darstellten und unsere Techniken relativ einfach waren, waren wir oftmals in der Lage, so zu handeln, als sei die Erde ein grenzenloses Rohmateriallager. Es ist wahr: Das Römische Reich, die Bewohner der Osterinsel, die Zivilisation der Maya im Tieflanddschungel und andere Kulturen richteten für die lokalen Ökosysteme schwere Schäden an und verursachten damit oftmals den Zusammenbruch ihrer eigenen Gesellschaften. Doch die Gesundheit des umfassenden globalen Ökosystems war niemals ernsthaft bedroht, und die lokalen Ökosysteme waren in der Lage, im Lauf der Zeit zu gesunden.
Heute hat die menschliche Population rasch zugenommen, und der Konsum der Menschen ist sogar noch weitaus schneller gewachsen. Von dem, was Daly eine Ökonomie der „leeren Welt“ nannte, sind wir zu dem übergegangen, was er als Ökonomie der „vollen Welt“ bezeichnet.
„Das wirtschaftliche Wachstum hat die Welt mit uns und unseren Dingen angefüllt, aber sie hat sie im Vergleich dazu der Dinge entleert, die vor uns da gewesen sind – was nun uns und unseren Dingen einverleibt ist, nämlich das natürliche System, welches das Leben erhält und das wir seit Kurzem in später Anerkennung seiner Nützlichkeit und Knappheit ‚natürliches Kapital‘ nennen. Eine weitere Expansion der ökologischen Nische des Menschen steigert nun oftmals die Kosten für die Umwelt schneller, als sie die Vorteile der Produktion vermehrt, und leitet damit eine neue Ära des antiökonomischen Wachstums ein […] eines Wachstums, das eher zur Verarmung als zur Bereicherung führt, da es unter dem Strich mehr kostet, als es wert ist. Dieses antiökonomische Wachstum macht es schwerer und nicht etwa leichter, die Armut zu besiegen und die Biosphäre zu schützen.“ (Daly 1996, 218)
Ein nicht nachhaltiger Pfad
Wir haben bereits eine Weise erwähnt, wie man die Wirtschaft der „vollen Welt“ verstehen kann: das Nettoprimärprodukt (NPP). Die Menschen verbrauchen nun über 40 % der Energie, die mittels Fotosynthese an Land erzeugt wird; 3 % werden direkt verbraucht, während der Rest schlicht verschwendet oder zerstört wird (durch Verstädterung, Entwaldung, Verschwendung von Feldfrüchten etc.) Der Anteil des verbrauchten NPP steigt noch weiter an, wenn wir die zerstörerischen Auswirkungen von Verschmutzung, globaler Erwärmung und Ausdünnung der Ozonschicht mit einbeziehen. (Meadwos et. al. 1992) Bei den derzeitigen Wachstumsraten werden wir um das Jahr 2030 80 % des NPP zu Lande für uns beanspruchen. (Korten 1995)
Ein anderer Zugang, um die Grenzen des Wachstums zu begreifen, ist die Vorstellung vom „ökologischen Fußabdruck“, wie sie William Rees und Mathias Wackernagel aus Britisch Kolumbien entwickelt haben. Ein ökologischer Fußabdruck basiert auf der Berechnung der Landfläche, die nötig ist, um die Lebensmittel, das Holz, das Papier und die Energie für einen Durchschnittsbewohner einer bestimmten Region oder eines Landes zu produzieren.
Während wir einen sehr kleinen Teil von 12 % der Landfläche der Erde nichtmenschlichen Arten überlassen (diese Größenordnung scheint schon fast auf skandalöse Weise gering zu sein), stehen jedem Menschen für seinen Unterhalt zurzeit 1,7 Hektar (bzw. 1,8 Hektar, wenn man auch die Meeresressourcen mit einbezieht) zur Verfügung. Doch der durchschnittliche Fußabdruck pro Person beträgt bereits 2,3 Hektar.12 Mit anderen Worten: Wir verbrauchen bereits 30 % mehr als das, was langfristig aufrechterhalten werden kann, und zwar vor allem aufgrund unseres Verbrauchs nichterneuerbarer Ressourcen. Wenn wir einen Anteil von 33 % des Landes anderen Lebewesen überließen – was eher der Vernunft entspräche ‒, dann hätte jede Person weniger als 1,3 Hektar zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir in diesem Fall 75 % mehr konsumieren als das, was dem Kriterium der Nachhaltigkeit entspräche.
Oberflächlich betrachtet, könnte man daraus den Schluss ziehen, dass die Weltbevölkerung um mindestens ein Drittel reduziert werden müsste. Natürlich spielen die bloßen Zahlen eine Rolle, aber sie enthalten nicht die ganze Geschichte. Der Durchschnittsbewohner von Bangla Desh zum Beispiel hat einen ökologischen Fußabdruck von 0,6 Hektar, ein Peruaner braucht 1,3 Hektar. Die reichsten Nationen der Erde andererseits brauchen irgendetwas zwischen 5,4 Hektar (Österreich) und 12,2 Hektar (USA). Wenn jeder Erdenbewohner so viel bräuchte wie ein Bewohner des Nordens im Durchschnitt, dann würden wir mit etwa 7 Hektar pro Person ungefähr drei bis vier weitere mit der Erde vergleichbare Planeten benötigen, um unser Dasein zu erhalten. Es ist also klar, dass der übermäßige Konsum im Norden eine der Hauptursachen der ökologischen Bedrohung ist.
Ein weiterer Beleg für die Unmöglichkeit eines stetigen uneingeschränkten Wirtschafswachstums wird von einer ausgefeilten Computersimulation geliefert, wie sie die Autoren des Buches „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows et. al. 2006) benutzt haben. Wenn wir den derzeitigen Wachstumspfad in herkömmlicher Weise fortsetzen, ohne dabei größere politische Veränderungen vorzunehmen, werden unser materieller Lebensstandard und der menschliche Wohlstand kurz nach der ersten Dekade unseres Jahrhunderts dramatisch abnehmen – spätestens um 2025.
Je nach den unterschiedlichen Strategien und Szenarien, deren man sich bedient, kann der schnelle Niedergang des menschlichen Wohlstands hinausgezögert werden. Doch es ist verblüffend, dass selbst eine Verdoppelung der verfügbaren nichterneuerbaren Ressourcen einen relativ geringen Effekt hat. Nimmt man verbesserte Technologien in Verbindung mit einer größeren Verfügbarkeit von Ressourcen hinzu, dann verspricht dieses Szenario mehr Aussichten, den Kollaps zu vermeiden, obwohl sogar in diesem Fall die Lebenserwartung um die Mitte des Jahrhunderts zurückgeht. Doch dieses Szenario geht von den allerkühnsten optimistischen Annahmen aus: eine Verdoppelung der bekannten Ressourcen, eine effektive Kontrolle der Verschmutzung, deutlich höhere Ernteerträge, Schutz vor Bodenerosion und eine deutlich verbesserte Ressourcenproduktivität. Längerfristig (nach 2100) jedoch wird der Lebensstandard letztlich nicht mehr nachhaltig sein, da die Kosten steigen.
Man sollte auch anmerken, dass die Abänderung auch nur einer dieser optimistischen Annahmen ausreichen würde, um einen dramatischen Niedergang des menschlichen Wohlstands zu bewirken. (So zum Beispiel wenn man die Annahme revidiert, dass eine deutlich höhere Ressourceneffizienz durch eine verbesserte Technik erreicht werden kann: In diesem Fall würde die Projektion im Ergebnis einen Kollaps rund um das Jahr 2075 zeigen). Es kann auch sehr wohl der Fall sein, dass dieses Modell die Auswirkungen des Klimawandels unterschätzt, den wir bereits in Gang gesetzt haben. Schließlich bemerkt Meadows:
„Solange es exponentielles Wachstum der Bevölkerung und Industrie gibt, solange diese beiden verankerten Wachstumsprozesse durchstarten und immer mehr Bedürfnisse erzeugen, macht es nicht viel Unterschied, von welchen Annahmen man im Hinblick auf die Technologie, auf die Ressourcen und auf die Produktivität ausgeht. Irgendwann ist die Grenze erreicht, man schießt über das Ziel hinaus und kollabiert […] Selbst wenn man von kühnen Annahmen in Bezug auf die Technologie oder die Ressourcen ausgeht, dann verzögert das den Zusammenbruch vielleicht um ein Jahrzehnt. Es wird immer schwerer, sich eine Reihe solcher Annahmen vorzustellen, die in diesem Modell zu nachhaltigen Ergebnissen führen.“ (zitiert bei Gardner 2006, 38)
Wenn andererseits das Bevölkerungswachstum stabilisiert und der Pro-Kopf-Verbrauch deutlich gesenkt werden kann (während man gleichzeitig die Verschmutzung effektiver kontrolliert und den Boden schützt), kann der wirtschaftliche und ökologische Zusammenbruch immer noch vermieden werden. Im Gegensatz zum vorhergehenden Szenario kommt dies ohne die – wahrscheinlich unrealistische – Annahme einer Verdoppelung der verfügbaren nichterneuerbaren Ressourcen aus.
Doch die Zeit ist ein kritischer Faktor. Die Projektionen, die Meadows und andere durchgeführt haben, zeigen, dass das Ergebnis weniger Verschmutzung, mehr nichterneuerbare Ressourcen für alle und ein leicht höherer allgemeiner Wohlstandsindex gewesen wäre, wenn die wesentlichen Veränderungen, die in diesem Szenario vorausgesetzt werden, vor zwanzig Jahren tatsächlich stattgefunden hätten. Umgekehrt: Je länger wir damit warten, das Wachstum zu stoppen, umso katastrophaler werden die Folgen sein und umso schwieriger der Übergang zur Nachhaltigkeit. Die Autoren bemerken:
„Wachstumsvorgänge, besonders exponentielles Wachstum, sind deshalb so tückisch, weil sie die für wirksame Aktionen verfügbare Zeit immer mehr verkürzen. Die Belastung eines Systems wächst immer rascher an, bis schließlich die Fähigkeit zum Handeln nicht mehr ausreicht. Bei einer langsameren Entwicklung wäre sie aber mit dem jeweiligen Problem noch fertig geworden […] Wenn die Bevölkerung und die Wirtschaft die materiellen Grenzen der Umwelt überzogen haben, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: entweder der Zusammenbruch infolge nicht mehr beherrschbarer Mangellagen und Krisen oder bewusste, freiwillige Reduzierung der Durchsatzmengen als soziale Gemeinschaftsaufgabe.“ (Meadows et.al. 1992, 218; 228–229)
Und in jüngerer Zeit:
„Wenn wir die Verringerung der Durchsatzmengen und den Übergang zur Nachhaltigkeit aufschieben, bedeutet dies bestenfalls, dass wir die Optionen zukünftiger Generationen einschränken – und schlimmstenfalls, dass wir den Zusammenbruch beschleunigen.“ (Meadows et.al. 2006, 263)
Die Attraktivität des Wachstums
Obwohl wir bereits jede vernünftige Grenze einer nachhaltigen Wirtschaft überschritten haben, scheinen wir immer noch weit davon entfernt zu sein, uns freiwillig zu einer Reduktion des Konsums oder des „ökonomischen Durchsatzes“ zu entschließen. Tatsächlich bestehen die meisten Wirtschaftswissenschaftler und Politiker nach wie vor darauf, dass Wachstum ein wesentliches Merkmal einer gesunden Wirtschaft sei. Warum ist Wachstum nach wie vor so attraktiv?
Die Befürworter führen ins Feld, dass weiteres Wachstum zur Bekämpfung der Armut nötig sei. Es ist ganz offensichtlich, dass viele Menschen – wahrscheinlich der größere Teil der Menschheit – nicht über genügend Ressourcen verfügen, um ein Leben in Würde zu führen. Wachstum wird als ein „leicht gangbarer“ Weg betrachtet, diesem Problem zu begegnen. Wir müssen auf diese Weise den Kuchen nicht anders verteilen, sondern ihn bloß größer machen.
Doch die Tatsache, dass es sehr konkrete Grenzen des Wachstums gibt, bedeutet, dass dieser Weg schlicht nicht möglich ist. Geht man davon aus, dass die Weltbevölkerung im Lauf dieses Jahrhunderts auf neun Milliarden Menschen ansteigen wird, dann müsste die Wirtschaft mindestens um das Zwanzigfache wachsen, um für alle Menschen jenes Konsumniveau zu gewährleisten, das derzeit die reichsten 20 % genießen. Die UN haben die Schätzung vorgelegt, dass die Wirtschaft, wenn wir uns bei der Armutsbekämpfung allein auf das Wirtschaftswachstum verlassen, um das Fünf- bis Zehnfache wachsen müsste, nur um für die heute Armen einen vernünftigen Lebensstandard zu gewährleisten. (McKibben 1998, 72) Da die Wirtschaft bereits heute jedes nachhaltige Niveau überschritten hat, würde der ökologische und ökonomische Zusammenbruch lange vor Erreichen dieser Ziele eintreten. Warum also reden Politiker und Wirtschaftsfachleute dem Wachstum als Mittel zur Armutsbekämpfung immer noch beharrlich das Wort? Das Worldwatch Institute hat dazu folgende Beobachtung gemacht:
„Die Sichtweise, dass das Wachstum einen immer größer werdenden Kuchen an Reichtümern herbeizaubert, ist ein einflussreiches und geeignetes politisches Instrument, denn sie macht es möglich, die unbequemen Themen der Ungleichheit der Einkommen und einer Schräglage in der Verteilung des Wohlstandes zu vermeiden. Die Menschen gehen davon aus: Solange es Wachstum gibt, kann sich das Leben der Armen verbessern, ohne dass die Reichen Einbußen an ihrem Lebensstil hinnehmen müssen. Die Wahrheit jedoch sieht anders aus: Eine ökologisch nachhaltige Weltwirtschaft zu erreichen ist nicht möglich, ohne dass diejenigen, die Glück (sic!) hatten, ihren Konsum begrenzen, um den Armen die Möglichkeit einzuräumen, den Ihrigen zu steigern.“ (Brown et. al. 1991, 119–120)
Jedenfalls hat ein Jahrhundert eines unvorhergesehenen „Wachstums“ zu keiner wirklichen Abnahme der Armut geführt, und es sieh auch nicht so aus, als könnte dies in Zukunft der Fall sein. Selbst wenn sich die wirtschaftlichen Wachstumsraten der armen Länder verdoppeln würden, würden nur sieben von ihnen im nächsten Jahrhundert zu den reichen Ländern aufschließen, und nur neun weitere im nächsten Jahrtausend. (Hawken 1993)
Der Entwicklungsexperte David Korten betont sogar, dass gerade eine Politik der Wachstumsförderung die Armut verschlimmern kann, da sie „Einkommen und Vermögen an diejenigen, die Eigentum besitzen, zulasten derjenigen, die ihr Leben durch ihrer Hände Arbeit fristen, umverteilt“ (1995, 42). Ein Umstieg auf landwirtschaftliche Exportprodukte zum Beispiel mag das Wachstum steigern, doch er fördert auch das große Agrobusiness zulasten der Kleinbauern, die Lebensmittel erzeugen. Mehr Abholzung steigert das Wirtschafswachstum, doch es führt auch zur Vernichtung traditioneller Lebensweisen, deren Grundlage die Ressourcen des Waldes sind, und gleichzeitig bewirkt es auch eine zunehmende Bodenerosion und verminderten Regen.
Vieles, was als Wachstum zählt, ist einfach ein Wechsel von einer nicht-monetären zu einer monetären Wirtschaft. Häufig wird das dadurch erreicht, dass man die Armen ihrer traditionellen wirtschaftlichen Grundlage beraubt und sie dazu zwingt, innerhalb einer monetären Wirtschaft zu abhängigen Arbeitern zu werden. Korten zieht daraus den Schluss:
„Das fortgesetzte Streben nach Wirtschaftswachstum als dem Organisationsprinzip der Politik beschleunigt den Zusammenbruch der Regenerationsfähigkeiten der Ökosysteme und des sozialen Netzes, das menschliche Gemeinschaft erhält. Gleichzeitig intensiviert es den Wettlauf zwischen Arm und Reich um Ressourcen – ein Wettlauf, den die Armen zwangsläufig immer verlieren.“ (1995, 11)
Der einzige Weg, den Problemen von Armut und Ungleichheit wirksam zu begegnen, ist es deshalb, dass diejenigen, die das Meiste haben, ihren Konsum drastisch reduzieren, damit die begrenzten Reichtümer der Welt gerechter unter allen verteilt werden. Natürlich mag einiges dieser Reduktion durch eine effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen erreicht werden, etwa durch den Umstieg auf nachhaltige Energieformen oder die Umschichtung von Ressourcen aus den Militärausgaben. Doch eine gleichzeitige Reduktion des Konsums insgesamt und eine Zunahme der Ressourcen für die Armen erfordern immer noch eine Änderung des Lebensstils der Reichen (und mächtigsten) 20 % der Menschheit.
Die Herausforderung, den Konsum im Norden zu reduzieren und Wohlstand an den Süden umzuverteilen, mag auf den ersten Blick überwältigend erscheinen, doch dies käme letztlich allen zugute. Einige Vorteile daraus wären ökologischer Natur. Das Worldwatch Institute hebt hervor, dass die sich weitende Kluft zwischen Reich und Arm ein wesentlicher Faktor ökologischer Zerstörung ist. Einerseits richten diejenigen, die auf der Einkommensskala ganz oben sind, aufgrund ihres hohen Konsumniveaus und der Erzeugung riesiger Mengen von Abfall und Verschmutzung den größten ökologischen Schaden an. Andererseits tragen auch diejenigen, die in extremer Armut leben, zur Schädigung der Ökosysteme bei, während sie immer weiter an den Rand gedrängt werden. Aufgrund dieser Situation können sie gezwungen sein, mageres Land zu überweiden, Wälder zu schädigen, weil sie Brennholz brauchen, und Feldfrüchte an Abhängen anzupflanzen, die anfällig für Bodenerosion sind. Im Gegensatz dazu beeinträchtigt der Teil der Menschheit mit einem bescheidenen, aber ausreichenden Auskommen tendenziell die umfassendere planetarische Gemeinschaft am wenigsten. Ein größeres Maß an Gleichheit würde also viele der Schäden beseitigen, die aus den Extremen von Wohlstand und Armut resultieren. (Brown et. al. 1994)
Darüber hinaus würde eine Neuverteilung des Wohlstands der Welt Milliarden Menschen aus der Verzweiflung und dem Elend bedrückender Armut befreien, es ihnen ermöglichen, ihr menschliches Potenzial stärker zu entfalten, und auf sinnvolle Weise zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen. Die Vorteile einer solchen Umverteilung für den Norden sind nicht so unmittelbar erkennbar, doch man kann sicher die Meinung vertreten, dass eine Abkehr von der Konsumkultur der überentwickelten Welt letztlich zu einer Erneuerung des Gemeinschaftslebens verhelfen würde, da die Leute von einem von Stress und Konkurrenz geprägten Lebensstil befreit würden. Eine bessere Verteilung von Einkommen und Wohlstand könnte eine bessere Gesundheit aller bewirken. So schreibt Korten:
„Sauberes Wasser und geeignete Sanitäranlagen sind vielleicht die wichtigsten Faktoren für Gesundheit und langes Leben. Die Erfahrung an Orten wie zum Beispiel dem indischen Bundesstaat Kerala zeigt, dass diese notwendigen Dinge bereits ab einem ganz bescheidenen Einkommensniveau erreichbar sind. Im Gegensatz dazu ist in Ländern mit einem hohen Einkommensniveau eine Zunahme von Krebserkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, Stress und Herz- und Gefäßerkrankungen, von Schädigungen der Leibesfrucht und eine Abnahme der Spermienzahl zu verzeichnen. Es gibt eine zunehmende Fülle von Belegen dafür, dass all diese Phänomene Nebenprodukte des Wirtschaftswachstums sind und auf die Verschmutzung der Luft und des Wassers, chemische Zusätze und Pestizidrückstände in der Nahrung, hohe Lärmpegel und einer zunehmenden Beeinträchtigung durch elektromagnetische Strahlung zurückgehen. (1995, 40–41)
Schließlich ist es ein Vorteil größerer Gleichheit, dass diese sehr wahrscheinlich der Schlüssel für eine Eindämmung der Überbevölkerung sein könnte. Gewöhnlich begann das Bevölkerungswachstum erst dann zurückzugehen, wenn die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigt waren und die Leute sich sicher genug fühlten, um weniger Kinder zu haben (diese stellen eine Grundform der Altersvorsorge dar). Es ist bemerkenswert, dass in den Siebzigerjahren, als die Einkommen im Süden stiegen, die Bevölkerungswachstumsraten deutlich zurückgingen. Mit dem Beginn der Verschuldungskrise und der Durchsetzung einer harten Austeritätspolitik in den Achtzigerjahren sanken die Einkommen drastisch, und gleichzeitig stiegen die Raten des Bevölkerungswachstums an. Erst in den Neunzigerjahren sanken diese wieder, doch selbst zu dieser Zeit konnte etwa ein Drittel der Reduktion auf die Aids-Pandemie zurückgeführt werden.
Zusammen mit der Einkommenssicherheit ist die Stärkung der Frauen ein Schlüssel für die Stabilisierung der Bevölkerungszahl. Das beinhaltet auch ihre Fähigkeit, über die Größe der Familie selbst zu entscheiden. Eine solche Stärkung der Frauen ist aber sicher in einer Gesellschaft einfacher, die eine weniger hohe Arbeitslosenrate und weniger soziale Gewalt aufweist. Doch auch diese Bedingungen sind normalerweise nur dort gegeben, wo ein Mindestmaß an gerechterer Einkommensverteilung und ein Rückgang der Armut erreicht wurden. Das heißt, letztlich ist eine größere Einkommenssicherheit der wesentliche Faktor dafür, dass die Kurve des Bevölkerungswachstums schnell nach unten geht.
Ein fehlerhafter Indikator, eine falsche Perspektive
Eine unserer Hauptschwierigkeiten mit der Wachstumswirtschaft ist die Art und Weise, wie Wachstum gemessen wird. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die hauptsächliche Messgröße von Wirtschaftswachstum, ist ein ernstlich fehlerbehafteter Indikator.13 Das BIP ist im Grunde die Summe der produzierten Güter und Dienstleistungen, wozu alle wirtschaftlichen Aktivitäten zählen, bei denen Geld im Spiel ist. Das heißt also: Die Kosten für die teure Beseitigung von Verschmutzung, die Produktion einer Atombombe oder die Arbeitskosten für die Abholzung von altem Waldbestand werden ins BIP mit eingerechnet und gelten als wirtschaftlicher Vorteil. Andere wirtschaftliche Aktivitäten, bei denen kein Geld fließt, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Subsistenzbetriebe (Nahrungsmittelproduktion für die eigene Familie oder Gemeinde), freiwilliger Arbeitseinsatz oder Kindererziehung werden absurderweise überhaupt nicht berücksichtigt. Einen Kilometer mit dem Auto zurückzulegen trägt viel mehr zum BIP bei als dieselbe Strecke zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, obwohl die letztgenannten Möglichkeiten keine ökologischen Kosten verursachen.
Grundsätzlich bewertet das BIP viele Leben zerstörende Aktivitäten positiv, während es viele Leben fördernde nicht darstellt. Während man die Kapitalabschreibung für Gebäude, Fabriken und Maschinen berechnet, gibt es keine ähnlichen Kalkulationen für die Entwertung des „natürlichen Kapitals“: der Abnahme der Tragfähigkeit der Erde. Oftmals wird Wohlstand künstlich dadurch „produziert“, dass man die Kosten der Zerstörung des wahren Wohlstands der Erde, Wälder, Wasser, Luft oder Böden, verschleiert. So erzeugt zum Beispiel die Abholzung von Regenwald Wachstum, doch niemand berechnet die Kosten der Wohlstandseinbußen für die Lebewesen, Luft, Boden und Wasser, die allesamt vorher von diesem Ökosystem aufrechterhalten wurden. Korten geht sogar so weit zu behaupten, das BIP sei nicht viel mehr als die Berechnung des „Ausmaßes, in welchem wir Ressourcen in Abfall verwandelt haben“ (1995, 38).
Im Film Who’s Counting liefert die feministische Wirtschaftswissenschaftlerin Marilyn Waring ein interessantes Beispiel für die Art von verzerrtem Bild, welches das BIP liefert. Sie macht deutlich, dass die Wirtschaftsaktivität infolge der von Exxon Valdez verursachten Ölkatastrophe an der Küste von Alaska diese Fahrt zu der am meisten wachstumsstimulierenden aller Zeiten gemacht habe. Das BIP rechnete die Kosten für die Reinigungsarbeiten, die Auszahlungen von Versicherungen und sogar die Zuwendungen an „grüne“ Organisationen als Wachstum. Dieser Haben-Spalte stand jedoch keine Soll-Spalte gegenüber. Die Kosten für tote Vögel, Fische und Meeressäugetiere sowie die Zerstörung von herrlicher Schönheit zählten einfach nicht.
Sowohl aus ethischer wie auch aus praktischer Sicht ist das BIP als Maßstab für wirtschaftlichen Fortschritt sehr fragwürdig. Die Art von nicht qualifiziertem wirtschaftlichem Wachstum, welches das BIP berechnet, ist nicht unbedingt gut und kann oftmals schädlich sein. Herman Daly drückt es so aus: „Es ist ein grundlegender Fehler, die Erde zu behandeln, als ob sie zum Ausverkauf stünde.“ (zitiert bei Al Gore 1992, 191)
Doch genau das tun wir, wenn wir das wahre Kapital des Planeten, nämliche seine Fähigkeit, leben zu beherbergen, zerstören, um künstliches, abstraktes und totes Kapital in Form von Geld (etwas, das tatsächlich keinen Wert in sich hat) anzuhäufen. Wir verschulden uns tatsächlich am Wohlstand allen Lebens in Zukunft, um einen kurzfristigen Gewinn für eine Minderheit der Menschheit zu erzielen. Dies stellt eine sehr gefährliche Art der Finanzierung über Schulden dar.
Viele plädieren nun für die Ersetzung des BIP durch einen „echten Fortschrittsindikator“ (Genuine Progresse Indicator, GPI) als Alternative. Der GPI unterscheidet zwischen Leben fördernden und Leben zerstörenden Aktivitäten. Die ersteren werden als produktiv, die letzteren als Kosten bewertet. Dies ermöglicht eine genauere Bestimmung von echtem wirtschaftlichem Fortschritt ‒ einem Fortschritt, dessen Grundlage eine qualitative Entwicklung und nicht so sehr quantitatives Wachstum ist. Die Anwendung dieses Indikators macht deutlich, dass der GPI in den USA während der fünfundzwanzig Jahre vor 1992 tatsächlich gesunken ist, obwohl das BIP gewachsen ist (Nozick 1992). Spätere Daten scheinen zu bestätigen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Der GPI liegt im Jahr 2002 immer noch geringfügig unter dem Niveau von 1976.
Wenn wir über die traditionelle, am BIP gemessene Wachstumswirtschaft hinausgelangen wollen, dann müssen wir einen qualitativen Zugang wählen. Die herkömmlichen Vorstellungen von Profit, Effizienz und Produktivität müssen infrage gestellt und neu definiert werden. Brauchen wir Wachstum? Gewiss. Wir brauchen ein Wachstum an Kenntnissen und Weisheit, ein Wachstum am Zugang zu einer Grundversorgung für alle, ein Wachstum an menschlicher Würde. Wir müssen auch das Schöne fördern, die Vielfalt des Lebens erhalten und die Gesundheit der Ökosysteme kräftigen. Doch wir brauchen kein Wachstum an überflüssigem Konsum. Wir brauchen noch weniger ein krebsartiges Wachstum, das Leben zerstört, nur um totes Kapital für einen kleinen Teil der Menschheit anzuhäufen.
Verzerrte Entwicklung
Als die Anthropologin Helena Norberg-Hodge im Jahr 1975 zum ersten Mal in die Ladakh-Region Kaschmirs in Indien kam, fand sie dort ein Volk vor, das bis dahin völlig isoliert von der Weltwirtschaft gelebt hatte. Dennoch erfreuten sich die Bewohner von Ladakh einer hohen Lebensqualität. Die lokalen Ökosysteme waren im Kern gesund, Verschmutzung war praktisch unbekannt. Es stimmt zwar, dass man an einige Ressourcen schwer herankam, doch die meisten Menschen arbeiteten nur vier Monate im Jahr hart, sodass viel Zeit für die Familie, für Freunde und für kreative Tätigkeiten blieb. So brachten die Bewohner von Ladakh eine beeindruckende Vielfalt an Kunst hervor. Die Leute lebten in geräumigen, der Gegend angepassten Häusern. Fast alle Güter des Grundbedarfs wie Kleidung, Häuser und Nahrung wurden produziert und verteilt, ohne dass man dafür Geld benutzte. Als Norberg-Hodge einen Einheimischen fragte, wo denn die Armen lebten, machte der Angesprochene zunächst einen verwirrten Eindruck, um dann zu antworten: „Wir haben hier überhaupt keine armen Leute.“ (1999, 196)
Im Lauf der Jahre jedoch begann sich die lokale Wirtschaft zu „entwickeln“. Die ersten Touristen kamen in die Gegend und brachten Erzeugnisse und Erfindungen der Weltwirtschaft mit. Bald merkten die Leute, dass sie Geld brauchten, um sich Luxusgüter kaufen zu können. Nach und nach orientierten sich die Leute an der Geldwirtschaft. Als man Feldfrüchte für den Verkauf einführte, wurde die Wirtschaft vom Erdöl abhängig, da ein modernes Transportwesen für die Verschiffung der Ware erforderlich war. Auch der Zustand der lokalen Ökosysteme verschlechterte sich mit der Verbreitung des Chemieeinsatzes in der Landwirtschaft. Als sich die lokale Wirtschaft auflöste, erodierte auch die Kultur der Ladakh-Region, und die Menschen verloren das Gespür für ihre Identität.
Wenn wir diese Geschichte hören, dann ist unsere erste Reaktion darauf vielleicht ein nostalgischer Blick zurück auf eine einfache Zeit und Kultur. Die meisten von uns mögen das, was den Bewohnern von Ladakh widerfahren ist, als traurig, aber in gewisser Weise unvermeidlich betrachten. Andere mögen sich fragen, ob es nicht eine andere Möglichkeit der Öffnung auf die Welt hin gegeben hätte, einen Weg, der nicht zwangsläufig zum Niedergang der lokalen Kultur und Ökosysteme geführt hätte.
Jedenfalls scheint die Frage angebracht zu sein, ob der Wachstumsprozess, wie ihn die Bewohner von Ladakh erlebt hatten, einen „Fortschritt“ oder eine Entwicklung darstellte. Wie wir weiter oben bereits gesehen haben, sollte Entwicklung qualitative Verbesserungen des Lebens der Menschen beinhalten. Wogen die „Wohltaten“ der Weltwirtschaft (Fernsehen, Zugang derer, die es sich leisten können, zu bestimmten Konsumgütern, ein modernes Transportwesen) die Kosten in Gestalt von Armut, ökologischer Zerstörung und kulturellem Verfall auf? Das ist unwahrscheinlich. Jedenfalls scheint es eine grobe Verzeichnung der Tatsachen zu sein, einen solchen Prozess als „Entwicklung“ zu bezeichnen. Und doch war der Großteil der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg in ein groß angelegtes „Entwicklungs“-Unternehmen involviert, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Prozess aufweist, den die Bewohner von Ladakh durchgemacht haben.
Es ist nicht zu leugnen, dass es in den letzten sechzig Jahren echten Fortschritt in der Eindämmung von Krankheiten, der Erhöhung der Lebenserwartung und einem verbesserten Zugang zu Bildung gegeben hat. Doch es ist verstörend, dass selbst diese Errungenschaften nun, da sich die Armut in vielen Ländern Afrikas, aber auch Asiens und Lateinamerikas, verschärft, wieder gefährdet sind. Selbst einige der „Wunder“-Ökonomien Asiens, die Lieblingskinder der Entwicklungsideologen, haben aufgrund der Finanzkrisen nach und nach Rückschläge erlitten.
Die Entwicklung der Armut
Tatsächlich ist dieser Prozess der Entwicklung oftmals ein Beispiel der „Fehlentwicklung“, beruhend auf den Grundannahmen der Wachstumsökonomie, die wir bereits beschrieben haben. Dies gilt insbesondere für Mammutprojekte wie Staudämme, Bewässerungssysteme, Freihandelszonen und viele andere industrielle Entwicklungen. All diese Unternehmungen mögen tatsächlich „Wachstum“ innerhalb der Geldökonomie produzieren, deren Maßstab das BIP ist (obwohl sie mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auch eine drückend schwere Schuldenlast entstehen lassen), doch oftmals tragen sie auch zur Verarmung der Mehrheit der Leute bei und untergraben die Gesundheit der Ökosysteme. Man betrachte nur die folgenden Beispiele:
– Das Narmada-Bewässerungsprojekt, das zurzeit in Indien realisiert wird, beinhaltet den Bau von dreißig großen, 135 mittleren und dreitausend kleinen Dämmen, mit denen das Wasser des Narmada und seiner Zuflüsse nutzbar gemacht werden soll. Insgesamt geht man davon aus, dass durch das Projekt mehr als eine Million Menschen von ihrem Land vertrieben werden und dass 350.000 Hektar Wald zerstört werden, was zu einer Vernichtung empfindlicher Pflanzenarten und einer Massentötung von wild lebenden Tieren führt. Viele der Betroffenen sind Adivasi (indigene Bewohner), die das Land verlieren werden, das sie bereits seit Jahrtausenden bewohnen.
– Überall auf der Welt hat die Einführung von Hybrid-Saatgut im Zuge der „grünen Revolution“ zu kurzfristigen Steigerungen der landwirtschaftlichen Produktivität geführt, doch zu einem hohen Preis. Die neuen Sorten brauchen viel (und teuren) Kunstdünger und Pestizide, welche dem Wasser, dem Boden und der Gesundheit der Landarbeiter schaden. Viele der Sorten brauchen mehr Wasser, was eine extensive Bewässerung erforderlich macht (und genau das führt zu den riesigen Dammprojekten wie in Narmada). Die meisten der neuen Hochertragssorten werden als Monokulturen angepflanzt und verdrängen die traditionellen Mischkulturen. Die Landwirtschaft wird so anfälliger für Dürren, Schädlingsbefall und Krankheiten. (Dankelman/Davidson 1988) In jüngerer Zeit hat die Einführung von gentechnisch veränderten Feldfrüchten wie etwa herbizidresistenten Sojabohnen in Südamerika zu einer weiteren Konzentration des Reichtums bei den Großgrundbesitzern geführt und gleichzeitig die Vertreibung von kleineren Produzenten sowie die Zerstörung komplexer Ökosysteme gefördert.
– Die einst produktive Bauerngemeinde von Singrauli in Indien ist zu einem ökologischen Katastrophengebiet geworden, als ein Dutzend Kohletagebauten und eine Reihe von Kohlekraftwerken in der Gegend errichtet wurden. Die Kontamination des Bodens, der Luft und des Wassers hat zu einer epidemischen Ausbreitung von Tuberkulose, Hautirritationen und anderen Erkrankungen geführt. Siebentausend Menschen, von denen viele früher Bauern waren, arbeiten nun in den Minen. Patricia Adams bemerkt, dass die indische Presse Singrauli mit den „ersten Kreisen von Dantes Hölle“ verglichen hätten (1991).
– In Lesotho, Südafrika, realisiert die Regierung zusammen mit der Weltbank das Highland-Wasserprojekt, im Zuge dessen fünf größere Dämme, 200 Kilometer Tunnel und ein Wasserkraftwerk gebaut werden. Aufgrund der Flutung des Mohal-Dammes wurden 27.000 Siedler von ihren Farmen vertrieben. Ihnen wurde Hilfe bei der Ansiedlung in der Stadt versprochen, doch die meisten von ihnen haben niemals eine Entschädigung erhalten.
– Die größte Goldmine Südamerikas, Yanacocha, wurde in der Nähe von Cajamarca im peruanischen Hochland erschlossen. Für einen kleinen Teil der Bevölkerung bedeutete dies neuen Reichtum, doch die meisten wurden durch steigende Bodenpreise und steigende Preise für andere unverzichtbare Produkte geschädigt. Verbrechen und Prostitution nehmen ebenfalls zu. Zyanid ist ins Grundwasser eingedrungen und hat viele lokale Wasserquellen vergiftet. Mehrere Ströme zeigen bereits Anzeichen der Vergiftung. Darüber hinaus kontaminierte eine Quecksilberlache aus einem Lastwagen im Jahr 2002 einen vierzig Kilometer langen Straßenabschnitt, was zu Vergiftungen von fast tausend Anwohnern führte.
– Die Maquila-Freihandelszone an der Grenze zwischen Mexiko und den USA wurde geschaffen, um die wirtschaftliche Entwicklung Mexikos anzukurbeln. Arbeiter(-innen) (es sind meist Frauen) sind hier zu niedrigen Löhnen beschäftigt und einer großen Bandbreite von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Inzwischen ist das Grenzgebiet voller Umweltgifte, und schwere Schädigungen der Neugeborenen sind an der Tagesordnung.
All diese „Entwicklungsprojekte“ schaffen Wachstum nach dem Maßstab des BIP. Doch sie haben zu keiner besseren Lebensqualität der Bevölkerungsmehrheit geführt. Alle zerstören sie die natürlichen Ökosysteme und untergraben die Fähigkeit der Erde, Leben zu beherbergen. Dennoch beharren die meisten Wirtschaftsfachleute und „Entwicklungsexperten“ weiterhin darauf, dass der Weg zum Fortschritt über diese Art von Fehlentwicklung führe. Warum nur?
Die Zerstörung der Subsistenz
Ein Schlüsselproblem besteht darin, dass Entwicklung im westlichen Sinne, unter Rückgriff auf den irreführenden Indikator BIP, traditionelle Subsistenzwirtschaften nicht entsprechend wertschätzen kann. Das sind Wirtschaften, die auf die Produktion für den unmittelbaren, lokalen Konsum ausgerichtet sind. So wie die Bewohner von Ladakh vor einigen Jahrzehnten können sich die Menschen innerhalb einer Subsistenzwirtschaft einer recht hohen Lebensqualität erfreuen und Zeit für die Familie und kulturelle Aktivitäten haben, ohne dass viel Geld im Umlauf ist. Durch die verzerrende Brille der modernen Wirtschaft betrachtet, wird dieser Mangel an Bargeld-Transaktion als Armut gedeutet, als ein „Problem“, gegenüber dem man „Abhilfe“ schaffen muss.
Doch die indische Ökofeministin Vandana Shiva bemerkt: „Die kulturell bestimmte Wertung des Subsistenzdaseins als Armut gibt auch keine Auskunft über ein tatsächlich vorhandenes niedriges Niveau physischer Lebensqualität.“ (Shiva 1989 a, 22)14 Lokal erzeugte, unverarbeitete Lebensmittel, die ohne Chemikalien produziert wurden, sind fast immer gesünder als die Nahrung im Westen. Kleidung und Häuser, die aus natürlichen Materialien hergestellt wurden, sind oftmals dem lokalen Klima besser angepasst und fast immer eher erschwinglich. Shiva merkt an: „Und als kulturell befangenes Projekt zerstört diese Entwicklung ganzheitliche und tragfähige Lebensstile und löst so konkret erfahrbare, materielle Armut aus. Mit anderen Worten: Dieses Projekt lässt Elend entstehen, indem es die Voraussetzungen für das Leben selbst negiert und alle verfügbaren Ressourcen für die Warenproduktion abzieht.“ (Shiva 1989 a, 22). „Die Waren nehmen zu, doch die Natur ist verkümmert. Die Armutskrise des Südens kommt von der zunehmenden Knappheit von Wasser, Lebensmittel, Futter und Brennstoff, wie sie mit der wachsenden Fehlentwicklung und ökologischen Zerstörung eihergeht.“ (Shiva 1989 b, 5)
Die von den Befürwortern der Entwicklung verschriebene „Heilkur“ besteht also in Megaprojekten, in Feldfrüchten für den Export, in der Verstärkung der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. All diese Maßnahmen vermehren den Geldfluss, doch sie berauben die Armen auch ihrer Lebensmöglichkeit. Frauen sind oft die am stärksten Betroffenen eines solchen Wandels. „Diese Armutskrise trifft die Frauen am härtesten, erstens, weil sie unter den Armen die Ärmsten sind, und dann weil sie von Natur aus die Hauptstützen der Gesellschaft sind.“ (Shiva 1989 b, 5)
So werden zum Beispiel Subsistenzbauern, oftmals Frauen, häufig von der kommerziellen Landwirtschaft verdrängt und verlassen ihre Familien ohne irgendein Einkommen. Dies beschleunigt oft den Prozess der Urbanisierung, da die Familien, die aus ihrer traditionellen Wirtschaft herausgerissen werden, in den Städten auf Jobsuche gehen. Diese Jobs finden sich häufig im Niedriglohnsektor wie etwa in den Maquilas von Mexiko und Zentralamerika. Gleichzeitig geraten die lokalen Ökosysteme unter Druck, da Wälder abgeholzt und Pestizide eingeführt werden und da Fabriken und Minen das Land, das Wasser und die Luft verschmutzen. David Korten schließt daraus:
„Nach mehr als dreißig Jahren in der Entwicklungshilfe habe ich erst vor Kurzem das Ausmaß erkannt, in dem das Entwicklungsprojekt des Westens den Leuten die traditionellen Mittel für ihr Leben genommen und die von den Familien und den Gemeinden geschaffenen Sicherheitsnetze zerstört hat, um eine Abhängigkeit von den Jobs und Produkten der Konzerne zu erzeugen. Es ist die Fortsetzung jenes Prozesses, der mit der Einzäunung bzw. Privatisierung von Land in Gemeineigentum in England begann, um die Gewinne der Produktion in den Händen einiger weniger anstatt der Vielen zu konzentrieren […] Landwirtschaft, Verwaltung, ein Gesundheitswesen und Erziehung unter lokaler Kontrolle und in gegenseitiger Unterstützung [werden ersetzt] durch Systeme, die für eine zentrale Kontrolle besser handhabbar sind.“ (1995, 251)
Anpassung an die Fehlentwicklung
Vor mehr als einem Jahrzehnt haben Forscher der Yale University und zweier größerer botanischer Gärten in den USA eine Studie über den Wert der sogenannten kleineren Waldprodukte veröffentlicht, die in einem intakten Regenwald geerntet werden. Im Durchschnitt belief sich der Wert von Naturkautschuk, essbaren Früchten und anderen Gütern pro Hektar auf etwa 6000 US-Dollar. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was man mit Viehwirtschaft auf durch Rodung gewonnenem Weideland oder mit Holz aus schnell wachsenden Baumpflanzungen erzielen kann.
Und dennoch werden zehn Millionen Hektar Regenwald jedes Jahr abgeholzt oder einfach abgebrannt. Oftmals bieten Regierungen wie etwa die von Brasilien oder Indonesien direkte oder indirekte Anreize dafür. Warum? Im Gegensatz zu traditionellen Produkten aus dem Regenwald, die weitgehend auf lokalen Märkten feilgeboten werden, kann Großvieh, Soja und Bauholz auf dem Weltmarkt verkauft werden, wo sie „bedeutende Mengen an Devisen“ einbringen. Es sind „herausragende Exportgüter, die von der Regierung kontrolliert und mit großzügigen Bundesmitteln unterstützt werden“ (zitiert bei Adams 1991, 36). Diese Fähigkeit, auf dem Weltmarkt Devisen zu erwirtschaften, ist entscheidend, denn man braucht harte Währungen, um die riesigen Auslandsschulden zu bedienen.
Tatsächlich wird auf verschuldete Länder immenser Druck ausgeübt, damit sie ihren Schuldendienst leisten. Internationale Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfond (IWF) und die Weltbank verhängen harte Maßnahmen – die sogenannten Strukturanpassungsmaßnahmen – als Bedingung für neue Kredite. Ziel dieser Strukturanpassungsmaßnahmen ist es, die Devisenerwirtschaftung für den Schuldendienst sicherzustellen. Zu diesem Zweck müssen die Regierungen der betroffenen Länder die Inflation unter Kontrolle halten (durch die Beschränkung des Konsums im eigenen Land), Regierungsausgaben kürzen, eine exportorientierte Landwirtschaft und Industrien fördern, die Ressourcen ausbeuten, die Position der Arbeiter schwächen und den Schutz der Umwelt begrenzen, sowie Auslandsinvestitionen (meistens vonseiten transnationaler Konzerne) erleichtern. Kurioserweise kann die Auslandsverschuldung, deren Bekämpfung ja das erklärte Ziel der Strukturanpassungsmaßnahmen ist, weitgehend auf diese Art von Mammutprojekten zurückgeführt werden, die mit der Praxis der „Fehlentwicklung“ zusammenhängen. Dazu kommen die Auswirkungen schlechter Kreditbedingungen und hoher Zinssätze.
In der Praxis führen die Strukturanpassungsmaßnahmen selten zu einer Verringerung der Schuldenlast, wie sie es eigentlich sollten. In Wirklichkeit können sie das Problem sehr wohl verschärfen. Die Strukturanpassungsmaßnahmen führen oftmals durch die Erhöhung der internen Zinssätze zwecks Eindämmung der Inflation zu einer Rezession. Da der Konsum im Land, die Beschäftigungsrate und die Löhne sinken, verringern sich auch die Steuereinnahmen. Da immer mehr Länder die Produktion derselben Exportgüter steigern, wachsen Angebot und internationaler Wettbewerb, was die Preise, die Einkünfte und die Löhne letztlich nach unten drückt. Man benötigt neue Kredite, lediglich um die Zinsen für die alten Schulden zu bezahlen (was oft mit weiteren Strukturanpassungsmaßnahmen verbunden ist), und oftmals müssen die Zinsen im Land noch stärker erhöht werden, um noch mehr Geld anzulocken.
Als Strategie, um die Rückzahlung der Schulden zu gewährleisten, haben Strukturanpassungsmaßnahmen also hoffnungslos versagt. Und dennoch haben die Gläubiger aus dem Norden als Bedingung für neue Kredite darauf bestanden, dass sie durchgesetzt werden. Warum? Die tatsächliche Absicht hinter den Strukturanpassungsmaßnahmen scheint es gewesen zu sein, ein billiges Heer von Arbeitern zu schaffen, das verzweifelt um Jobs bettelt, billige Rohstoffe für den internationalen Markt sicherzustellen und den transnationalen Konzernen neue Märkte zu erschließen. Diesen Prozess bezeichnet man üblicherweise als die Durchsetzung der „neoliberalen Wirtschaft“. Das ist ein Modell eines ungezügelten Kapitalismus, das den Wohlstand der großen Mehrheit der Menschen genauso opfert wie die Erde, nur um einige Wenige reicher zu machen. In vieler Hinsicht kann man die Strukturanpassungsmaßnahmen als eine Art moderne Schuldnerhaft betrachten, die ganze Völker und Ökosysteme gefangen nimmt.
In einem Interview mit dem New Internationalist im Jahr 1999 beschrieb der frühere Präsident von Tansania, Julius Nyerere, kurz vor seinem Tod, auf welche Weise die Strukturanpassungsmaßnahmen zur Verarmung von Millionen geführt und die tatsächlichen Fortschritte einer echten menschlichen Entwicklung zunichte gemacht haben.
„Im vergangenen Jahr war ich in Washington. Bei der Weltbank war die erste Frage, die sie mir stellten: ‚Wie kam es zu Ihrem Scheitern?‘ Ich antwortete, dass wir ein Land übernommen hatten, dessen Bevölkerung zu 85 % Analphabeten waren. Die Briten hatten uns 43 Jahre lang regiert. Als sie abzogen, gab es zwei ausgebildete Ingenieure und zwölf Ärzte. Das war das Land, das wir geerbt hatten. Als ich abtrat, gab es eine Alphabetisierungsrate von 91 %, und fast jedes Kind ging zur Schule. Wir bildeten Tausende Ingenieure, Ärzte und Lehrer aus. Im Jahr 1988 betrug das Pro-Kopf-Einkommen in Tansania 280 US-Dollar. Jetzt, im Jahr 1998, ist es auf 180 US-Dollar gesunken. Also fragte ich die Leute von der Weltbank, was falsch gelaufen war. Denn in den letzen Jahren hatte Tansania formell seine Zustimmung gegeben und alles getan, was der IWF und die Weltbank wünschten. Der Schulbesuch fiel auf 63 % zurück, und die Bedingungen im Gesundheitswesen und anderen sozialer Einrichtungen haben sich verschlechtert. Ich gab die Frage nun an sie zurück: ‚Was lief schief?‘“ (Bunting 1999, http://www.newint.org/features/1999/=1/anticolonialism/)
Das Versagen der Strukturanpassungsmaßnahmen drückt sich nicht nur in der Verarmung eines großen Teils der Menschheit aus, sondern auch in der Verwüstung der Erde selbst. Die landwirtschaftliche Exportproduktion erfordert den massiven Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden; Regenwälder werden für den Holzexport abgeholzt; empfindliche Mangrowensümpfe werden in Garnelenzüchtungen verwandelt; Bergbau und Schmelzöfen erzeugen ein tödliches Gebräu giftiger Chemikalien.
Die Strukturanpassungsmaßnahmen setzen tatsächlich auch den einzigen Marktmechanismus außer kraft, der die Erhaltung des natürlichen Reichtums der Erde fördern könnte. Wenn Waren knapper werden, dann sollte theoretisch der Preis steigen und die Produzenten zwingen, effizienter zu werden und nach ökologisch sinnvolleren Alternativen zu suchen. Genauso sollte bei steigenden Preisen der Konsum abnehmen und so für die Erhaltung sorgen.
Doch die Strukturanpassungsmaßnahmen haben leider diese Art von Regulierung auf der Basis von Marktbeziehungen schwer beeinträchtigt. Das neoliberale Modell, das mittels Strukturanpassungsmaßnahmen durchgesetzt wurde, zwingt die Länder in einen Wettbewerb der Exportprodukte hinein, um Devisen zu erwirtschaften. Da Holz, mineralische Rohstoffe, Öl und landwirtschaftliche Produkte in einem nicht nachhaltigen Ausmaß exportiert werden, entsteht vorübergehend ein künstliches „Überangebot“, und die Preise werden niedrig gehalten. Auf diese Weise können Marktmechanismen, die ansonsten die Erhaltung oder ökologisch verträglichere Alternativen fördern würden, nicht mehr effektiv wirken. Es sieht so aus, als würden die Preise erst dann steigen, wenn viele der Ressourcen der Erde praktisch erschöpft sind, was tatsächlich die Gefahr eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs anstelle eines allmählichen Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft heraufbeschwört.
Entwicklung neu denken
Sowohl die Strukturanpassungsmaßnahmen als auch die Praktiken einer fehlgeleiteten Entwicklung erzeugen eine riesige und nicht abtragbare Schuld gegenüber der armgemachten Mehrheit der Menschheit und gegenüber der gesamten Lebensgemeinschaft, welche die Erde mit uns teilt. Wenn wir diese Schuld sühnen sollen, dann müssen wir vieles von dem, was heute unter dem Namen Entwicklung geläufig ist, neu überdenken und infrage stellen. Insbesondere müssen wir alles in hinterfragen, was traditionelle Kulturen und traditionelles Wissen gefährdet, alles, was Teilhabe und Demokratie schwächt, alles, was die Gesundheit der Ökosysteme untergräbt.
Selbst Projekte, die menschliche Grundbedürfnisse zum Ziel haben, müssen von Zeit zu Zeit hinterfragt werden. So kann zum Beispiel der Bau von Schulen schlechte Auswirkungen haben, wenn das Erziehungssystem die Menschen dazu verleitet, ihre traditionelle Lebensweise zugunsten von Konsumismus und Geldwirtschaft aufzugeben. Krankenhäuser und Kliniken können dazu benutzt werden, um eine Medizin nach westlichem Vorbild durchzusetzen und traditionelle Heiler und Heilverfahren zu verdrängen. Straßen können die Abhängigkeit vom Öl vergrößern und die Produktion von Lebensmitteln für den Export fördern.
Entwicklung muss daher ebenso wie Wachstum eher in qualitativer denn in quantitativer Hinsicht neu bewertet werden (besonders wenn die zu messenden Einheiten, sofern Geld und das BIP als Maßstab gelten, in sich fragwürdig sind). Auf diese Weise muss Entwicklung dazu übergehen, nicht mehr kurzfristige Zwecksetzungen und Profit für wenige zu bewerten, sondern langfristige Verbesserungen der Lebensqualität aller und der Kreaturen der Erde. Möglicherweise finden wir sogar zu einer neuen Ausdrucksweise, welche nicht mehr mit dem negativ aufgeladen ist, was wir heute mit „Entwicklung“ verbinden. Manche sprechen jetzt von „nachhaltiger Entwicklung“. Theoretisch meint dies eine Entwicklung, welche das Wohl der kommenden Generationen nicht gefährdet. In der Praxis jedoch scheint der „Entwicklung“ immer der Vorrang vor der „Nachhaltigkeit“ eingeräumt zu werden. Eine weitere Alternative ist „nachhaltige Gemeinschaft“. Diese scheint insofern besser zu sein, als sie das anzustrebende Ziel beschreibt (besonders wenn wir Gemeinschaft in dem umfassenden Sinn verstehen, dass sie andere Kreaturen mit einschließt), doch sie ist möglicherweise zu statisch. Wir könnten es mit „Ökoentwicklung“, „nachhaltige Gemeinschaftsentwicklung“ oder sogar mit „partizipative Koevolution“ als geeignetere Bezeichnungen versuchen.
Um wirklich nachhaltige Gemeinschaften aufzubauen, müssen wir von der Weisheit gesunder Ökosysteme lernen, in denen der Abfall von anderen Organismen dem Kreislauf wieder zugeführt wird, um von Neuem Leben hervorzubringen. Ein faszinierendes Beispiel dafür ist die Aigamo-Methode, um Reis anzubauen. Sie wurde von Takio Furuno aus Japan entwickelt: In den gefluteten Reisfeldern werden Enten gehalten, die für die Reispflanzen eine Quelle natürlichen Düngers darstellen. Zusätzlich fressen die Enten das meiste Unkraut (nicht die Reispflanzen, denn diese schmecken ihnen nicht) und machen damit eine Menge schwerer, den Rücken belastender Handarbeit überflüssig. Auch ein im Wasser wachsendes Farnkraut wird benutzt, um zusätzlichen Stickstoff und zusätzliches Futter für die Enten zu liefern. Mehr als 75.000 Reisbauern in Asien wenden diese Methode an. Durchschnittlich nahmen dadurch die Ernteerträge um 50 bis 100 % zu, ohne dass chemische Substanzen verwendet werden mussten. Und die Enten sind für die Bauern eine zusätzliche Eiweißquelle bzw. tragen zusätzlich zum Lebensunterhalt bei (Ho 1999).
Überall auf der Welt findet man zahlreiche andere Beispiele für ein solches schöpferisches ökologisches Denken. Diese Art von „Ökoentwicklung“ zeigt, dass es möglich ist, das Leben der menschlichen Gemeinschaften zu verbessern und dabei die Erde gesund zu erhalten. Wenn wir irgendeine Form der Ökoentwicklung in Angriff nehmen, sollten wir in der Tat von der Weisheit vieler autochthoner Völker in Amerika lernen, die die Folgen ihrer Handlungen für die sieben folgenden Generationen in den Blick nehmen. Mike Nickerson sagt es pointiert: „Mehr als siebentausend Generationen haben sich darum gesorgt und sich abgeplagt, um uns das Leben zu ermöglichen. Sie haben uns die Sprache, Kleidung, Musik, Werkzeuge, Ackerbau, Sport, Wissenschaft und ein umfassendes Verständnis der Welt in und um uns herum gegeben. Wir sind gewiss dazu verpflichtet, Wege zu finden, um wenigstens weiteren sieben Generationen all dies zu ermöglichen.“ (1993, 12)
Herrschaft der Konzerne
Wir können nicht hoffen, von einem unbegrenzten, unqualifizierten Wachstum und einer fehlgeleiteten Entwicklung wegzukommen, wenn wir uns nicht den entscheidenden Mächten auf Weltebene stellen, welche diese Erkrankungen weiter gedeihen lassen: die transnationalen Konzerne. Die fünfhundert größten Konzerne der Welt beschäftigen 0,05 % der Bevölkerung, aber sie kontrollieren 25 % der weltweiten Wirtschaftsleistung (gemessen am Maßstab des BIP) und wickeln 70 % des Welthandels ab. Die Hälfte der einhundert führenden Ökonomien der Welt sind keine Länder, sondern Konzerne. Die dreihundert führenden Konzerne (dabei sind die Finanzinstitute nicht mit berücksichtigt) besitzen etwa ein Viertel des weltweiten Produktivvermögens, und die fünfzig größten Finanzgesellschaften kontrollieren 60 % allen Produktivkapitals. (Korten 1995, 222) Tom Athanasiou schreibt:
„Die transnationalen Konzerne sind sowohl die Architekten als auch die Gebäudeteile der Weltwirtschaft [… Sie] diktieren die allgemein geltenden Maßstäbe […]. Sie sind regionale und globale Akteure in einer Welt, die in Nationen und Stämme aufgesplittert ist. Sie spielen ein Land gegen das andere, ein Ökosystem gegen das andere aus, einfach deshalb, weil das ein gutes Geschäft ist. Niedrige Löhne und Sicherheitsstandards, Ausplünderung der Umwelt, endloses Wachsen der Bedürfnisse – all das sind Symptome wirtschaftlicher Kräfte, die in den transnationalen Konzernen Gestalt gewinnen und so mächtig sind, dass sie alle Beschränkungen einer Gesellschaft, der sie angeblich dienen, durchbrechen.“ (1996, 196)
Transnationale Konzerne haben zielstrebig daran gearbeitet, die Regeln der globalen Ökonomie zu ihren Gunsten zu gestalten. In großen wie kleinen Ländern sind sie in der Lage, beträchtlichen Einfluss auszuüben:
– durch die Pflege „freundschaftlicher Beziehungen“ mit politischen Parteien;
– durch das Versprechen (bzw. die Drohung), Investitionen und damit Arbeitsplätze zu schaffen bzw. abzuziehen;
– indem sie auf die globalen Finanzmärkte Druck ausüben, über die Politik einer Regierung faktisch durch Machenschaften wie Währungsspekulation „abzustimmen“.
Gemessen an ihrer Kontrolle der Weltwirtschaft ist dieser politische Einfluss in den letzten fünfundzwanzig Jahren wirklich massiv geworden. So überrascht es nicht, dass die Politik der Strukturanpassungsmaßnahmen großen Konzernen gegenüber extrem wohlwollend ist. Darüber hinaus sind wirtschaftliche Regeln, wie sie in Verträgen und Institutionen verankert sind, die über Handel und Investitionen bestimmen – wie zum Beispiel die WTO (Welthandelsorganisation), die NAFTA (nordamerikanisches Freihandelsabkomen) oder das (wenigstens vorläufig gescheiterte) Multilaterale Abkommen über Investitionen (MAI) (oder in jüngster Zeit TTIP, Ceta, etc.; d. Übers.) – weitgehend „Freibriefe“ für transnationale Konzerne. Martin Khor, der Leiter des Third World Network, stellt fest, dass die Welthandelsabkommen als „Weltwirtschaftspolizei fungieren, um neue Regeln durchzusetzen, die die außerhalb jeder politischen Einbindung vonstatten gehenden Operationen der transnationalen Konzerne in höchstem Maß steigern“ (Khor 1990, 6).
Dieser neue globale Rahmen macht es für Bürger und Regierungen zunehmend schwerer, das Wohl der Menschen und der Natur zu schützen. So wurde zum Beispiel die kanadische Regierung dazu gezwungen, ihr Verbot des provinzübergreifenden Handels mit dem Treibstoffzusatz MMT, der sich als ein starkes Nervengift erwiesen hatte, aufzuheben, denn die Regeln der NAFTA untersagen solche Beschränkungen. Ironischerweise ist MMT in den USA, dem Land, in dem die Ethyl Corporation die Chemikalie produziert, nicht zugelassen. Ein anderes Beispiel findet sich in den der WTO vorgeschlagenen Veränderungen, die Zölle auf alle Waldprodukte aufzuheben und Investoren den ungehinderten Zugang zu den Wäldern anderer Länder zu gestatten. Sie hätten keinerlei Verpflichtungen, sich an im betreffenden Land geltende Arbeits- und Umweltgesetze zu halten.
Konzerne und ökologische Zerstörung
Zusätzlich zur Förderung von weltweiten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die einen effektiven Schutz von Natur und Arbeitern nahezu unmöglich macht, spielen transnationale Konzerne eine direkte Rolle bei vielen der ökologisch zerstörerischen Aktivitäten. Die transnationalen Konzerne produzieren mehr als die Hälfte aller fossilen Brennstoffe und sind direkt für mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Darüber hinaus produzieren die transnationalen Konzerne fast alle die Ozonschicht zerstörenden chemischen Substanzen. Sie kontrollieren auch 80 % des Landes, das der exportorientierten Landwirtschaft gewidmet ist. Bloß zwanzig transnationale Konzerne stehen für 90 % aller Pestizidverkäufe (Athanasiou 1996). Des Weiteren spielen transnationale Konzerne wie General Electric, Mitsubishi und Siemens eine größere Rolle bei Atomkraftwerken.
In jüngerer Zeit haben transnationale Konzerne eine wachsende Kontrolle über das Saatgut der Welt, ja sogar über das genetische Material selbst, erlangt. Sie haben sich Lebensformen und sogar einzelne Gene patentieren lassen. Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen, wie sie von transnationalen Konzernen wie Monsanto und Aventis produziert und kontrolliert werden, hat sich seit 1995 stark ausgebreitet und betrifft heute mehr als hundert Millionen Hektar (das ist ungefähr die Größe Boliviens oder Frankreichs und Deutschlands zusammengenommen). Bereits 60 % der Sojabohnen weltweit und 25 % der Maispflanzen enthalten Gene aus anderen Arten.
„Transgene“ Feldfrüchte bergen eine doppelte Gefahr in sich. Da das Saatgut dem produzierenden Konzern gehört, entzieht es den Bauern die Kontrolle über die Versorgung mit Saatgut (dieser Prozess begann in kleinerem Maßstab bereits mit den Hybridpflanzen im Zuge der „grünen Revolution“ im letzten Jahrhundert). Um dieses Saatgut verwenden zu dürfen, sind die Bauern gezwungen, einen „Vertrag über die Verwendung der Technik“ zu unterzeichnen, der es verbietet, Saatgut aus der Ernte für die Aussaat im kommenden Jahr aufzuheben. Die Konzerne haben sogar daran gedacht, in das Saatgut selbst genetische Kontrollen einzubauen, die es faktisch steril machen würde. Doch bislang fand diese „Terminator“-Technik noch keine Billigung.
Beunruhigender aber ist vielleicht die Tatsache, dass transgene Pflanzen das Ergebnis einer künstlichen Übertragung von Genen von einer Art auf eine andere sind, indem man die DNA manipuliert. Dieser im Wesentlichen zufallsgesteuerte Prozess der Einbringung fremder Gene kann unbeabsichtigte Auswirkungen auf das Genom einer Pflanze haben. Tatsächlich ist nur ein verschwindender Teil genetischer Experimente erfolgreich. Doch Gene vermehren sich und breiten sich aus, und jeder unbeabsichtigte Effekt ‒ darunter spätere Mutationen aufgrund eines weniger stabilen Genoms – könnte sich sehr rasch durch Pollen auf wichtige Arten von Feldfrüchten übertragen.
Warum verbietet man angesichts der potenziellen Risiken gentechnisch veränderte Organismen nicht einfach? Große Chemie- und Agrokonzerne behaupten, transgene Pflanzen seien notwendig, um die Nahrungsmittelproduktion zu steigern und sogar, um den Einsatz von chemischen Substanzen in der Landwirtschaft zu verringern. Doch keines der Argumente scheint wirklich zu tragen. Wie wir gesehen haben, ist die Hauptursache für Hunger und Armut die unzulängliche Verteilung des Wohlstands und die Verschlechterung der Ökosysteme. Transgene Pflanzen werden, indem sie den Konzernen die Kontrolle über das Saatgut sichern und die Ökosysteme genetisch kontaminieren, diese Probleme nur noch verschlimmern. Selbst wenn die Nahrungsmittelproduktion bedeutend gesteigert würde, hätte das höchstwahrscheinlich keine Auswirkungen auf die Armut. Tatsächlich führen höhere Erträge oft zu niedrigeren Preisen, was bedeutet, dass die Kleinbauern faktisch verarmen.
Dazu kommt, dass keine der bislang in den Handel gebrachten transgenen Pflanzen die Ernteerträge oder die Ernährung verbessern sollte. Fast alle Veränderungen zielten auf eine Herbizidtoleranz (die es Farmern ermöglicht, Unkraut auszutilgen, ohne die Feldfrüchte dabei zu schädigen) oder Insektizidresistenz ab. Sie erleichtern es Konzernen und Großgrundbesitzern auch, ihre bebauten Flächen zu erweitern. Tatsächlich haben Großgrundbesitzer in Argentinien und Paraguay Herbizide auf benachbarte Grundstücke versprüht, um die Feldfrüchte der kleineren Bauern zu vernichten und sie zum Landverkauf zu zwingen.
Die beste Art, Nahrungssicherheit zu gewährleisten, ist es, eine große Bandbreite von pollenbefruchteten Pflanzen zu verwenden. Dies garantiert eine genetische Vielfalt und damit eine Kombination von Eigenschaften, die die Anpassung an Wetter und Bodenbedingungen ermöglichen. Lovins und Lovins schreiben: „Die neue Pflanzenkunde zielt darauf ab, die Entwicklung der Pflanzen nicht an ihrem evolutionären, sondern an ihrem wirtschaftlichen Erfolg auszurichten: Überleben nicht der am besten Angepassten, sondern der Fettesten, derer, die am besten geeignet sind, vom Verkauf monopolisierter Produkte in großem Stil zu profitieren.“ (2000)
Aufgrund der massiven Investitionen transnationaler Konzerne in ökologisch zerstörerische Technologien sind sie zu einem mächtigen Faktor geworden, der sich ökologisch vernünftigeren Vorgehensweisen widersetzt. Wesentlich mehr Geld wurde in den letzten zwanzig Jahren in Atomenergie als in Sonnen- und Windenergie gesteckt, vor allem, weil es für die transnationalen Konzerne leichter war, aus dieser zentral kontrollierten Technik (und deren militärischen „Spin-off-Effekten“) Profit zu schlagen. Gleichzeitig haben Ölkonzerne massive Werbekampagnen gestartet, um Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Annahme von der globalen Erwärmung zu streuen, obwohl es unter Wissenschaftlern Konsens ist, dass die Aktivität des Menschen einen deutlichen (und die meisten würden sagen: einen bei Weitem vorherrschenden) Einfluss auf die globale Erwärmung hat.
Natürlich gibt es Konzerne, die tatsächlich die Ökologie fördern. Große Versicherungsgesellschaften machen sich Sorgen über Sturmschäden aufgrund der globalen Erwärmung und betreiben deshalb seit einiger Zeit Lobbyarbeit für eine Reduktion der Treibhausgase. Es gibt viele Konzerne – meist kleinere ‒, die ökologisch besser verträgliche Technologien entwickeln, wie zum Beispiel Solarmodule, Windgeneratoren und Brennstoffzellen. Doch insgesamt widersetzen sich die größten und mächtigsten transnationalen Konzerne alternativen Technologien, wenn sie keine Mittel finden, sie um ihres Profits willen zu kontrollieren und zu beherrschen.
Es ist also klar, dass große transnationale Konzerne immer noch den Hauptteil der Verantwortung für die ökologische Zerstörung tragen, die wir derzeit erleben. Dies wird sich wahrscheinlich nicht ändern, wenn nicht die Art und Weise, wie Konzerne strukturiert und gelenkt sind, einem radikalen Wandel unterzogen wird. Paul Hawken (1993) schreibt, dass Unternehmen von ihrer Bilanz her besser dastehen, wenn sie die Tatsache, dass sie um des heutigen Profits willen die Zukunft bestehlen, einfach ignorieren. Wenn ein Konzern versucht, wirklich ethisch, gerecht und ökologisch zu werden, dann bedingt das Ausgaben, die andere nicht haben. Langfristig gesehen, untergraben viele Konzerne ihre eigene Profitabilität, doch Aktienkurse berücksichtigen selten langfristige Perspektiven.
Korporative Personen in großem Maßstab
Viele Analytiker stellen fest, dass unser derzeitiges Problem mit den Konzernen darauf zurückzuführen sei, dass Gerichte in den USA (und später die anderer Länder) den Konzernen das Recht zugesprochen haben, wie juridische Personen behandelt zu werden. Man hat eine ganze Reihe von Rechten auf sie ausgedehnt, darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung und politische Teilhabe. Doch, so zeigt Kalle Lasn auf, Konzerne sind in Wirklichkeit gar keine Personen:
„Ein Konzern hat kein Herz, keine Seele, keine Moral. Er kann keinen Schmerz empfinden. Man kann mit ihm nicht streiten. Deshalb ist ein Konzern nichts Lebendiges, sondern ein Prozess, eine effektive Art und Weise, Einkünfte zu erzielen […]. Um weiter ‚am Leben‘ zu bleiben, muss er lediglich eine Bedingung vorfinden: Sein Einkommen muss seine Ausgaben langfristig übersteigen. Solange dies der Fall ist, kann er auf unbestimmte Zeit existieren. Wenn ein Konzern Menschen verletzt oder die Umwelt schädigt, wird er kein Bedauern und kein schlechtes Gewissen verspüren, denn von seinem inneren Wesen her ist er nicht dazu in der Lage […]. Wir dämonisieren Konzerne wegen ihres unerschütterlichen Strebens nach Wachstum, Macht und Wohlhaben. Doch sie erfüllen nur die Befehle, die ihrer inneren Anlage entsprechen. Genau dafür wurden Konzerne – von uns – geschaffen.“ (1999, 221)
In ähnlicher Weise behauptet Joel Bakan, dass die überdimensionalen korporativen Personen als kranke Wesen geschaffen wurden. Wir können von ihnen nicht erwarten, dass sie sich ethisch verhalten, solange sie in einer Weise strukturiert sind, dass sie wie Psychopathen denken und handeln:
„Von seinem Zuschnitt her schützt das Konstrukt der Korporative die Menschen, welche Konzerne betreiben, vor der gesetzlichen Haftung, indem man dem Konzern – einer ‚Person‘ mit einer psychopathischen Missachtung gesetzlicher Schranken – die Hauptlast der Strafverfolgung aufbürdet […]. Als Psychopath kann der Konzern moralische Gründe, anderen nicht zu schaden, weder anerkennen noch danach handeln. Von seiner rechtlichen Verfasstheit her gibt es nichts, was dem Grenzen setzen könnte, was er in der Verfolgung seiner eigennützigen Ziele anderen antut, und er ist dazu gezwungen, Schaden anzurichten, damit die Einnahmen die Kosten übersteigen. Lediglich die pragmatische Sorge um seine Eigeninteressen und die Gesetze eines Landes legen dem Raubtierinstinkt eines Konzerns Beschränkungen auf, und oftmals reicht das nicht aus, um ihn darin zu stoppen, Leben zu zerstören, Gemeinden zu schädigen und den Planeten insgesamt in Gefahr zu bringen.“ (2004, 79 und 60).
David Korten bemerkt, dass die Konzerne als „Super-Personen“ nun außer Kontrolle sind. Selbst diejenigen, die einen Konzern „betreiben“, wurden zunehmend überflüssig. Konzerne sind nun eine
„… ‚Größe für sich‘ mit keinen echten Verbindungen zu den Menschen oder dem Standort. Tatsächlich, so behauptet er, entfernen sich die Interessen von Konzernen zunehmend von denen der Menschen und der planetarischen Gemeinschaft insgesamt. Dennoch erlangen Konzerne weiterhin immer mehr Kontrolle über unser Leben. Es ist fast so, als erlebten wir eine Invasion von Außerirdischen, die unseren Planeten zu kolonisieren versuchen, uns zu Sklaven degradieren und so viele von uns wie möglich ausgrenzen.“ (1995, 74)
John Ralston Saul (1995) stellt fest, dass dieser Trend große Ähnlichkeit mit den Zielen korporativer Bewegungen wie etwa dem Faschismus der 1920er- und 1930er-Jahre aufweist. Diese strebten danach, a) die Macht den Menschen und Regierungen zu nehmen und sie wirtschaftlichen Interessengruppen zu übertragen; b) „unternehmerische Initiative in Bereichen zu fördern, die normalerweise öffentlichen Körperschaften vorbehalten sind“ (das nennen wir „Privatisierung“); und c) die Bindung des privaten an das öffentliche Interesse zu lösen.
Wenn man diese Aufzählung liest, dann bleibt der Eindruck zurück, dass der Korporatismus trotz des Zweiten Weltkriegs nun in einer neuen, subtileren und machtvolleren Weise triumphiert. Ein weniger demokratisches und weniger ökologisches Modell weltweiten Regierungshandelns ist kaum vorstellbar.
Manchmal scheint die überbordende pathologische Macht der Konzerne unbesiegbar. Doch es werden bereits Risse im Panzer der Konzerne sichtbar. Menschen in Teilen Europas und Brasiliens, ja sogar in einigen Bundesstaaten der USA, haben bereits erfolgreich gentechnikfreie Zonen geschaffen. Progressive Regierungen, besonders in Südamerika, haben die von den transnationalen Konzernen geförderte neoliberale Politik einer ernsthaften Kritik unterzogen. Weltweite Proteste gegen den IWF, die Weltbank und die Welthandelsorganisation (WTO) – alles entscheidende internationale Instrumente für die Herrschaft der Konzerne – haben an Stärke gewonnen. Es ist in weiten Teilen auf diese Bewegung und auf die Wahl von Regierungen, die diesem Programm skeptisch gegenüberstehen, zurückzuführen, dass die WTO-Verhandlungen in den letzten Jahren fast unmöglich wurden.
Korten meint, dass der heutige, von den Konzernen geprägte weltweite Kapitalismus eine starke Ähnlichkeit mit den zentral kontrollierten Ökonomien des früheren Sowjetblocks aufweist. „Der Westen verfolgt nun einen extremistischen ideologischen Weg [ähnlich dem des ehemaligen Ostblocks]; der Unterschied besteht darin, dass wir in die Abhängigkeit von abgehobenen und unkontrollierbaren Konzernen, und weniger von einem abgehobenen und unkontrollierbaren Staat getrieben werden.“ (1995, 88–89) Beide Systeme konzentrieren wirtschaftliche Macht auf zentralisierte Institutionen, die sich der Kontrolle und der Mitbestimmung der Menschen entziehen. Beide stützen sich auf Großstrukturen, die in sich ineffizient und weder für Menschenrechte noch für echte Bedürfnisse empfänglich sind. Und beide bringen eine pervertierte Ökonomie hervor, die andere Lebewesen und Ökosysteme als Ressourcen behandelt, die ohne Folgen aufgebraucht werden können. Wie wir alle wissen, brach das einst als unüberwindbar geltende sowjetische System innerhalb von wenigen Jahren zusammen. Der Kapitalismus der globalen Konzernherrschaft mag sehr wohl ein besser entwickeltes System der Kontrolle und Ausbeutung sein, doch es gibt gute Gründe für die Annahme, dass er einem ähnlichen Schicksal erliegen könnte, wenn er seinen Kurs nicht radikal ändert. Korten stellt fest:
„Ein Wirtschafssystem ist nur so lange machbar, als die Gesellschaft über Mechanismen verfügt, den Missbräuchen vonseiten staatlicher Gewalt oder Marktmacht und der Erosion des natürlichen, sozialen und moralischen Kapitals zu begegnen, die durch solche Missbräuche normalerweise verschärft wird.“ (1995, 89)
Ein parasitäres Finanzsystem
Die von Wachstum, einer fehlgeleiteten Entwicklung und der Konzernherrschaft verursachten Probleme werden durch ein parasitäres Finanzsystem noch verschlimmert, das das Wirtschaftsgeschehen zunehmend verändert: Von der Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen verschiebt sich der Schwerpunkt auf die Profitmacherei durch Manipulation des Geldes. So haben zum Beispiel im Jahr 1993 zwei der größten Konzerne, nämlich General Electric und General Motors, mehr Profit durch ihre Aktivitäten auf dem Finanzmarkt als durch die Herstellung von Elektronik oder Autos erwirtschaftet. (Dillon 1997)
Insgesamt hat die „Finanzwirtschaft“ der Welt die Wirtschaft, die es tatsächlich mit Gütern und Dienstleistungen zu tun hat, weit übertroffen. Finanztransaktionen sind nun siebzigmal mehr „wert“ (da das Geld der Maßstab ist!) als der globale Handel mit konkreten Waren. Der Geldwert der Aktien, die an den weltweit größten Börsen gehandelt werden, stieg von 0,8 Billionen US-Dollar im Jahr 1977 auf 22,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2003. Korten stellt fest: „Dies stellt einen enormen Zuwachs an Kaufkraft für die herrschende Klasse im Vergleich zum Rest der Gesellschaft dar. Es erzeugt die Illusion, dass Wirtschaftspolitik den tatsächlichen Wohlstand einer Gesellschaft vermehrt, wo sie ihn doch in Wirklichkeit vermindert.“ (2006, 68)
Insgesamt reichten die täglichen Transaktionen von Aktien, Währungen, Warentermingeschäften und festverzinslichen Wertpapieren an etwa 4 Billionen Dollar im Jahr 1997 (Dillon) heran, während die Bank für internationale Angelegenheiten hochrechnet, dass sich heute bereits allein die Devisentransaktionen auf diese Summe belaufen (im Jahr 1997 betrugen diese noch 1,5 Billionen US-Dollar). Dillon schreibt: „Die meisten dieser Transaktionen (95 %) sind rein spekulativer Natur. Sie sind an sich nicht notwendig, um die Produktion von Gütern und Dienstleistungen zu finanzieren.“ (1997, 2) Die Einführung neuer Techniken hat dazu beigetragen, dass die Finanztransaktionen an Tempo und Umfang zugenommen haben. Fast alle diese Transaktionen arbeiten jetzt mit „Cybergeld“, das heißt mit elektronischen Transfers per Computer und einer Kommunikation nahezu ohne jede Verzögerung rund um den Globus. Dillon schreibt: „Nichts, was man anfassen könnte, wechselt den Besitzer. Dennoch werden Spekulanten reich, indem sie nicht mehr machen, als Nullen und Einsen an Computerchips zu verschieben, wenn sie Cybergeld kaufen und verkaufen.“ (1997, 3)
Vor vielen Jahren sprach der Wirtschaftswissenschaftler John Meynard Keynes die Warnung aus: „Spekulation kann Schaden anrichten, wenn sie gleichsam in Form von Blasen auf einem steten Strom des Unternehmens schwimmt. Doch die Lage ist dann ernst, wenn das Unternehmen selbst die Blase mitten in einem Whirlpool von Spekulation wird.“ Doch genau dies scheint eine zutreffende Beschreibung unserer gegenwärtigen Weltwirtschaft zu sein. Die Unbeständigkeit, die aus dieser Situation erwächst, kann schnell und plötzlich schweren Schaden anrichten. Im Jahr 1995 trieb ein Händler in Singapore die 233 Jahre alte britische Barings Bank in den Bankrott, nachdem er in einer Transaktion im Umfang von 29 Milliarden Dollar in japanischen Derivaten 1,3 Milliarden Dollar verlor. Noch beunruhigender waren die Finanzkrisen in Mexiko im Jahr 1994 und die Asienkrise im Jahr 1998, die dadurch ausgelöst wurden, dass Investoren plötzlich ihr Geld aus den Regionen abzogen und so die auf Finanzblasen aufruhende Wirtschaft zusammenbrechen ließen. In beiden Fällen schuf der riesige und unbeständige Fluss von spekulativem Kapital die Bedingungen, die schließlich zur Krise führten. In beiden Fällen wurden ausländische Investoren weitgehend durch international finanzierte Bürgschaften vor Verlusten geschützt (nachdem sie vorher sagenhafte Spekulationsgewinne gemacht hatten). Doch die Kosten für diese Finanzpakete wurden von den Menschen und Ökosystemen der betroffenen Regionen getragen, insbesondere in Form einer noch größeren Schuldenlast und der Verhängung weiterer Strukturanpassungsmaßnahmen.
Schließlich hat die jüngste Subprime-Hypothekenkrise, die ihren Ausgang in den USA nahm, in einem noch viel größeren Ausmaß die Finanzmärkte auf der ganzen Welt in den Abgrund gerissen. Wieder einmal führte Spekulation – insbesondere der Handel mit Subprime-Hypotheken, die als Wertpapiere verkauft wurden – zum massiven Zusammenbruch einer auf Finanzblasen basierenden Wirtschaft, diesmal jedoch nicht regional begrenzt, sondern in weltweitem Maßstab. Der Wirtschafswissenschaftler Herman Daly schreibt dazu:
„Das Chaos, in das die Weltwirtschaft gestürzt wurde und dessen Auslöser die Subprime-Hypothekenkrise in den USA gewesen ist, ist keine ‚Liquiditätskrise‘, wie es oft heißt. Eine Liquiditätskrise würde bedeuten, dass die Wirtschaft in Schwierigkeiten wäre, weil die Unternehmen keine Kredite und Darlehen mehr bekämen, um ihre Investitionen zu finanzieren. Tatsächlich aber ist die Krise das Ergebnis eines Überhandnehmens von Finanzvermögen im Vergleich zum Wachstum des realen Wohlstands – das ist das genaue Gegenteil von zu wenig Liquidität. Das Problem, das wir in den USA beobachten, ist entstanden, weil die Summe des realen Wohlstands keine ausreichende Rücklage bildet, um die atemberaubend hohen Schulden zu garantieren. Diese sind entstanden, weil die Banken in der Lage waren, Geld zu schöpfen, Kredite auf der Grundlage von fragwürdigen Vermögenswerten zu gewähren, und aufgrund des Staatsdefizits der USA, das angehäuft wurde, um den Krieg und die jüngsten Steuererleichterungen zu finanzieren […] Um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass Wachstum uns reicher macht, verschoben wir die Kosten auf später, indem wir fast grenzenlos Finanztitel ausgaben und dabei der Bequemlichkeit halber vergaßen, dass diese sogenannten Vermögenswerte für die Gesellschaft insgesamt Schulden darstellen, die aus künftigem Wachstum des realen Wohlstands bezahlt werden müssen. Das künftige Wachstum ist jedoch sehr zu bezweifeln, wenn man von den nach hinten verschobenen realen Kosten ausgeht, während die Verschuldung sich weiterhin auf ein absurdes Niveau verschlimmert.“ (2008)
Wieder einmal wurden die Regierungen dazu gezwungen, das Finanzsystem durch massive Kredite und sogar Aufkäufe von Geldinstituten zu retten. Dabei bürdeten sie dem Steuerzahler ein Risiko von Billionen Dollar auf. Inzwischen zeitigt das Platzen der Blase sehr reale Kosten: die Arbeitslosigkeit steigt an, Menschen verlieren ihr Zuhause und der weltweite Handel schrumpft rasch.
Finanzspekulation ist einerseits von der Realität abgekoppelt, doch sie erzeugt dennoch reale Kosten für die Menschen und die umfassendere planetarische Gemeinschaft. Spekulanten stellen eine ungeheure wirtschaftliche Macht dar. Wie anlässlich der Krisen in Mexiko und in Asien deutlich wurde, können sie ihre Fonds sehr schnell irgendwohin verschieben und als Folge ihrer Entscheidungen Wirtschaften zusammenbrechen lassen. Selbst die Politik der reichsten Länder ist solchem Druck ausgesetzt. In den frühen 1990er-Jahren zum Beispiel führte die kanadische Regierung die Drohung mit finanziellen Repressalien als Grund für die Kürzung von Regierungsausgaben an. Internationale Anleger stellen tatsächlich so etwas wie eine Veto-Macht für die Politik aller Länder dar. Sie drängen sie dazu, Gesetze und Regelungen zu erlassen, die durch eine offene Investmentpolitik (welche die Instabilität noch vergrößert), „freien Handel“, niedrige Steuern und einen schwachen Schutz für Arbeiter und für die Umwelt die Profite der Konzerne vermehren.
Investoren üben auch Macht gegenüber einzelnen Konzernen aus. Um die Kosten zu senken, die Profite zu erhöhen und die Aktienkurse ansteigen zu lassen, vernichten Gesellschafen Arbeitsplätze oder verlagern sie dorthin, wo die Löhne niedriger sind. In ähnlicher Weise erhöht es kurzfristig die Profite und Aktienkurse, wenn „natürliche Vermögenswerte“ durch die Ausbeutung der Reichtümer der Erde in einem nicht nachhaltigen Ausmaß liquidiert werden. Konzerne, die versuchen, verantwortlich zu handeln, die nach langfristiger Nachhaltigkeit anstelle von kurzfristigen Profiten streben, sind intensivem finanziellen Druck ausgesetzt, damit sie sich anders verhalten. Diejenigen, die dies nicht tun, können auch für Finanzinvestoren anfällig werden, die man gemeinhin als „Heuschrecken“ bezeichnet (weil sie Unternehmen ausschlachten; d. Übers.).
Ned Daly zitiert das Beispiel der Pacific Lumber Company, die Holz in den alten Wäldern an der kalifornischen Küste gewinnt. Während der 1980er-Jahre galt die Gesellschaft als ein Modell im Hinblick auf ihr Verhalten gegenüber Arbeitern und der Umwelt, unter anderem wegen großzügiger Zuwendungen an die Arbeiter und innovative Methoden eines nachhaltigen Umgangs mit dem Waldbestand. Genau dieses Verhalten führte dazu, dass die Gesellschaft nur bescheidene Profitraten erzielte, was einen niedrigen Aktienkurs bedingte. Dies wiederum machte sie zu einem erstklassigen Ziel für eine feindliche Übernahme durch den Investor Charles Hurwitz. Als er die Kontrolle übernahm, verdoppelte er sofort den Holzeinschlag und zog vom Rentenfond der Gesellschaft mehr als die Hälfte des Vermögens ab. Das ermöglichte es ihm, die Risiko-Wertpapiere auszubezahlen, mit denen er die Übernahme finanziert hatte, und einen beachtlichen Profit zu erzielen. Sein Gewinn jedoch hatte den Preis einer beschleunigten Zerstörung eines weltweit einzigartigen, majestätischen Waldbestandes (N. Daly 1994).
In gewisser Hinsicht kann man das weltweite Finanzsystem als einen Parasiten betrachten, der Leben aus der Realwirtschaft saugt. Ohne Zweifel ist Finanzinvestment nötig, nämlich produktives Investment, das Arbeitsplätze mit ordentlichen Löhnen schafft, während tatsächliche Nachhaltigkeit innerhalb der Grenzen der Ökosysteme die Zeichen für echte Innovation und Fortschritt sind. Die meisten Investoren der Welt scheinen sich einem „extraktiven Investment“ zu widmen, das keinen Wohlstand schafft, sondern einfach „den existierenden Wohlstand herausholt und konzentriert […]. Im schlimmeren Fall führt das zu einer Abnahme des Wohlstands [und der Gesundheit] der Gesellschaft insgesamt, auch wenn es für den Einzelnen [oder eine Gruppe von Investoren] eine hübsche Rendite einbringen mag.“ (Korten 1995, 195) Die Machenschaften des Charles Hurwitz scheinen ein Paradebeispiel für diese Art von parasitärem Investment zu sein.
Ein illusorischer Wohlstand
Im Zentrum des extraktiven Investments und eines parasitären Finanzsystems steht eine falsche Auffassung vom Geld. Selbst Adam Smith widersprach der Vorstellung, man könne Geld aus Geld machen. Geld war als ein Instrument gedacht, nicht als ein Zweck an sich. John Ralston Saul schreibt: „Die Explosion der Geldmärkte ohne Bezug zur Finanzierung tatsächlicher Aktivitäten ist nichts als Inflation. Und deshalb sind diese Geldmärkte sehr esoterisch, Ideologie in Reinkultur.“ (1995, 153–154)
Der Wirtschaftswissenschaftler Herman Daly (1996) nennt dies einen „Trugschluss unangebrachter Konkretheit“. Wir verwechseln Geld (oder die Nullen und Einsen im Cyberspace, die die reale Währung weitgehend ersetzt haben) mit dem echten Reichtum, den es darstellen soll. Was immer für das abstrakte Symbol des Reichtums als wahr gilt, das – so nimmt man an – trifft auch auf den realen Reichtum zu.
Realer Reichtum aber ist dem Prozess des Verderbens unterworfen. Getreide kann nicht dauerhaft in Scheunen und Silos aufbewahrt werden. Kleidung wird mit der Zeit abgetragen oder von den Motten gefressen. Und Gebäude verfallen mit der Zeit. Im besten Fall kann natürlicher Reichtum (wie Wälder oder Feldfrüchte) in einem Maß, das die Sonneneinstrahlung, die Verfügbarkeit von sauberem Wasser und eines gesunden Bodens vorgibt, gedeihen. Doch realer Reichtum wächst niemals eine bedeutende Zeitstrecke hindurch exponenziell und kann tatsächlich mit der Zeit sogar abnehmen.
Doch Geld verdirbt nicht. Wenn man das Symbol (Geld) mit der Wirklichkeit (Reichtum) gleichsetzt, dann wird Reichtum eine abstrakte Größe unabhängig von den Gesetzen der Physik und Biologie. Er kann immer angehäuft werden, ohne zu verderben. Durch den Zaubertrick der Verschuldung und andere ausgetüftelte Finanzmanipulationen kann Geld sogar mehr werden – und das sogar im Sinne eines exponenziellen Wachstums. Aufgrund des Trugschlusses der unangebrachten Konkretheit nehmen die meisten Wirtschaftswissenschaftler (und viele Politiker, Investoren und die einfachen Leute, die von der Geldillusion vernebelt sind) deshalb an, dass auch der reale Reichtum exponenziell zunimmt.
Tatsächlich ist das akkumulierte Geld überhaupt kein realer Reichtum. Es ist lediglich eine Art Pfandrecht auf künftige Produktion, das aufgrund einer gesellschaftlichen Übereinkunft zu einem späteren Zeitpunkt gegen realen Reichtum eingelöst werden kann.15 Um die wachsenden Pfandrechte auf die Zukunft, die durch diese Art von Kapitalakkumulation hervorgebracht werden, decken zu können, muss die Wirtschaft ständig wachsen, oder der Wert des Geldes muss mittels Inflation reduziert werden, um einen Abgleich zum tatsächlich existierenden Reichtum herzustellen. (Alternativ dazu kann, wie es bei der Subprime-Hypothekenkrise der Fall war, die Blase einfach platzen und eine Kettenreaktion auslösen, die unter anderem den Zusammenbruch von Firmen und den Wertverlust virtueller Vermögen bewirken kann).
An dieser Stelle beginnen wir klarer zu begreifen, wie das Profitstreben der Finanzwirtschaft Reichtum in den Händen von wenigen konzentriert, während es die Armen und die umfassendere planetarische Gemeinschaft noch mehr verarmen lässt. Einerseits ist die Welt dazu gezwungen, ein unbegrenztes Wachstum in einer Art Besessenheit zu verfolgen, um die stets wachsenden Anrechte auf eine zukünftige Produktion erfüllen zu können. Dabei plündert sie den natürlichen Reichtum des Planeten aus. Gleichzeitig führt der Inflationsdruck zur Verarmung besonders der bereits Armen, die kein Einkommen aus Investitionen erzielen, das exponenziell wächst.
Ein anschauliches Beispiel mag hilfreich sein: Zwischen 1980 und 1997 transferierten die ärmeren Länder 2,9 Billionen US-Dollar als Schuldendienst an Banken, Regierungen des Nordens und internationale Finanzinstitutionen wie Weltbank und IWF. Doch im selben Zeitraum wuchs ihre Gesamtverschuldung noch von 568 Milliarden Dollar auf über zwei Billionen. Verschuldung transferiert also massenhaft Ressourcen von den Armen zu den Reichen, und zwar durch den Zaubertrick der sich aufsummierenden Zinsen. Dieses stets wachsende Pfandrecht gegenüber der zukünftigen Produktion der ärmeren Länder kann niemals eingelöst werden. Und doch fährt das parasitäre Weltfinanzsystem fort, die Armen und die Erde selbst auszusaugen, und besteht darauf, dass alles, was nur an Reichtum herausgepresst werden kann, dazu verwendet werden muss, die Finanzwirtschaft zu bereichern.
Geld kolonisiert das Leben
Die meisten von uns betrachten die Ökonomie als die Wissenschaft (oder Kunst) der Produktion, der Verteilung und des Konsums von Reichtum. In einer etwas gröberen Sichtweise denken viele von uns, Ökonomie sei die Kunst des Geldmachens. Im Griechischen jedoch lautet das Wort oikonomia, das ist die Kunst, einen Haushalt – die Gemeinschaft, eine Gesellschaft oder die Erde ‒ zu führen und für ihn zu sorgen. Tatsächlich haben Ökonomie und Ökologie eine gemeinsame Wurzel. Es geht um die Wissenschaft vom Haus (griech.: oikos).
Aristoteles traf eine klare Unterscheidung zwischen „Ökonomie“ und „Chrematistik“. Letzteres meint die spekulativen Tätigkeiten, die nichts von Wert erzeugen, aber dennoch Profit abwerfen. Chrematisitk wird als der „Zweig der politischen Ökonomie“ definiert, „der sich mit der Handhabung von Eigentum und Reichtum beschäftigt mit dem Ziel, den Geldwert für den Besitzer kurzfristig zu maximieren“ (H. Daly/Cobb, 1989, 138).
Aristoteles nimmt das Beispiel des Philosophen Thales von Milet zu Hilfe, um den Unterschied zwischen Ökonomie und Chrematistik zu veranschaulichen. Jahrelang hatten sich die Mitbürger über den einfachen Lebensstil des Thales lustig gemacht. Sie fragten: „Wenn die Philosophie so wichtig ist, warum warst du dann nicht imstande, Reichtum anzuhäufen?“ Thales entschloss sich dazu, ein praktisches Exempel zu statuieren. Aufgrund seiner astronomischen Kenntnisse war er in der Lage, eine Rekordernte für Oliven vorherzusagen. Deshalb mietete er noch während des Winters alle Olivenpressen zu einem sehr günstigen Preis. Als die Rekordernte dann eintraf, nutzte er seine Monopolstellung aus, um einen beachtlichen Profit für sich selbst zu erzielen – doch auf Kosten der Gemeinschaft insgesamt.
In vieler Hinsicht ähnelt das, was Thales getan hat, dem, was heute auf den Weltfinanzmärkten vor sich geht. Er jedoch sah es als das an, was es ist – eher als eine Übung in Chrematistik, nicht in Ökonomie. Letztendlich hatte er nichts von Wert geschaffen. Er hat keine neuen Nutzanwendungen für Olivenöl erfunden, er hat keine neue Olivenpresse gebaut und keine Olivenbäume gepflanzt. Er hat sich einfach nur selbst bereichert, und zwar auf Kosten der anderen.
Vieles von dem, was wir als „Ökonomie“ ausgeben und praktizieren, ist nicht viel mehr als eine etwas ausgefeiltere Chrematistik. Tatsächlich haben die Aktivitäten, die die höchste Rendite abwerfen, wenig oder gar keinen Wert (sie erhalten oder fördern das Leben nicht, ja sie können es sogar zerstören), während Tätigkeiten, die wirklich produktiv sind – Kindererziehung, Produktion von Lebensmitteln, Naturschutz – wenig Geld einbringen. Deshalb ist in unseren Augen der Investmentbanker mehr „wert“ als die Bäuerin, die sich abmüht, den Boden und ihre Familie zu ernähren. Vandana Shiva schreibt:
„Der Gipfel des Reduktionismus wird dann erzielt, wenn der Zugriff auf die Natur mit einer Auffassung von Wirtschaftsaktivität konfrontiert wird, deren Ziel nur mehr das Cash ist. Dann verschwindet das Leben als Organisationsprinzip für Wirtschaftsbelange völlig. Das Geld aber – und das wirft das eigentliche Problem auf – ‚verhält‘ sich asymmetrisch zum Leben und zu den Lebensprozessen: Manipulation, Ausbeutung und Destruktion von Leben in der Natur können in der Tat Quelle von Reichtum sein, niemals jedoch zur Quelle von Leben für die Natur und ihr lebenstützendes Potenzial werden. Diese Asymmetrie ist dafür verantwortlich, dass sich die ökologischen Krisen verschärfen und dass das lebenspendende Potenzial der Natur abnimmt, weil mit wachsender Kapitalakkumulation und der Verbreitung von ‚Entwicklung‘ ein Prozess in Gang kommt, bei dem die Währung ‚Leben‘ durch die Währung ‚Cash und Profite‘ ersetzt wird.“ (1989 a, 37)
David Korten sagt, in unserer Zeit habe das Geld das Leben kolonisiert. Das ist ein treffender Satz. In ähnlicher Weise hat vor mehr als fünfzig Jahren der große Wirtschafshistoriker Karl Polanyi davor gewarnt, dass „der Begriff Gewinn“ die Oberhand über den gesellschaftlichen (und wir können hinzufügen: auch den ökologischen) Bezugsrahmen erlangen könnte, sodass die Gesellschaft (und die umfassendere planetarische Gemeinschaft) ein bloßes „Anhängsel des Wirtschafssystems“ würde. Er warnte davor, dass die „Selbstregulierung des Marktes“ nicht länger bestehen könne, „ohne die humane und natürliche Substanz der Gesellschaft selbst zu vernichten“, wenn die Gesetze des Handels (oder genauer gesagt; der Chrematistik) den Vorrang vor den Gesetzen der Natur und den Gesetzen Gottes erhielten (zitiert bei Athanasiou 1996, 197).
Monokultur des Geistes
Das krankhafte System, das den Planeten beherrscht, scheint in der Tat die Menschen und andere Lebenszusammenhänge in bloße „Anhängsel des Wirtschafssystems“ zu verwandeln. Auf diese Weise setzt es eine Kultur (oder besser gesagt die Karikatur einer solchen) durch, die lokale Kulturen und lokales Wissen zerstört, dadurch die Menschheit insgesamt ärmer macht und unser eigenes Überleben als Art gefährdet. Vandana Shiva betont, dass diese „globale Kultur“, die der Welt durch den Kapitalismus der Konzernherrschaft aufgezwungen wird, sich in gewisser Weise als allgemein gültig darstellt, obwohl sie in Wirklichkeit das Produkt einer partikulären Kultur ist (die in Nordamerika und Europa ihren Ursprung hat). „Sie ist lediglich die globalisierte Version einer lokal sehr begrenzten und geistig provinziellen Tradition.“ (Shiva 1993, 9)
Diese sogenannte globale Kultur, die durch die Werbung, die Massenmedien und ein okzidental geprägtes Bildungssystem so erfolgreich verbreitet wird, tendiert dazu, überhaupt zu leugnen, dass es lokales Wissen und traditionelle Weisheit gibt, bestreitet deren Daseinsberechtigung oder erklärt sie schlicht als nicht existent. Im besten Fall integriert die sich weltweit durchsetzende Kultur einige symbolische Elemente wie Musik, Kleidung oder Kunst aus nichtwestlichen Kulturen. Doch das Wesen und die Werte dieser Kulturen werden weitgehend nicht zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig lässt die globalisierte Kultur „Alternativen verschwinden, indem sie die Wirklichkeit austilgt und zerstört, welche sie darzustellen versuchen. Die Einförmigkeit des herrschenden Wissens dringt durch die Bruchlinien ein. Zusammen mit der Welt, auf die sie sich beziehen, werden diese Alternativen dem Untergang preisgegeben. So erzeugt das herrschende wissenschaftliche Denken eine Monokultur des Geistes, indem es den Raum für Alternativen verschwinden lässt.“ (Shiva 1993, 12)
Das Wissen aufspalten und monopolisieren
Eine Weise, wie Wissen aufgespalten und zerstört wird, ist ironischerweise die massenhafte Verbreitung von Information, die vielfach nur von geringem Wert ist. Das durchschnittliche amerikanische Kind sieht sich dreißigtausend Werbespots an, bevor es den ersten Schulabschluss macht, und Teenager verbringen mehr Zeit damit, sich von kommerziellem Fernsehen einlullen zu lassen, als sie in der Schule zubringen (Swimme 1996). Eine solche langfristige und ständige Gehirnwäsche, die schon früh beginnt, kann unseren Blickwinkel nur einengen und uns dazu abrichten, die herrschende (Un-)Ordnung als Normalität zu betrachten. Es ist zum Beispiel kaum zu glauben, dass ein durchschnittlicher US-Bürger mehr als tausend Firmenlogos, aber nicht einmal zehn Tier- und Pflanzenarten aus seiner Region kennt (Orr 1999). Die herrschende Monokultur stopft uns mit „irrelevanter“ Information voll, hält uns aber oft davon ab, echtes Wissen zu erwerben.
Gleichzeitig tendiert das Medium Fernsehen von sich aus dazu, Wissen in einzelne isolierte Bruchstücke von Information aufzuspalten. Die Fernsehnachrichten, die sich hauptsächlich aus kurzen „Soundelementen“ zusammensetzen, bringen uns bei, mit komplexen Themen so umzugehen, dass wir sie zunächst in Bruchstücke zerlegen, die losgelöst von jeglichem einheitsstiftenden Bezugsrahmen oder irgendeiner Hintergrundanalyse sind. Fernsehprogramme, die zwischen dreißig und sechzig Minuten lang sind, beschäftigen sich in der Regel auch mit einfachen Fragen (wenn sie überhaupt irgendwelche Fragen thematisieren!), die schnell „gelöst“ werden können. Auf diese Weise vermeiden sie weitgehend komplexe Themen. Doch diese Art von den Geist abstumpfender Unterhaltung entfremdet die Menschen oft von traditionellen kulturellen Tätigkeiten wie Geschichten erzählen, miteinander reden, Musik, Kunst und Tanz.
Dieser gesamte Prozess erinnert an die Worte von T.S. Eliot:
„Wo ist die Weisheit, die uns im Wissen abhanden kam?
Wo ist das Wissen, das wir mit der Information verloren haben?
Dem könnten wir sogar noch eine dritte Zeile hinzufügen:
Wo ist die Information, die wir in der Zerstreuung verloren haben?
Die globalisierte Kultur streckt ihre Fangarme aus und versucht dabei alles an traditionellem Wissen an sich zu reißen und zu monopolisieren, was sich als profitabel erweisen könnte. Das kann man überdeutlich am Bestreben der transnationalen Konzerne erkennen, das Leben selbst zu patentieren. Die Welthandelsorganisation öffnete dafür die Tore, als sie den Patentschutz für Samen und genetisches Material zuzulassen begann. Vandana Shiva schreibt, dass zwei US-amerikanische Konzerne das ausgenutzt haben, um Patente für Basmati-Reis und Neem – ein natürliches Pestizid und Funghizid – einzureichen. Beide Pflanzen wurden seit Jahrhunderten von indischen Bauerngemeinden kultiviert.16 Diese Art von „Biopiraterie“ wird zur Normalität. Es hat sogar Versuche gegeben, Gene einer autochthonen Bevölkerung patentieren zu lassen. Dass dieser Wahnsinn innerhalb der (Un-)Ordnung, die derzeit den Planeten beherrscht, als folgerichtig angesehen werden kann, ist ein klarer Beweis für den krankhaften Charakter, der ihr zutiefst eingeschrieben ist.
Zerstörung der Vielfalt
Die „Monokultur des Geistes“ breitet sich aus und vernichtet dabei andere Kulturen, Sprachen und Wissenssysteme wie ein Krebsgeschwür. Genauso wie die einheimischen Pflanzen- und Tierarten aussterben und durch einige wenige, wirtschaftlich nützliche Varianten ersetzt werden, so verschwinden auch ganze Kultursysteme. Viele von ihnen haben sich innerhalb von Tausenden von Jahren entwickelt und sind einzigartig an ein bestimmtes Ökosystem angepasst. Das trifft besonders auf die autochthonen Kulturen zu. Jeder Verlust einer Kultur bedeutet den Verlust an Vielfalt, den Verlust am wahren Reichtum der Erde. So wie die Vernichtung einer Pflanzenart im Regenwald den Verlust eines Heilmittels gegen Krebs oder einer wertvollen Nahrungsquelle bedeuten kann, so bedeutet auch die Zerstörung von einzelnen Mosaiksteinen des weltweiten kulturellen Gesamtbildes eine Minderung der Schönheit und des Geheimnisses des Lebens selbst. Das ist etwas, das niemals zutreffend gemessen oder quantitativ zum Ausdruck gebracht werden kann.
Ein besonderes Beispiel dafür ist der Rückgang der in der Welt gesprochenen Sprachen. Die Sprache ist in vieler Hinsicht ein zentraler Aspekt der Kultur, denn sie bewahrt in sich einzigartige Weisen zu denken auf. Der Verlust einer jeden einzelnen Sprache bedeutet also den Verlust einer einzigartigen Perspektive, einer einzigartigen Weise, die Welt zu verstehen. Vor etwa zehntausend Jahren, so schätzen Sprachwissenschaftler, gab es zwölftausend Sprachen, die von den damals lebenden fünf bis zehn Millionen Menschen auf der Welt gesprochen wurden. Heute sind davon nur noch siebentausend übrig, obwohl die Weltbevölkerung auf über sechs Milliarden angestiegen ist. Gleichzeitig hat sich der Verlust an Sprachen beschleunigt, insbesondere im Lauf des letzten Jahrhunderts. Zurzeit verlieren wir etwa eine Sprache am Tag. Bei dieser Verlustrate wird es in hundert Jahren nur noch 2500 Sprachen geben. Andere Fachleute sind sogar noch weniger optimistisch und nehmen an, dass bis zum Jahr 2100 90 % der noch verbliebenen Sprachen verschwunden sein werden (Worldwatch Institute 2007).
In seinem Werk über den Aufstieg und Fall der Weltzivilisationen schrieb der Kulturhistoriker Arnold Toynbee, dass eine Zivilisation, die sich im Abstieg befindet, zu immer größerer Uniformität und immer mehr Standardisierung neigt. Wie gesunde Ökosysteme ermöglicht auch eine gesunde Zivilisation eine Vielfalt von Kulturen und Wissensformen. Uniformität ist ein Anzeichen für Stagnation und Verfall (Korten 1995).
Die immer größere Gleichförmigkeit der sich global ausbreitenden Kultur ist eine Begleiterscheinung der zunehmend vereinheitlichten Weltwirtschaft. In seinem Buch The Economy of Commerce vergleicht Paul Hawken (1993) unsere derzeitige Weltwirtschaft mit der ersten Ausbreitung von Unkraut. Auf Feldern, die gerade erst abgeerntet worden sind, wachsen die Pflanzen um die Wette, um den Boden so schnell wie möglich zu bedecken. Es wird viel Energie vergeudet, und die Artenvielfalt ist gering. Die Pflanzen, die man in solchen Biotopen findet, sind im Allgemeinen nicht sehr nützlich für andere Arten, auch nicht für die Menschen. Im Gegensatz dazu weisen die Ökosysteme mit der größten Artenvielfalt das größte Entwicklungspotenzial auf, wie zum Beispiel alte Waldbestände und Korallenriffe. In ähnlicher Weise vernachlässigt unsere Weltwirtschaft in ihrem wahnhaften Drang nach ungezügeltem Wachstum und nach Ausdehnung andere, wichtigere Eigenschaften wie etwa Komplexität, Kooperation, Bewahrung und Vielfalt. Es ist ein unreifes System.
Analog dazu kann man dies auch auf das Wachstum einer globalen Monokultur anwenden. Letztlich stellt der Verlust der kulturellen Vielfalt für die Gemeinschaft der Menschen ebenso eine Bedrohung dar, wie der Verlust der Vielfalt an Ökosystemen unseren Planeten insgesamt gefährdet. Wir ersetzen ein vielfältiges „Ökosystem von Kulturen“ durch eine Monokultur, die sich wie Unkraut verhält, rasch wächst, doch von geringem Nutzen ist. Schlimmer noch: Die sich ausbreitende Unkrautkultur enthält ein tödliches Gen, genauso wie eine gentechnisch veränderte Baumwollart das Pestizid Bt produziert, und damit wird es in vieler Hinsicht zum Gegenspieler des Lebens selbst.
Macht als Herrschaft
Im Zentrum der globalen Krankheit, die die Welt befallen hat, steht eine Auffassung von Macht als Herrschaft. Um sich auf der ganzen Welt durchzusetzen, hat der Kapitalismus (und sein Vorläufer, der Merkantilismus) Zwang ausgeübt, zunächst in Form des Kolonialismus. Zwischen 1500 und 1800 eroberten oder unterwarfen europäische Mächte den Großteil der Welt ihrer Herrschaft. Ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts jedoch begannen sich die Menschen in den betreffenden Regionen gegen diese Herrschaft aufzulehnen. Dieser Prozess nahm vor allem in Lateinamerika seinen Anfang. Während die hauptsächlich von der Mittelklasse getragenen Unabhängigkeitsbewegungen selten bedeutende Veränderungen für die ärmsten Bevölkerungsschichten bewirkten, zwangen diese Kämpfe die Hegemonialmächte dazu, ihre Strategie zu ändern. Gegen Ende der 1960er-Jahre war der traditionelle Kolonialismus, der sich auf direkte politische Gewalt stützte, fast vollständig von einem wirtschaftlichen Neokolonialismus ersetzt worden. In den letzten Jahren haben transnationale Konzerne (in Zusammenarbeit mit den Ländern, die ihnen politisch als Handlanger dienen) ihre Kontrolle ausgedehnt: zuerst mithilfe der Strukturanpassungsmaßnahmen und in jüngerer Zeit durch einen „liberalisierten“ Handel und Investitionsabkommen, die die Kontrolle durch die Einheimischen und die Souveränität der Bürger zunichte machen, aber gleichzeitig die Rechte der ausbeutenden wirtschaftlichen Kräfte, insbesondere der großen Konzerne, garantieren.
Diese wirtschaftlichen Waffen sind wirksame Herrschaftsinstrumente, doch sie werden auch durch die Drohung mit Waffengewalt gestärkt. Militärausgaben verschlingen immer noch einen großen Teil der weltweiten Ressourcen. Dem SIPRI (Stockholmer internationales Friedensforschungsinstitut) zufolge haben die Regierungen der Welt im Jahr 2007 1,3 Billionen US-Dollar (das entspricht 2,5 % des weltweiten BIP) zur Unterstützung des Militärs ausgegeben. Was vielleicht noch wichtiger ist: Viele der intelligentesten und talentiertesten Köpfe der Welt sind immer noch mit militärischer Forschung befasst. Was könnte alles passieren, wenn man diese Ressourcen zur Lösung der dringendsten Probleme der Welt einsetzen würde! Der Krieg zerstört ebenfalls nach wie vor Leben und Gemeinschaften, besonders in internen Konflikten, die oft mit den Problemen der Armut, der Ressourcenknappheit und den Interessen großer Konzerne zusammenhängen. Auch die Bedrohung durch Atomwaffen ist nach wie vor sehr real. Es gibt auf der Welt immer noch etwa 12.000 nukleare Sprengköpfe. Das ist genug, um die Erde mehrfach zu zerstören.
Für viele Menschen auf der Welt stellen Krieg und militärische Unterdrückung also reale und aktuelle Bedrohungen dar. In den letzten Jahren ist das im Zuge der Konflikte, repressiven Taktiken und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Krieg gegen den Terror immer klarer geworden. Eine Person oder eine Gruppe mit dem Etikett „Terrorist“ zu versehen kommt immer mehr einer Lizenz für Gefangennahme auf unbestimmte Zeit, Folter und sogar Ermordung gleich.
In einem allgemeineren Sinne beherrschen militärische Metaphern weiterhin den gesamten Krankheitszustand des Planeten. Wir denken eher in Kategorien wie „eine Krankheit besiegen“ und nicht „das Wohlbefinden fördern“; wir sprechen vom „Überleben der an besten Angepassten“ oder sogar vom „Zerstöre oder werde zerstört“ und nicht so sehr von Kooperation und gegenseitiger Hilfe zum Überleben. Wir sehen Herrschaft als etwas irgendwie Natürliches oder Unvermeidliches an, ob es nun um die Herrschaft der Reichen über die Armen, der Männer über die Frauen, eines Landes über ein anderes oder der Menschen über die Natur geht.
Vielleicht ist es deshalb nicht überraschend, dass die Menschen nun versuchen, mittels Genmanipulation den Prozess des Lebens selbst zu beherrschen. Andere Techniken könnten die Herrschaftsgewalt noch vergrößern, insbesondere Roboter und die Nanotechnologie. Letztere könnte sich selbst reproduzierende Maschinen hervorbringen, die nur wenig größer als ein Molekül sind und lebende Organismen nachahmen. Bill Joy warnt davor, dass all diese Technologien das Potenzial in sich tragen, Schaden in einem unvorhergesehenen Ausmaß anzurichten. Im Gegensatz zu nuklearen Sprengköpfen benötigt man für diese Technologien keine Ausgangsmaterialien, die schwer zu beschaffen wären. Und sie können sich alle selbst reproduzieren. Schließlich werden sie alle von großen Konzernen entwickelt, und die Regierungen der Länder üben dabei kaum Kontrolle aus. Deshalb sind sie weit von einer Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit entfernt.
Die Gefahr, die von diesen neuen Technologien ausgeht, ist sehr real. Gene aus gentechnisch veränderten Feldfrüchten haben sich bereits auf andere Pflanzen, ja sogar andere Arten übertragen. Mikroskopische „Nano-Einheiten“ könnten sich selbst reproduzieren und damit zum Beispiel die Möglichkeit eröffnen, dass Mikromaschinen geschaffen werden könnten, die die Erde bedecken, aufzehren und sie so in Staub verwandeln oder die systematisch für das Leben auf dem Planeten wesentliche Bakterien vernichten. Wenn die künstliche Intelligenz weitere Fortschritte macht, dann könnten sich auch Roboter selbst reproduzieren und in Zukunft die Menschen ersetzen.
Auf den ersten Blick kommen einem solche Zukunftsszenarien wie reine Science-Fiction vor. Doch es gibt gute Gründe für die Annahme, dass diese Technologien noch zu Lebzeiten von vielen von uns Wirklichkeit werden. Und der Geist der Gentechnik ist bereits aus der Flasche entwichen. Joy stellt fest:
„Die neuen Büchsen der Pandora der Gentechnik, der Nanotechnologie und der Roboter sind fast geöffnet, doch wir scheinen es kaum bemerkt zu haben […]. Wir werden in dieses neue Jahrhundert ohne Plan, ohne Kontrolle und ohne Bremsen hineingeschleudert. Sind wir bereits zu weit gegangen, um die Richtung noch zu ändern? Ich glaube nicht, aber wir haben es noch nicht versucht, und die letzte Chance, die Kontrolle zu erlangen, die letzte Sicherheitsschleuse, kommt rasch näher. Wir haben bereits unsere ersten Roboter als Haustiere, es gibt im Handel zu erwerbende Techniken der Genmanipulation und die Nanotechnologien entwickeln sich rasch. Während die Entwicklung dieser Technologien durch eine Reihe von kleinen Schritten voranschreitet, […] kann der Durchbruch zur Selbstreproduktion der Roboter, der Genmanipulation oder der Nanotechnologie plötzlich kommen und dasselbe Gefühl der Überraschung auslösen, das wir hatten, als wir vom ersten geklonten Säugetier erfuhren.“ (Joy 2000; http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html)
Die Kräfte der Menschen scheinen viel schneller zuzunehmen als ihre Weisheit. Joy glaubt daran, dass es immer noch Gründe zur Hoffnung gibt. Er macht darauf aufmerksam, dass die Menschheit in der Lage war, auf chemische und biologische Waffen zu verzichten, weil sie dessen gewahr wurde, dass sie einfach zu schrecklich und zu zerstörerisch sind, um jemals zum Einsatz zu kommen. Können wir auch auf das Wissen und die Macht verzichten, die mit diesen neuen Technologien verbunden sind, oder können wir zumindest im Sinne des Vorsorgeprinzips strenge Sicherheitsauflagen für sie verhängen? Letztlich wird dies vielleicht davon abhängen, ob die Menschheit – und insbesondere diejenigen, die innerhalb des über unseren Planeten herrschenden krankhaften Systems den meisten Einfluss haben ‒, bereit ist, sich vom Streben nach immer mehr Macht, Kontrolle und Herrschaft abzuwenden.
Von der Krankheit zur Gesundheit
Ist es wirklich möglich, den pathologischen Kurs zu ändern und stattdessen einen Weg einzuschlagen, der zu Genesung und Leben führt? Auf den ersten Blick erscheinen allein das Ausmaß und die offensichtliche Macht der globalen (Un-)Ordnung als schier unüberwindlich. Darüber hinaus bringen uns der Wahnsinn und die grundlegende Irrationalität dieser „Ordnung“ dazu, eine solche Möglichkeit zu leugnen (Wie könnte dies denn tatsächlich geschehen?) oder zu verzweifeln (Wie kann dies je aufgehalten werden?).
Paradoxerweise aber könnte gerade diese Irrationalität ein Zeichen der Hoffnung sein. Die weltweit herrschenden wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Systeme versuchen uns ständig davon zu überzeugen, dass diese Art von „Globalisierung“ auf der Basis „freier Märkte“, von Finanzspekulation, Deregulierung, Konzernherrschaft und grenzenlosem Wachstum in gewissem Sinne unvermeidlich ist. Es gibt keinen anderen Weg. Wir mögen kleinere Kurskorrekturen vornehmen können, doch ein grundsätzlicher Richtungswechsel ist unmöglich. Doch ein System, das so krankhaft und irrational ist wie die gegenwärtige (Un-)Ordnung, ist eindeutig nicht alternativlos. Es ist ein künstliches und der Logik widerstrebendes Konstrukt, das sich im Widerspruch zu Milliarden von Jahren der Entwicklung des Kosmos und der Erde befindet.
Zugrunde liegende Annahmen und Überzeugungen
„Wenn sich die Menschen als Einzelwesen der Forderung ihrer elementaren Triebe unterwerfen, also den Schmerz vermeiden und nur nach eigener Befriedigung trachten, dann wird sich für die Allgemeinheit ein Zustand der Unsicherheit, der Furcht und des gemeinsamen Elends ergeben.“ (Einstein 1952, 21)
Um dies deutlicher zu sehen, wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um die zugrunde liegenden Annahmen und Überzeugungen näher anzuschauen, die die gegenwärtige Krankheit der Welt zuinnerst prägen. Dann wollen wir sie mit dem konfrontieren, was wir „ökologischen Hausverstand“ oder auch eine Denkweise nennen könnten, die die Weisheit des Tao zum Ausdruck bringt.
Zunächst ist das herrschende System besessen von der Idee des quantitativen, undifferenzierten und grenzenlosen „Wachstums“, wie es im Zerrspiegel des BIP erscheint. Ein wachsender „Durchsatz“ (die Rate des Ressourcenverbrauchs) wird als ein Zeichen von Gesundheit betrachtet, selbst dann, wenn dabei die Natur ausgeplündert wird und die Armut sich im Prozess der Fehlentwicklung verschärft. Gleichzeitig versucht eine von Monokultur geprägte Mentalität eine einzige Kultur und ein einziges Wirtschaftsmodell auf dem ganzen Planeten durchzusetzen. Das Ergebnis sind unreife „Unkraut“-Gesellschaften mit einem hohen Energieverbrauch und einer geringen Artenvielfalt.
Im Gegensatz dazu weisen gesunde Ökosysteme viel stabilere Eigenschaften auf. Sie sind das, was Herman Daly „Ökonomien des stabilen Gleichgewichts“ („steady state economies“) nennt. Das heißt nicht, dass keine Veränderung möglich oder nicht wünschenswert wäre; alle Ökosysteme entwickeln sich im Laufe der Zeit. Doch die Veränderung ist in erster Linie qualitativer Natur, sie besteht in einem Wachstum an Vielfalt, die tatsächlich zu einer noch größeren Stabilität des Systems durch die Zeit hindurch führt. Des Weiteren gibt es eine Fülle verschiedener Ökosysteme, von denen jedes in einzigartiger Weise an ein bestimmtes Klima und eine bestimmte geografische Region angepasst ist. Das Tao ist in der Vielfalt, der Ausdifferenzierung und der Stabilität zu finden, nicht in einer krebsartigen Wucherung einer Monokultur.
Zweitens räumt die herrschende globale (Un-)Ordnung dem Begriff „Gewinn“ oder Profit um jeden Preis den Vorrang ein. Das System ist auf einen kurzfristigen Gewinn fixiert und stellt diesen über langfristige Nachhaltigkeit. Seine Priorität ist der Profit für wenige zulasten der vielen. Oftmals sind die Aktivitäten, die den größten „Profit“ hervorbringen, gleichzeitig auch diejenigen, die die Lebensqualität untergraben. Und umgekehrt werden Tätigkeiten, die das Leben tatsächlich dauerhaft erhalten und fördern, als „unwirtschaftlich“ betrachtet. „Gewinn“ wird nur ausgehend von finanziellen Kategorien definiert. Das Geld wird als „der einzige Maßstab für Wert und Reichtum“ aufgefasst, selbst wenn die Qualität und Vielfalt des Lebens im Zuge der Akkumulation leblosen Kapitals untergraben wird.
Vom Standpunkt der Ökosysteme aus gesehen ist Geld schlicht und einfach eine Abstraktion, die geschaffen wurde, um den Tausch zu erleichtern. Es hat keinen Wert an sich. (Was wäre denn der Wert des Geldes, wenn keine gesunde Nahrung, keine saubere Luft und kein sauberes Wasser mehr übrig wären, die man kaufen könnte?) Lediglich die Gesundheit und Vielfalt des Netzes des Lebens selbst haben einen realen Wert. Tätigkeiten, die dies untergraben – dazu gehört die Zerstörung von Leben um der Kapitalakkumulation willen ‒, sind ein Übel und keineswegs gut. Jede Tätigkeit wird letztlich an ihrem langfristigen, dauerhaften Wert gemessen. Ein kurzfristiger Gewinn auf Kosten eines langfristigen Wohlbefindens ist überhaupt kein Gewinn, ganz im Gegenteil: Er stellt einen Verlust dar. Das Tao aber hegt Wertschätzung für das Leben und schaut auf das, was für die siebte Generation – und darüber hinaus – gut ist.
Drittens sorgt die (Un-)Ordnung des herrschenden Systems dafür, dass sich Macht und Reichtum in den Händen der Konzerne als „Super-Personen“ konzentrieren. Das sind künstliche Gebilde, die sich der Verantwortung gegenüber der umfassenderen Gemeinschaft entziehen, innerhalb derer sie tätig sind. Macht wird grundsätzlich als Herrschaft verstanden und entsprechend ausgeübt. Der Wettbewerb wird als der Motor von Veränderung und Fortschritt betrachtet (auch wenn große Konzerne zugleich versuchen, den Wettbewerb dadurch zu verhindern, dass sie Märkte und Macht monopolisieren).
Vom Standpunkt der Ökosysteme aus betrachtet, dient der Reichtum dann am besten der Gemeinschaft, wenn er so umfassend wie möglich geteilt wird. Die Macht wird so dezentralisiert; in einem gesunden Ökosystem dominiert keine der einzelnen Arten. Es gibt sehr wohl die Dynamik des Wettbewerbs, doch grundlegender als dieser sind das Zusammenwirken und die wechselseitige Abhängigkeit voneinander. Vom Gesichtspunkt der Ökosysteme betrachtet, ist eine Art, die sich über ihre natürlichen Schranken hinaus auszubreiten beginnt, krank und Krebszellen in einem Körper zu vergleichen. Arten, die ihre jeweilige ökologische Nische über vernünftige Grenzen hinaus erweitern, werden zwangsläufig ihre Nahrungsgrundlage aufzehren und so einen Zusammenbruch der Population herbeiführen. Das Tao achtet auf das Gleichgewicht und die wechselseitige Abhängigkeit, die es allen Arten und allen Menschen ermöglicht, in Harmonie miteinander zu leben.
Ökologisch gesehen hat also die (Un-)Ordnung, die unseren Planeten zurzeit beherrscht, nichts Logisches oder Natürliches an sich. Sie befindet sich ganz und gar nicht mit dem Tao im Einklang. In ähnlicher Weise scheint das herrschende System auch unter dem Gesichtspunkt einer menschlichen Ethik oder menschlicher Werte irrational zu sein. David Korten (1995) fasst einige der Grundannahmen über das Verhalten der Menschen zusammen, die in der derzeit herrschenden Ideologie enthalten sind:
1 1. Menschen werden grundsätzlich von Gier und Eigeninteresse angetrieben, die sich insbesondere im Wunsch nach finanziellem Gewinn ausdrücken.
2 2. Der Fortschritt und der Wohlstand des Menschen werden am besten am Maßstab wachsenden Konsums gemessen. Das bedeutet, dass wir unser Menschsein im Erwerbsstreben verwirklichen.
3 3. Konkurrenzverhalten (und damit der Wunsch, andere zu beherrschen) ist für die Gesellschaft vorteilhafter als Kooperation.
4 4. Die Tätigkeiten, welche den größten finanziellen Ertrag bringen, sind für die Gesellschaft – und die umfassendere Gemeinschaft des Lebens als ganzer – am nützlichsten. Gier und Erwerbsstreben werden letztlich zu einer optimalen Welt führen. (Korten 1995, 70–71)
In dieser deutlichen und unverhohlenen Form würden in der Tat nur wenige Menschen diesen Grundannahmen zustimmen. Sie stehen bestimmt im Widerspruch zu fast jeder Religion und Philosophie innerhalb der Tradition der Menschheit. Das Tao Te King etwa hält fest:
„Diejenigen, die erkennen, dass sie genug haben,
sind wirklich reich.“ (§ 53)
Selbst Adam Smith, der gemeinhin als der Leitstern für Kapitalismus und „freie Marktwirtschaft“ gilt, hätte dieser Karikatur eines Wertesystems heftig widersprochen. Smith hielt Sympathie (oder Mitleid), und keineswegs Wettbewerb oder Gier für die wesentliche Eigenschaft der Menschheit. Tugend umfasst seiner Definition zufolge drei Elemente: Anstand, Klugheit (ein berechtigtes Streben nach Eigeninteresse) und Wohltätigkeit (das Glück anderer befördern) (Saul 1995, 159).
Eine neue Perspektive einnehmen
Wie können wir aus diesem verzerrten Koordinatensystem ausbrechen, das unsere Werte in Antiwerte verkehrt? Und wie können wir praktisch den Übergang von unserem System, das auf Chrematistik, Monokultur und Herrschaft beruht, zu einer oikonomia schaffen, das heißt einer Art, sich um den Haushalt der Erde, unserer Heimat, zu kümmern? Wie kann es uns gelingen, eine Welt zu schaffen, in der die Menschheit innerhalb der ökologischen Schranken des Planeten lebt und gleichzeitig die ungeheuren Ungerechtigkeiten zwischen Arm und Reich beseitigt?
Wenn wir uns diese Fragen stellen, ist es hilfreich, sich darauf zu besinnen, dass die herrschende globale (Un-)Ordnung in keinerlei Hinsicht völlig den Sieg errungen hat. Immer noch gibt es auf der Welt eine große kulturelle Vielfalt. Und es gibt überall auf der Welt eine Menge Widerstandsnester gegen die gleichmacherischen Trends. Es gibt sie, und sie wehren sich nach wie vor. Das gilt in besonderer Weise für diejenigen, die vom herrschenden System am meisten ausgegrenzt und unterdrückt werden: die Frauen, indigene Völker und Menschen, die innerhalb von Subsistenzwirtschaften leben. Doch selbst für Bereiche nahe am „Zentrum“ der herrschenden Macht gilt dies. Allenthalben gibt es Gemeinschaften, die nach Alternativen zur sich weltweit durchsetzenden Wirtschaft und Kultur suchen. Überall bilden sich Bewegungen heraus, die sich der Durchsetzung des Hegemonialsystems widersetzen und eine neue Ordnung auf der Grundlage von Gleichheit, Gerechtigkeit, Stärkung der eigenen Fähigkeiten und ökologischer Gesundheit schaffen wollen. Überall gibt es Menschen und Organisationen, die eine innovative Politik und schöpferische Technologien entwerfen. Nichts an der derzeitigen (Un-)Ordnung ist unvermeidlich: Wir können immer noch einen anderen Weg einschlagen, einen Weg, der uns zur Großen Wende führt, und in der Tat entschließen sich viele Menschen genau dazu.
Korten zufolge haben wir die Wahl zwischen dem, was er „Imperium“ nennt – das derzeit herrschende weltweite Herrschaftssystem oder das, was Macy und Brown als die „Industrielle Wachstumsgesellschaft“ bezeichnen ‒, und der Erdgemeinschaft, das heißt einer Ordnung auf der Grundlage der Prinzipien einer nachhaltigen Gemeinschaft, die für unsere Heimat Sorge trägt, eine wirkliche oikonomia. Der Gegensatz hinsichtlich der Grundannahmen und Werte zwischen den beiden Alternativen kann folgendermaßen (in Anlehnung an Korten 2006, 32) dargestellt werden:
| Imperium (Industrielle Wachstumsgesellschaft) | Erdgemeinschaft (Oikonomia) |
| Das Leben ist feindselig und von Konkurrenz geprägt | Das Leben ist von gegenseitiger Unterstützung und Kooperation geprägt |
| Die Menschen haben Defekte und sind gefährlich | Die Menschen haben viele Möglichkeiten |
| Ordnung durch Hierarchie der Beherrschung | Ordnung durch Partnerschaft |
| Bewähre dich im Konkurrenzkampf oder stirb | Kooperiere und lebe |
| Liebe die Macht | Liebe das Leben |
| Verteidige deine Rechte | Verteidige die Rechte aller/Verantwortung füreinander |
| Das Männliche dominiert | Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern |
Im Gegensatz zur derzeitigen krankhaften Ökonomie, die die finanzielle „Hyper-Ökonomie“ über alles andere stellt und das Nichtmenschliche sowie Subsistenzwirtschaften einfach ignoriert, anerkennt dieses Modell, dass die nichtmenschliche Ökonomie an erster Stelle kommt. Dann kommt die menschliche Tätigkeit, die der Erhaltung des Lebens dient, wie etwa die Kindererziehung und die Subsistenzlandwirtschaft (beides wird gegenwärtig weigehend von Frauen ohne Bezahlung geleistet). Dies wird als die Grundlage für alle weiteren wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen betrachtet. Dann kommt der Beitrag des öffentlichen Sektors und der Sozialökonomie. Dazu gehören viele Tätigkeiten von Volksbewegungen und Nichtregierungsorganisationen. Zum Schluss kommen der private Sektor (dazu zählen Genossenschaften, kleine Unternehmen und auch größere Konzerne) und der Finanzsektor (er soll den anderen Schichten dienen, doch er hat an sich nicht viel Substanz).
Der Grundgedanke dieses Modells ist es, die herrschende Ökonomie vom Kopf auf die Füße zu stellen. Anstelle einer Wirtschaft, die vom Finanzsektor und den Konzernen beherrscht ist und Leben aus den darunter liegenden Schichten saugt, sind der Finanzsektor und das Unternehmertum dazu da, der umfassenderen Gemeinschaft zu dienen. Die Gemeinschaft der Menschen wiederum trägt ihrer Abhängigkeit von der umfassenderen Erdgemeinschaft Rechnung und ist sich dessen bewusst, dass das Ökosystem die Grundlage allen Lebens und aller menschlichen Tätigkeiten ist. Allgemein gesprochen, wird ein ökonomischer Wert daran gemessen, inwiefern eine Tätigkeit zu gesunden Beziehungen und zur Erhaltung des Lebens beiträgt, und nicht am finanziellen Ertrag.
Praktisch gibt es viele Arten von Politik, die uns zu dieser Art einer erneuerten Praxis der oikonomia hinführen können. Die derzeitige Pathologie verstetigt sich selbst weitgehend dadurch, dass sie Tätigkeiten belohnt, die Schaden anrichten und zugleich die wahren Kosten der Zerstörung verschleiern. Es ist nicht schwer, sich politische Maßnahmen vorzustellen, die das Gegenteil bewirken, zum Beispiel:
– Unsere Wirtschaftsindikatoren im Sinne des oben erwähnten „echten Fortschrittsindex“ reformieren, damit der Verbrauch von natürlichem Kapital als Kostenfaktor sichtbar wird und nicht als Einkommen gewertet wird. Gleichzeitig kann man den alternativen Index heranziehen, um den Wert von nichtbezahlten menschlichen Tätigkeiten und den Beitrag des Ökosystems zur Erhaltung des Lebens abzubilden.
– Arbeit und Einkommen weniger besteuern, im Gegenzug aber den Ressourcen“durchsatz“ stärker besteuern. Im Allgemeinen tragen die Arbeiter die Hauptlast der Steuern. „Grüne“ Steuern wären eine viel sinnvollere Alternative. Einerseits sollten Energie, Wasserverbrauch in der Industrie, Verschmutzung, Pestizide und verschwenderische Verpackung besteuert werden, um einen Ansporn zur Erhaltung zu geben und schädliche Produktion zu vermeiden. Auf der anderen Seite sollte erneuerbare Energie, öffentlicher Transport, ökologischer Landbau und Techniken, die der Erhaltung dienen, subventioniert werden, um sie zu fördern. Auch eine geringe Besteuerung von Finanztransaktionen (sie wird oft auch nach dem Wirtschaftswissenschaftler, der diese Idee zuerst äußerte, als Tobin-Steuer bezeichnet) würde die Spekulation in hohem Maß eindämmen und gleichzeitig die finanziellen Mittel bereitstellen, um die Armut zu bekämpfen, Schulden zu streichen und Umweltschäden zu beheben.
– Die Schulden der ärmsten Länder streichen und Wege finden, wie man die Schulden der Länder mit „mittlerem Einkommen“ verringern und tilgen kann. Wie wir gesehen haben, stellen die Verschuldung und die mit ihr einhergehenden Strukturanpassungsmaßnahmen einen entscheidenden Hebel für eine fehlgeleitete Entwicklung dar. Viele der Schulden, um die es hier geht, sind bereits mehrfach wieder zurückgezahlt worden (und viele waren von Anfang an ungerecht oder illegitim). Wenn man bloß Geld von den Militärausgaben abzweigt oder eine Finanztransaktionssteuer einführt, wäre das wahrscheinlich bereits mehr als genug, um die Armen von ihrer Schuldenlast zu befreien.
– Mithilfe einer Reihe von Maßnahmen die Macht der Konzerne beschränken: Spenden von Konzernen an politische Parteien verbieten; die juridische Fiktion beseitigen, derzufolge Konzerne „Personen“ sind, die mit Rechten wie etwa dem der freien Meinungsäußerung und der politischen Teilhabe ausgestattet sind; Aktionäre gesetzlich haftbar machen für die Schäden, die von Konzernen verursacht werden, und auf diese Weise ethisches Investment fördern; Bedingungen definieren, unter denen einem Konzern die Geschäftsgrundlage entzogen werden kann, wenn er etwa wiederholt gegen Umweltgesetze verstößt, Beschäftigte schädigt oder in kriminelle Machenschaften verstrickt ist.
Es fehlt nicht an guten Ideen im Bereich von Politik und Technik, die uns in die Lage versetzen könnten, eine nachhaltige und gerechtere Zukunft zu schaffen. Und es fehlt auch nicht an ökonomischen Ressourcen. Paul Hawken bemerkt:
„Die USA und die damalige UdSSR gaben mehr als zehn Billionen US-Dollar für den Kalten Krieg aus. Das ist genug Geld, um die Infrastruktur der Welt komplett zu ersetzen: jede Schule, jedes Krankenhaus, jede Straße, jedes Gebäude und jeden landwirtschaftlichen Betrieb. Anders ausgedrückt: Wir kauften und verkauften die gesamte Welt, um eine politische Bewegung zu bekämpfen. Jetzt zu behaupten, wir verfügten nicht über die Ressourcen, um eine neue Wirtschaft aufzubauen, ist absurd. Denn die Bedrohungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, werden jetzt schon Realität, während sich die Bedrohungen der nuklearen Pattsituation nach dem Krieg auf die Möglichkeit von Zerstörung bezogen.“ (1993, 58)
Was ist also wirklich nötig, damit die Große Wende stattfinden kann? Wie können wir auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Befreiung der Menschheit und der Erde selbst vorankommen? Wir müssen einen Begriff davon bekommen, dass der jetzige Zustand der Dinge alles andere als unvermeidlich ist, dass er von Grund auf irrational und krankhaft ist. Um dieses Verständnis zu erlangen, müssen wir selbst den ersten Schritt tun. Der nächste Schritt wird dann darin bestehen, den Ursprung einiger Glaubenssätze, Haltungen, Sichtweisen und Praktiken zu verstehen, die dem derzeitigen System zugrunde liegen.
4 Die hier angegebenen Zeiträume des kosmischen Jahrhunderts stützen sich auf die Zeittafel aus dem Buch von Swimme/Berry, Die Autobiographie des Universums (1999), 275–283. Eine jüngere Schätzung geht davon aus, dass der Kosmos vor 13,73 Milliarden Jahren entstand.
5 Entsprechend umfasst ein kosmischer Monat 12,5 Millionen Jahre, ein kosmischer Tag 411.000 Jahre, eine kosmische Stunde etwa 17.000 Jahre, eine kosmische Minute ca. 285 Jahre und eine kosmische Sekunde 4,75 Jahre.
6 Die statistischen Angaben in diesem Abschnitt entstammen mehreren Quellen: Sale 1985; Nickerson 1993; Ayers 1998; Berichte des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2001; des Worldwatch Institute (1991; 1994; 1997; 2000 und 2005); des International Fund for Agricultural Development (2006).
7 Um die Größenordnung dieser Veränderung deutlich zu machen: Die Erde ist jetzt um 5 bis 7 Grad Celsius wärmer als zur Hälfte der letzten Eiszeit.
8 Der Entwicklungsbericht des UNDP (United Nations Development Programme) aus dem Jahr 1992 schätzte, dass die Kluft zwischen den reichsten 20 % und den ärmsten 20 % der Länder dem Verhältnis von 60 : 1 entsprach. Diese Zahlen beruhen auf einem landesweiten Durchschnittswert. Doch wenn man die tatsächlichen individuellen Einkommen betrachtet, entspricht die Kluft einem Verhältnis von 150 : 1 (Athanasiou 1996). Im Jahr 2005 bezifferte das UNDP die Kluft ausgehend vom Durchschnitt der Länder auf 82 : 1. Dies lässt es als wahrscheinlich erscheinen, dass die Kluft bezogen auf die individuellen Realeinkommen einem Verhältnis von 200 : 1 entspricht.
9 Die statistischen Angaben stammen aus Milanovic 1999, 2. Die Verteilung der Einkommen ist seit dem Erstellen dieser Statistik noch ungleicher geworden.
10 Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die systeminhärente Erkrankung, die derzeit unseren Planeten beherrscht, zu benennen. In diesem Buch werden wir hauptsächlich den Ausdruck (Un-)Ordnung benutzen, um ein System oder eine „Ordnung“ zu bezeichnen, das von Grund auf krankhaft ist. Es ist im Wesentlichen ein System, das einer Krankheit wie dem Krebs vergleichbar ist. Andere wie etwa David Korten und einige ökumenische Organisationen beschreiben diese (Un-)Ordnung mit dem Terminus „Imperium“. Korten zum Beispiel definiert Imperium als „die hierarchische Organisation menschlicher Beziehungen auf der Grundlage des Prinzips der Beherrschung. Die Mentalität des Imperiums beinhaltet materiellen Überfluss für die herrschenden Klassen, Verehrung für die beherrschende Kraft von Tod und Gewalt, Verleugnung des weiblichen Prinzips und Unterdrückung der Wahrnehmung des Potenzials menschlicher Reife“ (2006, 20). In ähnlicher Weise definiert der Weltbund der Reformierten Kirchen Imperium als „die Verbindung von wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, geografischen und militärischen imperialen Interessen, Systemen und Netzwerken, die die politische Macht und den wirtschaftlichen Reichtum beherrschen wollen. Es ist bezeichnend für das Imperium, dass es den Fluss von Reichtum und Macht von den verwundbaren Menschen, Gemeinden und Ländern zu den mächtigeren erzwingt oder erleichtert. Heute sprengt das Imperium alle Beschränkungen, es zerstört Identitäten und bildet sie neu, es untergräbt Kulturen, unterwirft Nationen und Staaten und grenzt Religionsgemeinschaften entweder aus oder vereinnahmt sie.“ Ein Vorteil der Benutzung des Ausdrucks „Imperium“ ist es, dass er das gegenwärtige System klar mit einem Gesellschafsmodell in Verbindung bringt, das grob gesprochen vor fünftausend Jahren seinen Anfang nahm und den Einsatz militärischer Gewalt mit einschließt. Andererseits weist die moderne Form des Imperiums spezifische Charakterzüge auf, die bei den meisten, die das Wort hören, nicht immer assoziiert werden. Das trifft insbesondere für seine geradezu besessene Zerstörung der lebenden Systeme der Erde zu. Eine dritte Weise, die Krankheit des Systems zu benennen, ist der Ausdruck „Industrielles Wachstumssystem“. Er stammt vom norwegischen Ökophilosophen Sigmund Kwaloy und betont die Abhängigkeit des Systems von einem stets wachsenden Ressourcenverbrauch ebenso wie eine Mentalität, welche die Erde als „Lagerhaus und Kloake gleichermaßen“ betrachtet. (Macy/Brown 1998). Letztlich haben alle drei Termini ihre Berechtigung, sie ergänzen einander und sind hilfreich. Sie werden mehrmals in diesem Buch benutzt, ebenso wie andere Ausdrücke wie zum Beispiel „globaler Kapitalismus der Konzernherrschaft“.
11 Viele der statistischen Daten in diesem Abschnitt sind entnommen aus Brown 1991 und Sale 1985, wobei Aktualisierungen anhand des Berichts des World Watch Institute von 2007, anhand von Suzuki/McConnel 1997 und weiterer Quellen wie etwa der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO) vorgenommen wurden.
12 Und einigen Schätzungen zufolge beträgt der durchschnittliche ökologische Fußabdruck 3,1 Hektar. Vgl. z. B.: http://www.nationmaster/graph/env_eco-foo-environment-ecological-footprint.
13 Ein älterer, leicht davon abweichender Indikator ist das Bruttonationalprodukt (BNP). Es teilt mit dem BIP grundsätzlich die gleichen Beschränkungen.
14 Die deutsche Übersetzung dieses Buches von Vandana Shiva ist eine gekürzte Fassung. Deshalb finden sich viele Zitate nicht in dieser deutschen Ausgabe und müssen aus dem englischen Original rückübersetzt werden. Die Quellenangabe verweist jeweils auf die deutsche oder englische Fassung (Shiva 1989 a bzw. b); d. Übers.
15 Ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie diese Forderungen wahrhaft groteske Ausmaße annehmen können, findet sich in einem Artikel des venezolanischen Forschers Luis Britto García (1990) in Form eines fiktiven Briefes eines Indiohäuptlings namens Guaicaipuro Cuautémoc an die politischen Lenker Europas. Der Brief zeigt auf: Wenn Europa versuchen würde, den „freundlichen Kredit“ von 185.000 kg Gold und 16 Millionen kg Silber, den es vor mehr als dreihundert Jahren von den amerikanischen Völkern erhalten hat, zu „marktüblichen“ Zinsen zurückzuzahlen, dann würde Europa als erste Abzahlung 185.000 kg Gold und 16 Millionen kg Silber zur 300. Potenz (also hoch 300) schulden. Das kommt einer Zahl gleich, die mehr als 300 Ziffern umfasst, und das Gewicht würde das des Planeten Erde deutlich übertreffen. Die 300. Potenz scheint eine Übertreibung zu sein, doch es stimmt, dass bei einem Zinssatz von 13,5 % die Menge an Gold und Silber, die erforderlich ist, um die Schuld nach 300 Jahren zurückzuzahlen, das Gewicht der Erde übertreffen würde.
16 Glücklicherweise wurde nach einem Rechtsstreit das Patent auf den Neembaum jetzt zurückgewiesen und der Patentanspruch auf Basmati-Reis eingeschränkt. Das ist allerdings weitgehend darauf zurückzuführen, dass diese Beispiele durch viele Publikationen öffentliche Aufmerksamkeit erregten. Leider werden viele solcher Patente der Öffentlichkeit niemals bekannt.