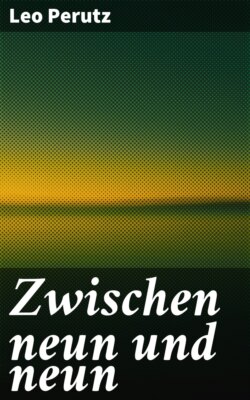Читать книгу Zwischen neun und neun - Leo Perutz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Das »Fräulein« wußte genau, wie gut ihr ihre neue Voilebluse mit den beiden sich kreuzenden roten Libertyspangen zu Gesicht stand. Wenn sie im Park auf der Bank saß und in ihrem Buch las, während der kleine Bub und das Mäderl, die sie spazieren zu führen hatte, mit ihrem Miniaturspritzwagen spielten oder Sand in allerlei kleine Gefäße und Formen füllten, so kam es nur selten vor, daß sie lange allein blieb. Ein oder zwei junge Herren setzten sich bald neben sie (zwei waren ihr gewöhnlich lieber, denn es war so lustig zuzusehen, wie dann einer dem andern im Weg war), taten anfangs überaus gleichgültig, so als ob sie sich aus reinem Zufall oder weil gerade der Platz so hübsch schattig war für diese Bank entschieden hätten, bezeigten ein forciertes Interesse für alles mögliche: für die Spatzen und Tauben, für die Leute, die vorübergingen, oder für ihre eigenen Stiefelspitzen, – bis sie schließlich doch ein Gespräch anknüpften: »Fräulein lesen da sicher etwas sehr Interessantes!« oder: »Zwei reizende Kinder, Ihre beiden kleinen Zöglinge, wie heißt du denn, Mäderl?« Oder die Keckeren unter ihnen: »Sie werden sich Ihre schönen blauen Augen verderben, Fräulein, wenn Sie fortwährend lesen.«
Ernstere Bekanntschaften ergaben sich für das Fräulein aus solchen Anfängen fast niemals, denn die jungen Herren kamen meist schon bei der zweiten Zusammenkunft mit Vorschlägen, Wünschen und Anliegen, die weit über das hinausgingen, worüber ein junges Mädchen aus gutem Hause, – bitte, »Fräuleins« Vater war Oberoffizial bei der Post gewesen und ein Onkel ihrer Mutter war noch heute Sektionsrat im Handelsministerium –, worüber ein junges Mädchen aus gutem Hause also vielleicht nach längerer Bekanntschaft, eventuell, unter Umständen mit sich reden lassen darf. Bei manchen Herren mußte man überhaupt schon nach zwei Minuten das Gespräch abbrechen, solche Reden führten sie, man mußte aufspringen: »Willi! Gretl! Es ist Zeit, daß wir nach Hause gehen!«, und den unverschämten Menschen einfach sitzen lassen. Das kam öfters vor, obwohl das Fräulein durchaus nicht prüde war, sondern im Gegenteil ein gewisses Vergnügen an vorsichtig-andeutenden Gesprächen über schlüpfrig-pikante Themen hatte.
Am liebsten sah sie es, wenn solch eine zwecklose Bekanntschaft in einen Ansichtskartenverkehr überging. Ansichtskarten ließ sich das Fräulein für ihr Leben gern schicken. Die Post, die morgens kam, bedeutete für sie den Höhepunkt des Tages. Oft, ja zumeist waren es Karten mit der Unterschrift eines ihr völlig gleichgültig Gewordenen oder gar Vergessenen, das letzte Echo einer nichtigen, verplauderten halben Stunde. Aber es war so lustig, wenn die Gnädige ärgerlich ins Zimmer kam und auf die Frage ihres Mannes, ob der Briefträger schon dagewesen sei, verdrossen zur Antwort gab: »Ja, aber für uns war nichts, nur für das Fräulein zwei Karten.«
Heute saß kein junger Mann neben dem Fräulein, sondern Frau Buresch, eine ältere Dame, die mit ihren beiden Kindern Tag für Tag den Park besuchte. Man kannte einander. Die Kinder spielten, alle vier zusammen; Frau Buresch und das Fräulein tauschten Bemerkungen über das Wetter aus.
»Hat es sich doch aufgeheitert,« sagte das Fräulein.
»Mir ist lieber, es regnet, als man weiß nicht, wie man dran ist,« meinte Frau Buresch pessimistisch und holte ihre Häkelarbeit hervor.
»Wie ich heut früh aus dem Fenster geschaut hab', hätt' ich geschworen darauf, daß es den ganzen Tag regnen wird, so hat's ausgesehen. Jetzt ist's doch wieder ganz schön geworden, merkwürdig.«
Das Wetterthema war erledigt. Das Fräulein blätterte in ihrem Buch. Frau Buresch häkelte.
»Im Votivpark sollen dieses Jahr Sessel aufgestellt werden statt der Bänke«, erzählte das Fräulein. »Vier Heller pro Person.«
»Alles wird täglich teurer. Ich sag' Ihnen, Fräulein, grau in grau ist das Leben. Was, glauben Sie, kostet heuer ein Kilo ganz gewöhnliches, ausgelassenes –«
Sie verschluckte das ganze Kilo ganz gewöhnlichen ausgelassenen Schweinefetts, das sie auf der Zunge hatte, und verstummte. Ein junger Mann hatte sich zwischen sie und das Fräulein gesetzt. Und wenn sich ein junger Mann neben das Fräulein setzte, dann wollte Frau Buresch um Gottes willen nicht stören. Dann schob sie sich rücksichtsvoll bis an das äußerste Ende der Bank und vertiefte sich in ihre Häkelarbeit.
Stanislaus Demba trug seinen hellbraunen Havelock um die Schultern geworfen und vorne flüchtig zugeknöpft. Die leeren Ärmel hingen schlaff hinunter. Er hatte sich erschöpft auf die Bank niedergelassen, wie einer, der einen weiten Weg hinter sich hat und froh ist, daß er ein paar Minuten lang ausruhen kann.
Erst nach einer Weile schien er zu bemerken, daß seine Nachbarin ein ausnehmend hübsches Mädchen war. Er setzte sich zurecht und schaute ihr aufmerksam ins Gesicht. Er schien zufrieden.
Dann fiel sein Auge auf das Buch, das sie in der Hand hielt.
Dem Fräulein entging der Eindruck, den sie auf ihren Nachbar machte, nicht. Verstohlen hatte auch sie ihn gemustert, ohne dabei von ihrem Buche aufzublicken. Er mißfiel ihr nicht. Freilich, elegant konnte man ihn beim besten Willen nicht nennen, und die gut angezogenen jungen Leute waren ihr eigentlich lieber. Aber dieser junge Mann schien ihr von andrer Art zu sein, als die Leute, mit denen sie sonst verkehrte. Vielleicht gehörte er zur Boheme – dachte sie. – So sieht er aus. Er hat lebhafte Augen und macht den Eindruck eines energischen und klugen Menschen. Wenn man es recht überlegte, so konnte man sich diesen schweren und ungefügen Körper gar nicht in einen feinen, gutgemachten Anzug hineindenken. Er kleidete sich eben, wie es seiner Natur entsprach – stellte das Fräulein fest. Freilich, die Hosen, die über und über mit Kot bespritzt waren, hätte er sich wohl abbürsten können, bevor er sich neben sie setzte. Aber trotzdem! Das Fräulein fand, daß irgend etwas an dem jungen Menschen sie anzog. Sie beschloß, sich seinen Annäherungsversuchen gegenüber, die ja nicht ausbleiben würden, das wußte sie genau, entgegenkommend zu verhalten.
Stanislaus Demba begann das Gespräch in nicht gerade origineller Weise, indem er das Fräulein nach dem Gegenstand ihrer Lektüre fragte. »Das ist ein Ibsen, nicht wahr?«
Das Fräulein war sehr geübt darin, zusammenzufahren, wenn sie angesprochen wurde und dem Fragenden ein erschrockenes, verwirrtes und ein wenig indigniertes Gesicht zuzukehren.
Stanislaus Demba wurde sofort verlegen. »Hab' ich Sie gestört?« fragte er. »Ich wollte Sie nicht stören.«
»Ach nein,« sagte das Fräulein, senkte die Augen und tat, als ob sie weiterlese.
»Ich wollte nur fragen, ob das Buch da nicht ein Ibsenstück ist.«
»Ja. Die Hedda Gabler.«
Stanislaus Demba nickte mit dem Kopf und wußte weiter nichts zu sagen.
Pause. Das Fräulein blickte in ihr Buch, ohne jedoch zu lesen. Sie wartete. Aber Stanislaus Demba schwieg.
Ein bißchen schwerfällig ist er – dachte das Fräulein. Sie kam ihm zu Hilfe. »Sie kennen das Stück?« fragte sie. Jetzt ließ sie das Buch sinken zum Zeichen, daß ihr nicht sonderlich viel am Weiterlesen gelegen sei.
»Ja. Natürlich kenne ich's,« sagte Demba. – Weiter nichts.
Dem Fräulein blieb nichts anderes übrig, als umzublättern und die Lektüre fortzusetzen. War er so ungeschickt? Wußte er nichts weiter zu sagen? Oder bedauerte er am Ende, sie angesprochen zu haben? Mißfielen ihm etwa die beiden kleinen Pockennarben auf ihrer linken Wange? Kaum. Alle Leute fanden gerade diesen kleinen Schönheitsfehler reizend und apart. Nein. Es war nur Unbeholfenheit. Und das Fräulein entschloß sich, ihm eine letzte Chance zu geben. Sie ließ ihren Regenschirm fallen.
Jeder junge Mann, auch der dümmste und ungeschickteste, wird in einem solchen Fall blitzschnell nach dem Schirm greifen und ihn der Dame mit einer eleganten Verbeugung und ein paar liebenswürdigen Redensarten überreichen. Und die Dame bedankt sich vielmals, und ehe man's merkt, ist das Gespräch im Gange.
Aber diesmal geschah etwas Unerhörtes. Etwas, was sich in der Geschichte aller Parkanlagen der Welt niemals vorher ereignet hatte: Stanislaus Demba ließ den Schirm liegen. Er sprang nicht auf, er haschte nicht nach ihm. Nein. Er rührte sich nicht und ließ es zu, daß sich das Fräulein selbst nach dem Schirm bückte.
Aber das Fräulein war seltsamerweise nicht beleidigt. Nein. Gerade das imponierte ihr an Stanislaus Demba, daß er so anders als die anderen vorging. Er verschmähte die abgebrauchten Mittel, mit denen Dutzendmenschen auf Frauen Eindruck zu machen suchen. Er wollte nicht galant erscheinen, er verachtete die hohle Geste billiger Ritterlichkeit. Des Fräuleins Interesse an Demba wuchs. Und vielleicht hätte jetzt sogar sie ihn angesprochen – Frau Buresch häkelte und sah nicht hin –, wenn nicht Demba selbst mit einem Male zu reden begonnen hätte.
»Wenn ich Ihr Vater wäre, Fräulein,« sagte er, »würde ich Ihnen verbieten, Ibsen zu lesen.«
»Wirklich? Aber warum denn? Paßt er denn nicht für junge Mädchen?«
»Weder für Erwachsene noch für junge Mädchen,« erklärte Demba. »Er gibt Ihnen ein falsches Weltbild. Er ist die Marlitt des Nordens.«
»Aber das müssen Sie doch wohl begründen.« Das Fräulein kannte die Art der jungen Leute, denen es nicht darauf ankam, ein paar Größen zu stürzen, wenn sie durch kühne, literarische Behauptungen Interesse für sich erwecken konnten.
»Es würde Sie langweilen. Mich langweilt es auch,« sagte Demba. »Ich müßte Ihnen vor allem erklären, wie wenig und wie Gewöhnliches hinter seinen Symbolen verborgen liegt. Wie alle seine Menschen sich am leeren Klang ihrer Worte berauschen. – Aber lassen wir das, mich langweilen literarische Gespräche. Nur etwas noch: Haben Sie es noch nicht bemerkt? Seine Menschen sind alle geschlechtlos.«
»So? Geschlechtlos?« – Das Fräulein hatte nicht viel von Ibsen gelesen. Mein Gott, man kommt so selten zu einer ruhigen Stunde und zu einem guten Buch. Außer »Hedda Gabler« kannte sie nur noch »Gespenster«. Aber sie verstand es, hauszuhalten mit ihrem Wissen und den Eindruck großer Belesenheit und einer lückenlosen Kenntnis der neueren Literatur hervorzurufen.
»Und der Oswald?« fragte sie. »Finden Sie den etwa auch geschlechtlos?«
»Oswald? Ein verkappter Kandidat der Theologie. Glauben Sie ihm doch den Kuß im Nebenzimmer nicht!« – Stanislaus Demba raffte sich zu einem Witz auf. »Das ist ein Schwindel: Ein Theaterarbeiter ist es, der im Nebenzimmer die Regina küßt, ein Kulissenschieber, der Inspizient vielleicht, aber nicht der Oswald.«
Das Fräulein lachte.
»Übrigens,« fuhr Demba fort und rückte näher an das Fräulein heran, »ist der Kuß ein Betrug an der Natur. Ein Ausweg, von Frauen ersonnen, um den Mann um sein Recht zu prellen.«
»Sie sind aber unbescheiden. Sie gehen wohl gleich aufs Ganze, nicht?« meinte das Fräulein.
»Küssen, Streicheln, Körper an Körper schmiegen,« predigte Stanislaus Demba, »sind nur dazu da, um uns abzulenken von dem einen, das wir der Natur schulden.«
Das Fräulein überlegte, ob es nicht besser sei, aufzustehen und die Unterhaltung zu beenden, die ein wenig schwül zu werden drohte. Aber ihr Nachbar sprach ja vorerst ganz akademisch, reine Theorie alles, und der Gegenstand des Gesprächs behagte ihr im Grund genommen. Sie schielte nach Frau Buresch: die saß und häkelte und hatte sicher kein Wort verstanden, und die Kinder spielten in beruhigender Entfernung.
Aber Demba gab jetzt selbst dem Gespräch eine andere Wendung.
»Ich habe Hunger,« sagte er.
»Wirklich?«
»Ja. Denken Sie. Seit gestern mittag habe ich nichts gegessen.«
»So rufen Sie doch dort das Brezelweib und kaufen Sie sich ein Stück Kuchen.«
»Das sagt sich sehr leicht, aber es ist nicht so einfach,« sagte Demba nachdenklich. »Wieviel Uhr ist es eigentlich?«
»Halb zehn vorüber ist es auf meiner Uhr. Gleich dreiviertel,« sagte das Fräulein.
»Herrgott, da muß ich ja gehen!« Demba sprang auf.
»Wirklich? Das ist schade. Es ist so langweilig, hier allein zu sitzen.«
»Ich habe mich verplaudert,« sagte Demba. »Ich habe viel zu tun. Ich hätte mich eigentlich gar nicht setzen dürfen. Aber ich war todmüde und die Füße schmerzten mich. Und außerdem« – Demba schwang sich zur höchsten Liebenswürdigkeit auf, deren er fähig war –, »ich konnte ja gar nicht an Ihnen vorbeigehen. Ich mußte Sie kennen lernen.«
»Es ist eigentlich schade, daß wir nicht weiterplaudern können.« Das Fräulein wippte leicht mit der Fußspitze und ließ einen zarten Knöchel und den Ansatz eines schlanken, schöngeformten Beines sehen.
Stanislaus Demba starrte wehrlos auf ihren Fuß und blieb sitzen.
»Ich möchte Sie gerne wiedersehen,« sagte er.
»Ich gehe häufig um diese Zeit mit den Kindern spazieren. Freilich, in diesem Park bin ich nicht immer.«
»Und wo sind Sie gewöhnlich?«
»Das ist verschieden. Es hängt von meiner Gnädigen ab. Ich bin Erzieherin.«
»Dann werde ich wieder mal hierher schauen.«
»Wenn Sie es dem Zufall überlassen wollen – aber Sie können mir ja schreiben,« sagte das Fräulein.
»Gut. Dann werde ich Ihnen schreiben.«
»Also notieren Sie sich meine Adresse: Alice Leitner, bei Herrn kaiserlichen Rat Adalbert Füchsel, neunter Bezirk, Maria-Theresien Straße 18. – Warum notieren Sie es nicht?«
»Das merke ich mir auch so.«
»Das ist unmöglich. So eine lange Adresse kann man sich nicht merken. Wiederholen Sie sie doch einmal.«
Stanislaus Demba wußte nur noch Alice und kaiserlicher Rat Füchsel. Alles andere hatte er vergessen.
»Also schreiben Sie sich's auf!« befahl das Fräulein.
»Ich habe weder Bleistift noch Papier,« sagte Demba und verzog ärgerlich das Gesicht.
Das Fräulein holte einen Bleistift aus ihrer Handtasche und riß ein Blatt Papier aus ihrem Notizbuch. »So. Notieren Sie sich's.«
»Ich kann nicht,« versicherte Stanislaus Demba.
»Sie können nicht?« fragte das Fräulein erstaunt.
»Nein. Ich bin leider Analphabet. Ich kann nicht schreiben.«
»Machen Sie doch keine Scherze!«
»Das ist kein Scherz. Es ist eine bekannte statistische Tatsache, daß 0,001‰ der Wiener Bevölkerung aus Analphabeten besteht. Dieses eine Null Ganze, Null, Null eins pro Mille bin ich.«
»Das soll ich Ihnen glauben?«
»Gewiß, Fräulein! Sie haben heute die Ehre –«
Stanislaus Demba verstummte. Ein Windstoß hatte ihm den Hut vom Kopf gerissen und über den Kiesweg auf den Rasen getrieben. Stanislaus Demba sprang auf und machte einige Schritte hinter dem Hut her. Plötzlich blieb er stehen, kehrte sich langsam um und ging auf seinen Platz zurück.
»Dort liegt er,« murmelte er, »und ich kann ihn nicht holen.«
»Sind Sie komisch,« lachte das Fräulein. »Haben Sie vielleicht Angst vor dem Parkwächter?«
»Wenn Sie mir nicht helfen, bleibt er dort liegen.«
»Ja, aber warum denn?«
Stanislaus Demba holte tief Atem.
»Weil ich ein Krüppel bin,« sagte er mit tonloser Stimme. »Es muß heraus. Ich habe keine Arme.«
Das Fräulein sah ihn entsetzt an und brachte kein Wort aus der Kehle.
»Ja,« sagte Stanislaus Demba. »Ich habe beide Arme verloren.«
Das Fräulein ging wortlos in den Rasen und holte den Hut.
»Bitte, setzen Sie mir ihn auf. – Ich bin leider auf fremde Hilfe angewiesen. – So, danke.«
»Ich war Ingenieur,« sagte Demba und ließ sich wieder auf die Bank nieder. »Demba, Ingenieur in den Heurekawerken. Ich war so ungezogen, mich nicht gleich vorzustellen. Kennen Sie die Heurekawerke? Nein! Broterzeugung. Hasenmeyers beliebtes Kornbrot. Haben Sie nie davon gehört?«
»Nein,« flüsterte das Fräulein und schloß die Augen. Jetzt verstand sie manches an ihres Nachbars Benehmen. Sie begriff, warum er ihr vorhin den Schirm nicht aufgehoben hatte, der Arme. Und warum er sich geweigert hatte, ihre Adresse aufzuschreiben.
»In der Dampfmühle ist es mir geschehen. Ich geriet mit beiden Armen in die Mahlmaschine. An einem – nein, es war gar nicht einmal an einem Freitag. An einem ganz gewöhnlichen Donnerstag war's; am zwölften Oktober.«
Mit einem Male bekam das Fräulein eine rasende Angst, daß er auf den Einfall kommen könnte, ihr seine verstümmelten Arme zu zeigen. Zwei kurze, blutunterlaufene Stümpfe – Nein! Sie konnte nicht daran denken. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken.
»Ich muß leider jetzt gehen,« sagte sie leise und schuldbewußt. »Willi! Gretl! Es ist Zeit, daß wir nach Hause gehen.«
Sie warf einen scheuen Blick auf ihren Nachbar. Wie schauerlich die leeren Ärmel herunterhingen. Und sein abgetragener Anzug. Dieser alte Mantel aus billigem Stoff! Alles, was ihr vorher als stolz zur Schau getragene Originalität, als die gewollte Uneleganz des Bohemiens erschienen war, erkannte sie jetzt als das, was es wirklich war: Als mühsam verborgenes Elend.
Und hatte er nicht selbst gestanden, daß er Hunger litt?
»Sind Sie noch in der Fabrik?« fragte sie.
»Wo? In der Fabrik? – Ach so. In den Heurekawerken. – Nein. Wer kann denn einen Krüppel brauchen,« sagte Demba.
Ja. Es war so, wie sie vermutet hatte. Es ging ihm schlecht. – Viel Geld hatte das Fräulein nicht bei sich. Eine Krone fand sich in ihrem Handtäschchen und ein Zehnhellerstück. Die legte sie heimlich neben Stanislaus Demba auf die Bank.
Dann stand sie auf. – Einen Augenblick lang zuckte es in ihr, dem unglücklichen Menschen die Hand zu reichen. Rechtzeitig kam ihr die ganze Absurdität dieses Vorhabens zum Bewußtsein.
Sie nickte Stanislaus Demba zu und verabschiedete sich von Frau Buresch. Dann nahm sie das kleinere der Kinder an der Hand und ging.
Als sie beim Parkausgang stand, fiel ihr ein, daß der arme Mensch das Geld ja gar nicht zu sich nehmen konnte. Aber sie dachte sich, daß ihm irgend jemand schon helfen werde. Vielleicht ein Vorübergehender; oder Frau Buresch.
Frau Buresch, der kein Wort des Gespräches entgangen war, obwohl sie sich den Anschein gegeben hatte, als sei sie nur mit ihrer Häkelarbeit beschäftigt, war Zeugin, wie Stanislaus Demba das Geld entdeckte. Sie beobachtete, wie sein Gesicht sich in eine Grimasse der Bestürzung, des Ekels und der Enttäuschung entstellte, und sie sah mit Staunen, wie aus seinem Mantel zwei Fingerspitzen hervorkamen, die das Geld mit wütender Gebärde auf den Boden warfen.