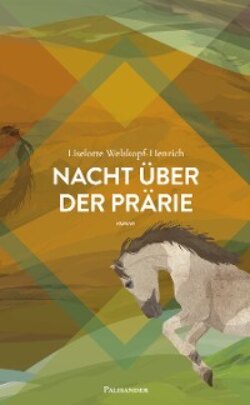Читать книгу Nacht über der Prärie - Liselotte Welskopf-Henrich - Страница 10
Rancher
ОглавлениеLauras braunhäutige Finger mit den rotlackierten Nägeln glitten über die Tasten. Sie hatte für den Superintendenten zu schreiben; es war ein amtliches Schriftstück, und nicht der geringste Fehler durfte es verunstalten.
Ein Besucher trat ein. Ein Klopfen hatte sie nicht gehört. Als er nun vor ihr stand, erkannte sie ihn. Es war Joe King.
»Ich bitte, den Superintendenten zu sprechen«, sagte er, als ob dies die einfachste Sache der Welt sei, obgleich nicht einmal der Häuptling, jetzt genannt Chairman oder President, gewagt hätte, einfach zu dem Superintendenten, dem obersten der Aufsichts- und Verwaltungsbeamten der Reservation, vordringen zu wollen.
»In welcher Angelegenheit?« fragte Laura.
»Das werde ich ihm selbst vortragen.«
»Wenn es sich um eine Wohlfahrtsangelegenheit handelt, bitte Mrs Carson, Ökonomie, Mr Haverman … Schulwesen brauchen Sie wohl nicht mehr.«
»Danke, ist bekannt. Ich wünsche den Superintendenten zu sprechen.«
»Der Superintendent nimmt nur Vorlagen an, die bereits von den Fachdezernenten und von seinem Stellvertreter, Mr Shaw, bearbeitet sind.«
»Wenn Sie mir das als die Auffassung des Superintendenten schriftlich geben können, sehe ich von meiner Bitte ab.«
Laura fuhr mit der Zungenspitze über die rotbemalten Lippen. Was für ein frecher Mensch! Und wie er sich auszudrücken verstand. Sie war gewohnt, dass Indianer, die abgewiesen oder an eine andere Stelle verwiesen wurden, stillschweigend wieder verschwanden. Aber Joe King hatte wohl von Anwälten und Richtern in seinen Strafprozessen gelernt.
Laura kämpfte mit sich. Dann nahm sie das Schriftstück, mit dem sie zu ihrem Vorgesetzten zu gehen hatte, und begab sich in das Zimmer des Superintendenten.
Er war allein und studierte eben Rundschreiben, die die einzelnen Reservationsverwaltungen über die Distriktsverwaltungen von der Regierungszentrale für Indianerangelegenheiten zu erhalten pflegten. Der höchste Chef drückte darin seine Unzufriedenheit mit dem bisherigen Zustand aus. Alle Superintendenten wurden ermahnt, ein vertrauensvolleres Verhältnis zwischen den Indianern und deren vorgesetzter Verwaltung herzustellen und den Kampf gegen die Armut energischer und einfallsreicher zu führen. Der Lebensstandard der Indianer, der weit unter dem Durchschnitt liege, müsse gehoben werden. Alle bisherigen patriarchalischen Vorstellungen seien abzulösen durch die allgemeine Devise: Help to help themselves – den Indianern helfen, sich selbst zu helfen. Peter Hawley las und wusste wohl, dass dies die neue Linie seit dem Zweiten Weltkrieg war und dass der neue Hohe Kommissar für Indianerangelegenheiten, der Hawley vor kurzem auf die schwierige Reservation versetzt und damit aus seinem gewohnten Lebenskreis herausgerissen hatte, diese neue Linie schneller und wirkungsvoller zur Geltung bringen wollte. Die Worte wirkten alle wohlmeinend und wohldurchdacht, aber wenn Buchstaben zu Menschen wurden, begannen die Schwierigkeiten.
Auch das war Peter Hawley bekannt. Der Superintendent Hawley, mit dreißig Prozent Indianerblut in den Adern, seit zwanzig Jahren im Dienst, legte die Rundschreiben achtsam und respektvoll beiseite. Er nahm aus Lauras Hand das Schriftstück in Empfang, las Wort für Wort, fast Silbe für Silbe, fand alles ohne Tadel und freute sich, von seinem Vorgänger eine so gute Sekretärin übernommen zu haben. Er unterzeichnete.
Da das Mädchen sich nicht gleich wieder entfernte, schaute er sie fragend an.
»Joe King ist im Vorzimmer und wünscht den Superintendenten persönlich zu sprechen. Ich wollte ihn an die Fachdezernate verweisen, aber er besteht darauf, Mr Hawley selbst zu sprechen … oder«– und dies fügte Laura mit besonders spitzer Stimme hinzu –»oder er wünscht, die Ablehnung schriftlich zu erhalten.«
Der grauhaarige Superintendent lächelte ein wenig.
»Er soll hereinkommen.« Es war der erste praktische Fall auf Grund der jüngsten Rundschreiben: Vertrauen gegen Vorurteile.
Als Joe King eintrat, wurde ihm ein Stuhl angeboten.
»Bitte – was führt Sie her?«
Joe King war verwirrt. Er kannte seit Jahren kein Entgegenkommen, sondern nur Krieg, und als er die Worte des Superintendenten hörte, verlor er etwas das Gleichgewicht wie ein Mensch, der bereit gewesen ist, sich entgegenzustemmen und auf einmal keinen Widerstand findet.
Laura hatte die Polstertür geschlossen und dachte draußen über das wetterwendische und unberechenbare Wesen von Vorgesetzten nach. Dieser Joe King wurde empfangen! Sie ärgerte sich, dass er sich gegen strikte Dienstanweisungen durchgesetzt hatte. Sie war fest entschlossen, sich zu rächen und dem Superintendenten in den nächsten Tagen einige Besucher mit unnützen Anliegen auf den Hals zu schicken.
Im Zimmer des Superintendenten hatte Joe King zu sprechen begonnen: »Ich war vor zwei Wochen bei Mr Haverman, aber er hat keine Chance für meine Pläne gesehen. Ehe ich sie aufgebe, wollte ich Sie selbst sprechen.«
Der Superintendent wiederholte sein »Bitte« durch eine einladende Handbewegung.
»Der Zustand der Reservation ist unbefriedigend.« Stonehorn sprach schnell, gehetzt, wie jemand, der lange nachgedacht hat und eine einmalige Gelegenheit, seine Gedanken vorzutragen, nicht genügend zu nutzen fürchtet.
»Wir haben sehr dürren Boden, wir haben viele Arbeitslose, wir haben viele Trinker, wir haben sehr wenig und sehr schlechtes Wasser und noch weniger Brunnen, mit denen wir Grundwasser heraufholen können. Die meisten von uns sind falsch ernährt oder unterernährt, viele sind krank. Die Sterblichkeit, besonders unter den Kindern, ist immer noch sehr groß. Unser Land hier ist abgelegen vom Verkehr; es ist schwer, Industrie herbeizuziehen, und Ihre Unternehmer trauen dem indianischen Arbeiter nicht. Der Staat, in dem auch wir Indianer Bürger und Soldaten sind, gibt jährlich Millionen und vielleicht Milliarden an Völker in anderen Kontinenten, damit sie, wie es heißt, ihre Wirtschaft entwickeln können. Wir aber haben eine teure Verwaltung auf dem Hals, und das Geld, das wir erhalten und das uns immer hingeworfen wird, wie man dem Bettler das Almosen hinwirft, ist nur ein Cent gegen die Dollars, die nach außerhalb gegeben werden. Es ist sogar unser eigenes Geld, Vertragsgeld, das man uns vorenthält, um es von anderen verwalten zu lassen. Selbst über das, was wir bekommen, können wir nicht selbst entscheiden. Wir können Ihre Fehler nur immer hinter Ihrem Rücken kritisieren, denn es fehlt uns eine legale Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen, und wir haben keine Gelegenheit, aus eigenen Fehlern zu lernen. Wir sind entmündigt. Sind wir keine Menschen?«
Der Superintendent schaute vor sich hin. »Ich kenne alle diese Argumente, Mr King, wenn sie mir auch noch nie derart einseitig und anmaßend vorgetragen wurden. Ich könnte Ihnen natürlich mit Gegenvorwürfen antworten. Das Reservationsland war groß, aber seine Bewohner haben schlecht gewirtschaftet, sie haben sich bitteren Tränen hingegeben, statt zu arbeiten, sie haben ihre Renten vertrunken, statt ihre Kinder damit zu ernähren – davon können Sie selbst ein Lied singen –, sie haben ihre Söhne und Töchter von der Schule fernzuhalten versucht, bis wir sie mit der Polizei holen mussten. Auch das wissen Sie selbst nur zu gut. Ihr Indianer habt schließlich Land an Weiße verkauft, und dieses Land, das beste Land, fehlt jetzt der Reservationswirtschaft. Wir aber haben Schulen gebaut – Ihre eigene Frau genießt eine ausgezeichnete Ausbildung –, wir haben das Krankenhaus gebaut, wir haben ein Altersheim gebaut, wir bezahlen Lehrer, wir bezahlen Ärzte, wir bezahlen Schwestern, und die Kinder können etwas lernen. Reservations-Indianer sind nicht steuerpflichtig, und auch der Arbeitsfähige erhält Arbeitslosenunterstützung. Wer will, kann die Reservation verlassen. Ein qualifizierter Arbeiter findet in unseren Staaten überall sein Brot.«
Joe King war aufgestanden. »Ja, wir haben zu lange geträumt, das ist wahr. Ihr habt uns das Land genommen, und ihr habt uns Renten versprochen, das war ein böser Tausch. Als wir keine Waffen mehr hatten, habt ihr uns noch mehr Land weggenommen. Jeder Familie habt ihr das Land für eine und eine halbe Kuh gelassen … und ihr habt euch gewundert, dass die Familien verkaufen mussten und zu trinken anfingen, um wieder träumen zu können. Wir können gehen … sagen Sie … ja, wir können den letzten erbärmlichen Rest, der uns vom Land unserer Väter geblieben ist, auch noch verlassen … aber das wollen wir nicht. Wir sind ein Volk geblieben durch eure Reservation und durch das, was wir auf euren Reservationen seit hundert Jahren erleben mussten. Es können einige von uns gehen, aber ein Kern bleibt. Wir wollen, dass unsere Reservation ein Land für Menschen wird … oder wollen wir tauschen? Lasst uns in euren Häusern hier wohnen, wo es Wasser gibt und Gärten und Springbrunnen und Straßen … und zieht in unsere Hütten, in denen wir uns nicht waschen können, weil wir das bisschen Wasser zum Trinken für unsere Kinder brauchen.«
Es trat eine Pause ein.
»Sie wollten mir nicht Vorwürfe machen, sondern Vorschläge, Joe King.«
»Gebt unserem Stammesrat Freiheit, damit wir wieder Lust bekommen zu arbeiten. Lasst uns mit anderen Reservationen unsere Erfahrungen austauschen. Gebt uns etwas von dem Geld, das ihr nach Afrika tragt und nach Asien, für Brunnen und Bewässerungsanlagen hier. Wir könnten außer Rindern auch Schafe züchten, wir könnten Kleinvieh halten, wir könnten Spezialzuchten von Pferden und von Büffeln aufbauen. Wir könnten das Kunsthandwerk besser entwickeln, wir könnten den Tourismus aufbauen, wir könnten auch mehr Sport treiben.«
»Ja, natürlich. Wo und wie wollen Sie den Anfang machen? Es liegt alles nur an euch. Wir sind da, um eure Selbsthilfe zu fördern.«
Joe King betrachtete den Superintendenten fast eine volle Minute schweigend und herausfordernd. Als Hawley nichts weiter sagte, schloss King: »Es liegt alles an uns, an den Wilden, an den Entmündigten, an den Besiegten, an den Beraubten. Aber wir haben nicht die Millionen, die seit einem Jahrhundert für unsere Aufseher und Vormunde ausgegeben worden sind und noch ausgegeben werden. Goodbye.«
»Halt, King. Ehe ich mein Goodbye ausspreche, möchte ich Ihnen das Folgende mitgeben: In den letzten sieben Jahren haben Sie mehr Zeit in Gefängnissen und unter Verbrecherbanden verbracht als auf unserer Reservation. Ich spreche Ihnen deshalb jedes moralische Recht ab, über die mühevolle Arbeit von Generationen von Treuhändern abfällig zu urteilen. Arbeiten Sie erst einmal selbst.«
Um Joe Kings Mundwinkel erschien der abfällig-herablassende Ausdruck, der den Superintendenten mehr reizen musste als die Tatsache, dass der Indianer doch noch das Schlusswort sprach: »Sir, über mich sind Urteile und Fehlurteile ergangen, und ich habe in Ihren Gefängnissen mehr gebüßt, als ich verbrochen habe. Aber was mit meinem Volk geschah und vieles von dem, was heute noch mit uns geschieht, findet keinen Richter, es sei denn, dass er sich in Ihrem Gewissen rührt.«
Während Hawley in seinem Dienstzimmer, aus dem der Besucher lautlos verschwunden war, einige Minuten hindurch untätig, unwillig und doch nachdenklich saß, traf Joe auf der Straße Queenie, die mit zwei Pferden auf ihn gewartet hatte.
»Wir sollen uns allein helfen«, sagte er. »Es hat überhaupt wenig Zweck, mit Menschen zu reden, die auf Sesseln sitzen. Uns beiden bleibt nichts übrig, als bei meinem Vater zu wohnen. Niemand anders nimmt uns auf, und nur auf unserer Ranch finde ich etwas Arbeit. Der eine frei gewordene Platz in der Angelhakenfabrik ist schon besetzt; sie haben ihn schnell weggegeben, damit sie mich nicht einzustellen brauchen.«
»Stonehorn – du hättest auch nicht Tag für Tag zwischen den Weibern sitzen und Angelhaken biegen können, um nicht einmal das zu verdienen, was ein Erdbeerpflücker jetzt verdienen soll.«
»Meinst du?« Er lachte, ein wenig heiter, weil er seine junge Frau neben sich sah, aber auch mit einer Spur von Sarkasmus. »Ich habe einmal zwei Jahre lang solche Arbeiten gemacht, wenn auch nicht zwischen ehrlichen Weibern.«
Er trieb seinen Hengst an.
So kam es, dass Stonehorn und seine Frau am Nachmittag beim Hause des alten King anlangten.
Sie sprangen beide von den Pferden. Drei magere Hunde kläfften und verzogen sich, als sie den Fußtritt ihres Herrn zu fürchten hatten. Während Stonehorn in das Haus ging, um den Vater zuerst allein zu begrüßen, hielt Queenie wieder die beiden Pferde. Der Hengst hatte sich schon an sie gewöhnt und machte keine Schwierigkeiten. Während sie die Zügel locker hielt und die Tiere grasen ließ, schaute sie über Tal und Berg. Die Prärie hatte hier einen anderen Charakter als in der Umgebung von Queenies Heimathaus. Jenseits eines breiten Tales, an dessen Hang Queenie stand, stiegen weiße Felsen auf, und am Fuß der Felsen war der Boden feuchter, die Vegetation grüner. Das Land war dort abwechslungsreicher, weniger karg, und im Talgrund führte eine Autostraße entlang. Queenie konnte das Haus sehen. Rinder grasten, und ein Junge jagte eben eine Gruppe von ungezäumten Pferden herbei.
Queenie wandte sich um, denn Stonehorn kam mit seinem Vater zusammen, um sie zu holen. Sie empfand in diesem Augenblick wieder den Stich, dass sie zu Menschen gehen musste, die ihr noch fremd waren.
Der eigene Vater hatte sie zwar ruhig angehört und sein Einverständnis zur formellen Eheschließung gegeben, hatte ihr dann aber ebenso ruhig die Tür gewiesen. Sie sah noch den traurigen Blick, mit dem Mutter und Großmutter sich wortlos von ihr verabschiedeten, und die fassungslosen Gesichtchen der drei kleinen Geschwister, die auf ein Machtwort des Vaters hin der älteren Schwester nicht einmal ein Stück weit das Geleit geben durften. Aber dieser Mann hier, der ihr bis dahin noch ganz unbekannt geblieben war, lud sie sofort ein, als Tochter zu ihm zu kommen. Er war groß, nur zwei Fingerbreit kleiner als sein Sohn, und schien ungewöhnlich stark. Sein Gesicht war zerfurcht, unter die schwarzen Haare mischten sich graue. Er trug noch zwei Zöpfe nach alter Indianersitte. Obgleich seine Kleidung alt, ausgewaschen, geflickt und wieder zerrissen war, fühlte Queenie weder Verachtung noch Abneigung gegen Old King, sondern eine natürliche Sympathie für ihn, und sie wunderte sich, dass Stonehorn geglaubt hatte, sie könne ein Leben bei seinem Vater nicht ertragen.
Das Haus, in das Queenie eingeführt wurde, war ein kleines, einfaches, rechteckiges Blockhaus, das einen einzigen Raum umschloss. Es hatte die übliche Bauart der älteren Reservationshäuser. Mit einem Blick überschaute Queenie das Innere. Linker Hand vom Eingang befanden sich übereck zwei Schlafgelegenheiten, mit Wolldecken versehene Holzgestelle, die breit genug waren, um zwei oder notfalls auch mehr Schläfern Raum zu bieten. Ein Tisch stand dazwischen. An der Wand am Haken hingen Kleider, in der Mitte des Raumes war der kleine eiserne Ofen aufgestellt, dessen Rohr durch das Dach ging und der auch als Herd diente. Auf einem Wandbrett stand eine Petroleumlampe, in einer Ecke ein ausgedienter Eisschrank. Eine alte Decke lag über Gegenständen, deren Natur nicht ohne weiteres zu erkennen war. Zuletzt entdeckten Queenies forschende Augen noch zwei Jagdgewehre.
Als Empfangs- und Festbraten gab es einen Fasan, den der Alte geschossen und vorzüglich zubereitet hatte. Er war stolz und freute sich, dass die Schwiegertochter es sich schmecken ließ und seine Kochkunst anerkannte.
»Du bist, wie eine Frau sein soll«, sagte er nach dem Essen. »Ich habe schon einiges gehört. Es ist richtig, wie ihr das gemacht habt. Nie und nimmer können sie ihm«– er nickt zu seinem Sohn hinüber –»nachweisen, dass er Harold umgebracht hat. Ihr müsst euch nur nie einschüchtern lassen und immer zu euren eigenen Worten stehen.«
Queenie schaute auf ihren Mann.
»Ich habe Harold nicht getötet.«
Der Alte lachte vergnügt. »Gut, gut, mein Sohn!«
Queenie nahm sich zusammen. Sie räumte den Tisch ab, verwahrte das Fasanengerippe, das sie am nächsten Tag noch einmal auskochen konnte, und begann die Stube auszukehren. Der Reisigbesen war neu.
»Den habe ich dir gemacht, weil ich gehört habe, wie fein ihr auf der Schule lebt«, meinte der Schwiegervater. »Du willst es hier sauber haben, das kann ich mir denken. Es wird aber ein paar Tage oder Wochen dauern, bis du über den Schmutz Herr wirst, den zwei Männer immer wieder hereintragen. Wasser ist übrigens ganz in der Nähe.«
Queenie ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie ging hinaus, Stonehorn kam mit ihr, und die beiden suchten die Eimer und Gefäße zusammen, die noch heil genug waren, um Wasser darin zu holen.
»Der nächste Brunnen ist drüben bei Booth«, erklärte Stonehorn, »aber dorthin gehen wir nicht.«
Er lief quer über den Hang voran, und Queenie folgte ihm. Er war rücksichtsvoll genug, nicht so rasch zu gehen, wie er es mit seinen langen Beinen wohl gern getan hätte.
Der Nachmittagswind kühlte sich schon zu einer Abendbrise ab. Das Gras nickte und neigte sich. Auf dem vernachlässigten Friedhof, nicht weit von Stonehorns Haus, beugten sich die langen, schon vergilbenden Gräser um schief stehende Holzkreuze. Nur ein kräftiger, oben gebogener Stab, der mit Federn behangen war, stand aufrecht, gerade. Das war indianischer Grabschmuck für einen Häuptling. Der Stab hatte die Bedeutung eines Zepters oder einer Flagge. Wo er stand, da war Indianerland. Und wenn es auch nur ein Grab war. Tashina wollte später einmal fragen oder hingehen und sehen, wer hier sein letztes Tipi, seine letzte Heimat, gefunden hatte. Rötlicher Schimmer glänzte über den weißen Felsen. Der Sonnenball senkte sich am westlichen Horizont. Auf der Seite des Tales, auf der Stonehorn und Tashina gingen, wuchsen die Schatten. Der Mann drängte mit etwas beschleunigtem Tempo voran. Wahrscheinlich war der Brunnen noch weit. Aber Queenie machte das nichts aus. Sie freute sich, mit ihrem Mann allein unterwegs zu sein, und sie sog die Luft ein, in der der Duft der weißen Rose, der Duft von Harz und fernen Wäldern lag. Stonehorn führte sie allmählich schräg abwärts, und nach einer Stunde kamen die beiden zu dem Brunnen, an dem sie nicht allein waren. Andere weit entfernt wohnende Familien hatten sich ebenfalls eingefunden. Sicher war hier auch eine Art von Nachrichtenzentrale, aber Stonehorn war nicht geneigt, sich in Gespräche verwickeln zu lassen, und Queenie wurde mit scheuer Höflichkeit behandelt.
Als die beiden sich mit den schweren Eimern und Gefäßen auf den Rückweg machten, bemerkte Stonehorn: »Wir müssen ein Auto haben oder große Wassersäcke, die wir den Pferden anhängen. So kannst du nicht dauernd schleppen gehen.«
»Habt ihr das bisher immer getan?«
»Ja, aber wir haben nicht soviel Wasser gebraucht wie jetzt, wo du da bist, und meistens bin ich auch nicht zu Hause gewesen.«
Der Rückweg mit der Last war mühsam, und die beiden brauchten bedeutend längere Zeit als für den Hinweg. An Rast dachten sie aber nicht.
Beim Haus kläfften wieder die hungrigen Hunde und wurden durch einen Steinwurf verscheucht. Der Nachthimmel war klar, die Sterne leuchteten über der dunklen Prärie und den weißen Felsen. Die Straße im Tal lag leer, wie ausgestorben.
Der Vater war noch wach und hatte die Petroleumlampe zum Brennen gebracht. Sein Ausdruck hatte sich verändert, doch hätte Queenie, die ihn noch sowenig kannte, nicht sagen können, wie. Er hatte sich in Kleidern und Schuhen auf das eine Gestell gelegt, das wohl des Nachts sein Bett war.
»Wie habt ihr euch das nun weiter gedacht?« fragte er seinen Sohn.
»Queenie hat sich die Stute gekauft. Ich will mit einer Pferdezucht anfangen. Queenie wird noch ein paar Hühner beschaffen und vielleicht zwei oder drei Schafe. Jetzt, wo Queenie da ist, können wir auch etwas Gemüse anpflanzen und vielleicht ein paar Kartoffeln. Sie versteht das, sie hat es zu Hause gelernt. Was sie mit ihrer Malerei noch weiterhin verdienen wird, stecken wir alles in die Pferde. Die Preise für Rodeo-Pferde steigen. Wir halten auch eine Kuh oder ein paar Kühe, sobald wir das Geld haben, Boden dazuzupachten.«
Der Alte lächelte ganz sonderbar. »Mit Malen verdient sie Geld?«
»Ich habe dir das schon gesagt.«
»Dann soll sie doch lieber die Schule fertigmachen und viele Bilder malen, statt dass ihr hier mit Schafen anfangt! Schafe! Wann hat man hier je etwas von Schafen gehört! Bist du dumm geworden?!«
»Darüber brauchen wir uns jetzt nicht zu streiten. Queenie soll natürlich die Schule fertigmachen. Solange kümmere ich mich hier um die Pferde. Alles andere kommt im nächsten Sommer, wenn Queenie fertig ist.«
Stonehorn hatte sich auf dem zweiten Schlafgestell ausgestreckt, ebenfalls in Kleidern und Schuhen. Die Tür stand offen. Queenie lehnte sich an den Türpfosten und atmete die frische Luft. Nachts, wenn die Tür geschlossen wurde, war es in solchen Häusern stickig, und Queenie ekelte sich vor dem Geruch lange nicht gereinigter Wolldecken. Sie wollte den sanften, frischen Duft genießen, solange es möglich war, und ihn auch in die Hütte hereinlassen. So hatte es daheim die Mutter immer gehalten. Einen Augenblick dachte Queenie an die kleinen Geschwister, die jetzt in einem Nest von Decken mit der Großmutter zusammen schon schliefen. Ob sie noch einmal von Queenie, der großen Schwester, träumen würden, wenn sie auch nie mehr von ihr sprechen durften?
Queenies Gedanken kehrten in ihre nächste Umgebung zurück. Sie hörte, wie der alte King kaute, als ob er Kautabak im Munde habe.
»Was hast du da von den Pferden gesagt?« fragte er zum Sohn hinüber.
»Dass ich mich darum kümmere.«
»Du hast dich noch nie viel um was gekümmert. Wo sollen denn die Pferde weiden?«
»Wo? Auf unseren Wiesen hier.«
»Hm.«
Stonehorn blickte gespannt auf den Vater.
»Du meinst, das reicht auch im Winter?« fragte der Alte weiter.
»Im Winter reicht es vorläufig noch nicht, weil wir nicht genug Land haben. Diesen Winter muss ich noch Heu und Hafer kaufen.«
»Hafer brauchen die netten Tiere?«
»Meinst du, mein Hengst ist gewohnt, Rüben zu fressen?«
»Aber dein Vater ist das gewohnt, was?«
»Ich so gut wie du.«
»Wenn du zufällig mal da bist.«
»Ich bin jetzt da. Vergiss das nicht.«
Nach diesen letzten Worten blieb es einige Zeit still. Aber in dem Gesicht des Alten arbeitete es. Die Sache war noch nicht abgetan.
Queenie hatte plötzlich eine Schreckensvorstellung. In diesem einsamen kleinen Haus hier war der Mord geschehen … in diesem Haus hier hatte die Mutter Stonehorns ihren Schwiegervater totgeschlagen, der so gut wie ihr Vater galt, und in diesem Hause hier hatte sie ihrem Kind den Namen Stonehorn gegeben, als es die Schläge des Großvaters überlebt hatte.
Queenie lehnte regungslos an dem Türpfosten. Es war vielleicht schon Zeit, aber sie war noch nicht in der Stimmung, ins Bett zu gehen.
»Die Wiesen gehören uns nämlich nicht mehr«, sagte der Alte schließlich. »Ich habe sie verpachtet.«
Stonehorn hatte gelernt, sich zu beherrschen, wenn er sich beherrschen wollte. »An wen hast du sie verpachtet?«
»An wen soll ich hier wohl verpachten! Es gibt nur einen im Tal, der Land braucht und Pacht zahlt. Isaac Booth nämlich.«
Stonehorn stand mit einer erschreckenden Langsamkeit auf. »So. Isaac Booth. An den hast du die Wiesen weggegeben. Auf wie lange?«
»Auf zehn Jahre.«
Der Alte war auf seinem Gestell und den stinkenden Decken liegengeblieben.
»Was gibt er dir dafür?«
»Einen Dollar pro Acre im Jahr, wie üblich.«
»Das heißt also, hundertsechzig Dollar im Jahr. Und was willst du mit dem Geld machen?«
»Das geht dich nichts an. Vorläufig ist das noch mein Land und also auch mein Geld.« Der Alte fing an zu brüllen. »Du hast ja deine Malerin, die für dich zahlt.«
Stonehorn spuckte seinem Vater ins Gesicht.
Der Alte war schon auf den Beinen. Der Sohn verstellte ihm den Weg zu den Jagdgewehren und zu jenen Gegenständen, die unter einer Decke verborgen lagen.
Queenie blieb regungslos an der Tür; auch wenn sie sich hätte rühren wollen, sie hätte es nicht mehr vermocht.
»Hast du schon wieder gesoffen?« schrie Stonehorn den Alten an.
Der Ausdruck im Gesicht Old Kings wurde unheimlich. »Ich hab ihn doch gefunden, Joe. Ich brauch kein Wasser. Ich brauch anderes Wasser …« Er brach in Lachen aus. »Du hättest ihn lieber selber saufen sollen, dann wär er weg gewesen. So hab ich ihn doch noch gefunden …«
»Leg dich hin und gib Ruhe.« Stonehorn zwang seine Stimme, wieder ruhiger zu werden.
»Was bildest du dir denn ein, Sohn! Meinst du, ein King kann ein anständiger Mensch werden?« Der Alte lachte wieder. »Gib mir noch die zweite Flasche … die ich … noch nicht gefunden habe!«
»Nichts geb ich dir!«
»Rück sie raus!«
»Gib Ruhe. Du bist schon besoffen.«
»Gib sie her … sag ich dir … oder ich schlag dich kaputt … dich Bandit …«
Mit tückischer Schnelligkeit schleuderte der Alte ein Stück Eisen mit spitzen Kanten, vielleicht ein Stück eines alten zerbrochenen Ofens, gegen den Sohn. Stonehorn taumelte, fing sich aber wieder.
Queenie hatte einen leisen Schreckenslaut ausgestoßen. Der Betrunkene hatte sehr starke Muskeln und die Kraft des Rausches. Er drängte Stonehorn beiseite, der Tisch stürzte um, die Petroleumlampe fiel von dem Wandbrett. Das Rohr, das vom Ofen durch das Dach führte, wurde auseinandergerissen. Feuerfunken stoben im Dunkeln. Der Alte wollte zu den Jagdgewehren … Stonehorn hatte ihn an der Gurgel, aber der Alte packte ihn an den Haaren, trat ihn und stieß ihm mit dem Knie in den Leib. Beide stürzten. Eines der Jagdgewehre, das an der Wand gelehnt hatte, fiel polternd zu Boden, und ein Schuss krachte. Die Waffe war durchgeladen gewesen.
Stonehorn zog dem tobenden Alten das Halstuch zusammen, um ihn in die Gewalt zu bekommen, ehe weiteres Unheil geschah. Queenie graute es. Sie zitterte, noch immer ohne sich rühren zu können, und der Schweiß lief ihr über das Gesicht. Ihr Gehör sagte ihr dann, dass der Kampf beendet war.
Langsam ging sie in das dunkle Innere des Hauses hinein. Sie verstand jetzt, warum Stonehorn geglaubt hatte, dass sie hier nicht werde leben können.
Stonehorn war eben damit beschäftigt, den Körper des Vaters in eine Wolldecke einzuschnüren, so dass der betrunkene Alte nicht mehr gefährlich werden konnte. Die Zunge war wieder in den Mund zurückgeglitten, aber offenbar war der alte Mann nicht bei Bewusstsein. Stonehorn legte ihn wie einen Kranken auf das Schlafgestell, wo er gelegen hatte, trat an die Tür und stecke sich eine Zigarette an. Beim Aufflammen des Feuerzeugs erkannte Queenie, dass Stonehorn aus einer Kopfwunde stark blutete.
Er bemerkte ihren besorgten Blick. »Lass, ich habe gutes Blut. Es gerinnt rasch. Nur schade um das weiße Hemd. Aber nun wissen wir wenigstens, wofür wir das viele Wasser geschleppt haben.«
Er zog das Hemd aus und warf es in einen der Bottiche.
Er ging in den Raum zurück, stellte den Tisch auf und drückte das Ofenrohr mit einiger Mühe wieder zusammen. Er sicherte das Jagdgewehr des Vaters und holte unter seinem Schlafgestell etwas hervor. Als er es auswickelte, zeigte sich, dass es die gesuchte Flasche war. Er nahm einige kräftige Schlucke, bot der bebenden Queenie einen weiteren an, um den sie in diesem Augenblick froh war, und goss den übrigen Brandy aus. »Alles Mistbrühe, was die Laura hierher schmuggelt. Wenn wir zwei einmal nach New City fahren, trinken wir Black and White.«
»Das Trinken ist uns streng verboten.« Das war das erste, was Queenie hervorbrachte.
»Joe King hat noch immer gewusst, wo er bekommt, was er will. – Bist du sehr erschrocken?« fragte er dann sacht und ablenkend. »Es war nichts. Er wird seinen Rausch ausschlafen, und morgen wird er wieder der freundlichste Mann sein. Aber unser Land hier hat er an Isaac Booth verpachtet … und es ist wahr, was er sagt. Ich will nicht von deinem Geld leben.«
Queenie war unfähig, noch ein Wort zu sagen.
Sie legte sich mit ihrem Mann zusammen auf den schmutzigen Decken zum Schlafen nieder, drückte mit ihrer Hand den Riss an seinem Kopf zusammen, bis er ganz aufhörte zu bluten, und vernahm dabei das Röcheln und Schnarchen des Betrunkenen und Gefesselten auf der anderen Lagerstatt.
Als sie noch lange wach gelegen hatte und merkte, dass auch ihr Mann nicht schlief, flüsterte sie: »Er kann es nicht einfach verpachten. Es ist Stammesland, und er braucht die Zustimmung des Rats und des Superintendenten.«
»Der Rat und der Superintendent sprechen mit der Zunge des Isaac Booth. Für einen Joe King ist es nicht so leicht, einen neuen Anfang zu machen. Wo soll ich nun Arbeit finden?«
Sie lagen beieinander, und endlich schliefen sie für wenige Stunden ein. Mit der frühen Dämmerung des neuen Sommertages waren sie wieder wach. Der Vater wälzte sich herum und wunderte sich, und Stonehorn stand auf, um ihm die Riemen und die Decke abzunehmen.
»Was hast du denn mit mir gemacht, Sohn?«
Der Alte lief aus der Hütte, erbrach sich, und dann war zu hören, wie er sich an einem Eimer wusch.
Als er wieder hereinkam, sagte er zu Queenie: »Du bist ein gutes Kind. Was hast du für Wasser geschleppt!« Und zu seinem Sohn: »He, Joe, hast du nicht einen Tropfen für mich?«
»Nicht einen. Es ist alles ausgelaufen.«
Der Vater schaute verblüfft um sich. Er begriff wohl nicht gleich, worauf diese Worte zielten, dann sah er die zerbrochene Petroleumlampe, und die Erinnerung kam ihm. »Ach, alles ausgelaufen.«
Queenie wusch sich gründlich hinter dem Haus und zog sich sorgfältig an. Stonehorn betrachtete ihr Verhalten prüfend, sagte aber nichts, sondern reinigte nur sein Haar vom Blut, sattelte seinen Hengst und ritt weg. Als er verschwunden war, sattelte auch die junge Frau ihr Pferd. Der Vater fragte sie nicht nach ihrem Vorhaben. Er setzte sich auf eine kleine Bank an seinem Haus und schaute in den Morgen, hangaufwärts, wo er die Straße nicht zu sehen brauchte und auch nicht die große Ranch der Familie Booth.
Queenie ritt nicht in Richtung der Agentursiedlung wie ihr Mann, sondern wandte sich zur anderen Talseite, wo das Haus der Booths stand. Wenn die vergangene Nacht das Schauerlichste war, was in ihrem jungen und gutgläubigen Leben je über sie hatte kommen können, so erschien ihr das, was sie nun plante, als das Schwerste, was sie sich je selbst vorgenommen hatte.
Sie erreichte die Nachbarranch. Rings um das Haus der Booths war Morast, von Vieh zertrampelt, aber Queenie mit ihrem Pferd kam leicht durch.
Vor dem Haus stand die eine noch unverheiratete Tochter der Booths, ein grobes, tüchtiges Ranchermädchen, nicht mehr eben jung, schon über Mitte Zwanzig, mit Zügen, die die Anstrengung unentwegter Arbeit verrieten. Sie war ihrem Bruder Harold in keiner Weise ähnlich, und darum war Queenie in diesem Augenblick sehr froh.
»Hallo!«
»Hallo!«
Mary wischte sich die Hände an der Schürze ab und wartete, bis Queenie abgesprungen war und das Pferd an dem nahen Zaun angebunden hatte.
Als sie merkte, dass Queenie verlegen war, begann sie das Gespräch von sich aus. »Wir sind jetzt Nachbarn …«
»Ja.«
»Nett, dass du kommst und uns begrüßt. Dein Mann hätte ruhig auch kommen können.«
Queenie wurde es heiß von den Schläfen bis zu den Zehenspitzen. »Er musste schon früh weg.«
»Ja, wir haben ihn wegreiten sehen.«
So, dachte Queenie, von hier aus werden wir also immer beobachtet.
»Schade«, sprach Mary weiter, »aber Vater und Mutter sind heute nicht hier. – Komm zu mir herein.«
Queenie folgte der Einladung. Das Haus war größer und neuer als das der Kings. Es hatte eine Küche, zwei Zimmer und eine Diele. Queenie nahm mit Mary in der Diele Platz.
»Habt ihr schon etwas von Harold gehört?« erkundigte sich Queenie.
»Nein, gar nichts.«
»Wo kann er denn nur sein! Nach dem, was die Kassiererin vom Supermarkt gesagt hat, ist er ja wohl zuletzt in Richtung New City gefahren. Da wurde ja auch am Straßenrand das Kettchen gefunden, das er immer trug und das er dann wohl weggeworfen hat.«
»Dein Kettchen, ja.« Mary verzog den Mund etwas. »Weiß der Himmel, wie das weitergegangen ist, aber jetzt im Sommer, wo soviel zu tun ist, fehlt er uns sehr, obwohl er ein ausgesprochener Faulpelz ist und die Arbeit immer auf mich abgeschoben hat. Aber etwas war doch immer noch an ihm hängengeblieben, und das soll ich jetzt auch noch alles machen.«
»Nehmt euch jemanden zur Hilfe. Ihr habt das Geld.«
»Die Leute taugen alle nichts, sagt mein Vater. Am liebsten würde er die Arbeit überhaupt allein machen, hundert Stück Vieh, die Pferde und die Schweine selbst versorgen und dazu noch ackern. Wir haben nur den kleinen Jungen da, den Sohn von meiner Schwester. Aber Land dazupachten und immer wieder Land dazupachten, davor scheut sich der Vater gar nicht, als ob es damit getan wäre.«
Queenie war froh, dass ohne ihr Zutun das Thema angeschnitten wurde, das ihr am Herzen lag.
»Das unsre von da oben habt ihr nun auch dazugenommen.«
»Weißt du es schon, ja? Das war die größte Dummheit, die mein Vater machen konnte. Unser anderes Land hängt zusammen. Aber das eure liegt abseits, da drüben. Soll ich dort vielleicht auch noch auf das Vieh aufpassen?«
»Uns werden die paar Acres sehr fehlen.«
»Warum? Joe züchtet doch kein Vieh, der treibt sich herum, und du gehst auf die Kunstschule. Ihr könnt das Land noch weniger brauchen als wir.«
Hier diesem Ranchermädchen gegenüber fiel es Queenie schwerer, ihren Mann in Schutz zu nehmen, als vor dem Richter, denn sie rechnete noch weniger damit, dass man ihr glaubte. »Joe interessiert sich für Pferde.«
»Kind, das kostet viel Geld. Er will immer obenhinaus … alles oder nichts. Aber er rennt sich den Kopf noch einmal ganz und gar ein.«
»Ja, Geld … ich verdiene schon etwas. Er ist ein guter Reiter.«
»Von Pferden versteht er etwas, das ist wahr. Obwohl er ein Sitzenbleiber gewesen ist! Auch ein Rindvieh hat Respekt, wenn es ihn sieht, weil es immer denkt: Der Bursche da, der wird mich an den Hörnern packen.«
Queenie musste lächeln. Sie wunderte sich, dass die als schweigsam bekannte Mary soviel plauderte. Vielleicht war ein Zweck dahinter verborgen.
»Stonehorn hätte uns ja hier oft helfen können«, redete Mary weiter, »aber es hat ihm nie zugesagt, unter Harold den Cowboy zu spielen. Und jetzt ist der Vater ganz besessen und meint, dass es dein Mann gewesen sei, der Harold umgebracht hat.«
»Das hat er nicht getan.«
»Ich glaube es auch nicht. Weiß der Teufel, wo sich Harold, der Nichtsnutz, herumtreibt. Er soll uns nur nicht am Ende eine ins Haus bringen, die keine Arbeit anrührt.«
Queenie nahm sich ein Herz. »Wenn Joe nur selbst züchten könnte. Ich glaube, für Pferde besitzt er eine glückliche Hand. Wenn wir unser Land wiederhätten!«
»Was an mir liegt, tue ich dafür, dass die Pacht wieder aufgelöst wird. Aber dann muss Joe mir hier helfen, solange Harold nicht da ist.«
»Mary, das ist doch wohl ganz unmöglich.«
»Vor dem Herrn ist nichts unmöglich, pflegt der Priester zu sagen. Ich werde mit dem Vater sprechen. Überlass das mir.«
»Du wirst wohl langsam der wahre Herr im Haus?«
»Der Vater hat Rheuma, der Bruder verschwindet, und ich tue die Arbeit. Ihr bekommt euer Land zurück, wenn Joe bereit ist, bei uns mitzuhelfen. Aus Freundschaft, versteht sich. Geld gibt der Vater nicht. Ich habe gesprochen.«
»Ich will ihm das sagen.«
»Sag Joe, dass wir noch Kälber brennen müssen und ihn mit dem Lasso brauchen, und zwar bald.«
»Ja.«
Queenie stand auf, Mary begleitete sie bis zu ihrem Pferd.
Als Stonehorn gegen Abend zurückkam, fand er sein Zuhause schon wesentlich frischer und sauberer als am Tage zuvor. Queenie hatte auch Beeren gesammelt und neben der Suppe aus Fasanengerippe eine einfache Speise aus Mehl und Schmalz zubereitet. Der Vater war nicht zu Hause. Er war schon weggegangen, ehe Queenie von ihrem Besuch auf der Ranch zurückkehrte.
»Er hockt bei seinen alten Brüdern und versäuft die Pacht. Ich habe ihn gesehen. – Rege dich übrigens nicht auf, wenn es heute nacht wieder lustig zugehen wird. Er kommt besoffen nach Hause, das ist sicher, aber ich lasse ihn nicht herein. Mag er seinen Rausch diesmal auf der Wiese ausschlafen.«
Queenie zuckte zusammen.
»Übrigens war ich beim Stammesrat, bei Dave, der für die Ökonomie verantwortlich ist – soweit ein Indianer verantwortlich sein kann. Haverman steht über ihm. Dave hat mir gesagt, es komme überhaupt nicht in Frage, Land von Booth an die Kings zurückzugeben, von denen der Alte ein Trinker und der Junge ein Berufsverbrecher sei. So bald sieht mich dieser Stammesrat bestimmt nicht wieder.«
»Für welche Zeit hat dein Vater denn das Geld schon erhalten?« fragte Queenie schüchtern und erschüttert darüber, was sie eben wieder erfahren hatte.
»Bis Ende Dezember ist bezahlt, achtzig Dollar also, und bis die alle versoffen sind, mit der Rente dazu, werden wir hier Ärger haben. Ein Glück nur, dass Vater sehr freigebig ist und die geschmuggelte Scheiße sehr teuer. Dadurch wird das Geld schneller alle.«
»Stonehorn, ich habe Angst um dich.«
»Um mich brauchst du keine Angst zu haben. Um unser bisschen Habe, ja, denn das wird wohl in den nächsten drei Wochen draufgehen. Wenn er richtig besoffen ist, schlägt er alles kurz und klein. Und vielleicht kannst du um den Vater Angst haben … denn wenn er es nur ein einziges Mal wagt, dich anzugreifen, dann mache ich ernst.«
Queenie wollte nicht seufzen.
»Ich will dir sagen, wo ich heute war, Stonehorn«, begann sie fest.
»Ja?«
»Bei Mary Booth.« Queenie berichtete wörtlich, in nüchternem Ton, was gesprochen worden war. Sie fürchtete Stonehorns Zorn, aber sie wollte ihn mit keiner Silbe belügen.
Er schlug sich klatschend auf die Schenkel und lachte aus vollem Halse. »Mary! Ja, wahrhaftig, ich werde ihr den Cowboy machen und die Kälber einfangen. Sie ist ein resolutes Weib und hat mich einmal versteckt, als die Polizei mich suchte. – Tagsüber«, fügte er mit einem vorsichtigen Lächeln hinzu, als er das Mienenspiel seiner Frau beobachtete.
Aber Queenie hatte plötzlich begriffen, dass ein Rumtreiber wie Joe King mit seiner Betrachtung der Frau nicht gewartet hatte, bis er eine Queenie Halkett traf.
Sie blieb still.
In der Nacht lag sie wach, bis sie die Tritte und den schnaufenden Atem des Betrunkenen vor der Tür hörte. Stonehorn hatte die Tür abgeschlossen. Als der Vater das begriff, warf er sich mit einer solch wütenden Gewalt dagegen, dass er samt einigen zerberstenden Türbrettern ins Haus fiel. Der Sohn war auf, sprang hinaus und schleppte den über den durchschlagenden Erfolg seiner Anstrengung selbst Verblüfften und schwer Betrunkenen, ihn an den Füßen anpackend, auf die Wiese zurück, warf ihm zwei Decken über und kam wieder zu seiner Frau. Weiter geschah nichts. Der Betrunkene schien anzunehmen, dass die Decken sein Bett seien. Er wickelte sich ein und begann zu schnarchen.
Queenie wartete in den Armen ihres Mannes mit offenen Augen, bis endlich der kalte Wind der sich dem Ende neigenden Nacht durch die Türöffnung hereinwehte und die Dämmerung die Dunkelheit auflöste. Draußen saß der Vater auf der Wiese. Er hatte eine kleine Flasche Schnaps aus der Tasche gezogen, um sich zum Frühstück daran gütlich zu tun.
Stonehorn ging zu ihm. »Schämst du dich nicht, am frühen Morgen die Pferdepisse zu saufen?«
»Halt die Schnauze!« Der alte King wurde stets angriffslustig, wenn er getrunken hatte. Er warf die geleerte Flasche ins Gras, und da er nichts anderes vor sich hatte, was er angreifen konnte, warf er sich auf den Sohn.
Stonehorn hatte auf der Wiese Bewegungsfreiheit und schlug den alten King sofort k. o. Dann brachte er ihn in das Haus und legte ihn aufs Bett.
»Heute morgen wird er nichts mehr anrichten können. – Ich reite zu Mary hinüber. Vielleicht können unsere Pferde nicht nur hier, sondern auch drüben mit weiden.«
»Ja.« Queenie hatte keine rechte Stimme.
Als ihr Mann fortgeritten war, ging sie langsam zu dem verwilderten Friedhof hinüber und setzte sich zu dem Krummstab, an dem das Adlerfederbündel leise im Morgenwind schaukelte. Nirgendwo war ein Name angebracht.
Um die Mittagszeit kam der Alte wieder zu sich, und Queenie aß mit ihm zusammen ein Rübengericht. Er war ganz nüchtern und fing an, Queenie von der Geschichte des Tals und der Berge gegenüber zu erzählen.
Als er erkannte, wie aufmerksam sie zuhörte, nahm er die Decke von den verborgenen Gegenständen in der Ecke ab. Es kamen ein Adlerfederschmuck zutage und ein kostbar gestickter Rock. Der alte Mann hatte Lust, sich der Schwiegertochter darin zu zeigen. Er wirkte stolz und ausdrucksvoll. Mit einem verlegenen Lächeln setzte er die Adlerfederkrone wieder ab.
»Dein Großvater, Tashina«, sagte er, »war Ratsmann, als mein Vater Häuptling war. Von meinem Vater habe ich den Rock und die Adlerfedern. Du hast an seinem Grab gesessen, ich habe es gesehen.«
Er legte die Decke wieder über die behüteten Kostbarkeiten. »Inyahe-yukan könnte auch ein Häuptling sein, so jung er ist. Der, nach dem ihn seine Mutter genannt hat, hat schon mit zweiundzwanzig Jahren unsere Krieger geführt … aber nun muss Joe sich mit seinem betrunkenen Vater schlagen und für Mary Kälber fangen. Sie verstehen ihn alle nicht.«
»Warum glaubst du denn, Vater, dass Stonehorn Harold getötet hat?«
»Was? Es wäre wahrhaftig eine Schande gewesen, wenn er das nicht endlich zuwege gebracht hätte. Der Lump hat Stonehorn einen Dieb geheißen … einen Dieb! Damals haben sie den Burschen zum ersten Mal ins Gefängnis geworfen, und dann ist er ein Gangster geworden.«
Old King machte sich daran, die aus den Angeln gerissene schwere Tür wieder einzusetzen.
Am Abend kam Stonehorn gutgelaunt zurück. Er lud zwei große gefüllte Wassersäcke ab und pfiff vor sich hin, als er den Hengst auf die Wiese brachte. Er warf den vorsichtig lugenden Hunden Knochen hin und wickelte am Tisch in der gemeinsamen Stube ein großes Stück geröstetes Fleisch aus. »Gruß von Mary«, und er überreichte den Braten seiner Frau. Alle drei hieben ein. Nach dem Essen sangen King junior und King senior zusammen alte indianische Liebeslieder und schlugen dazu den Trommeltakt mit den Knöcheln auf der Tischplatte, die Queenie gescheuert hatte. Sie hatten beide schöne Stimmen.
Zu Beginn dieser Nacht gab es auch im Bett noch Gelächter, nachdem der alte King eingeschlafen war.
Vor Sonnenaufgang waren die beiden jungen Leute schon draußen am Hang, kümmerten sich um die Pferde, wuschen sich und ließen sich im Sommerwind trocknen.
»Kennst du Doctor Eivie?« fragte Stonehorn seine Frau. »Das ist der neue Arzt.«
»Nein, noch nicht.«
»Ein fetter, kleiner, lustiger Ball. Er hat uns beim Kälberbrennen geholfen, und er hatte eine Stoppuhr dabei. Ich habe die Zeiten gemacht.«
»Die Rodeo-Zeiten für das Kälberfangen?«
Stonehorn nickte.
»Willst du dich melden?«
»Nicht so schnell. Ich habe zu lange nicht mehr geübt. Und man müsste auch das Teilnehmergeld einzahlen können.«
Queenie ließ sich die aufgehende Sonne auf die braune Haut scheinen. Ihr Mann packte ihren Kopf mit beiden Händen.
»Queenie … Ich werde jetzt wenigstens fünf Tage und Nächte unterwegs sein. Eivie will mich auch noch bei anderen Herden dabeihaben. Du musst solange allein mit dem alten King aushalten.
Oder gehst du die paar Tage lieber zu … ja … vielleicht zu Ed Crazy Eagle? Seine Frau ist im Krankenhaus angestellt, und Eivie würde mit ihr sprechen.«
»Joe! Wir wollen in fünf Tagen mit Isaac Booth zusammen zu Chief Ed Crazy Eagle gehen, und er wird das Protokoll aufnehmen, dass der Pachtvertrag über unser Land am 31. Dezember endet. Du sollst nicht umsonst da drüben arbeiten.«
»Gut. Aber eben darum könntest du jetzt schon …«
»Ich will nicht. Ich bleibe hier.«
Stonehorn war nicht einverstanden, gab jedoch nach. »Wenn es zu arg wird, sattelst du dein Pferd und reitest zum Hospital. Das übrige wird Crazy Eagles Frau schon regeln.«
An dem ersten der fünf Tage schrieb Queenie vor allen Dingen einen langen, wohlformulierten Brief an den Vorsteher der Kunstschule, dass er das Bild »Verschleierte Hände« so rasch wie möglich und so teuer wie möglich verkaufen und das Geld an die Adresse von Elk in New City senden solle. Was nützten offene Hände auf einem Bild, wenn es darauf ankam, die lebenden Hände zu öffnen! Das Einsatzgeld für das Rodeo, das Geld für ein Auto und das Geld für zwei weitere Pferde musste beschafft werden.
Als Queenie zur Post geritten war und den Brief aufgegeben hatte, begann sie im Innern zu zittern vor Angst, ob der Interessent noch Interesse haben würde. Daheim tat sie dann die Hausarbeit. Der alte King war hilfsbereit und friedlich. Er ging auf die Jagd und schoss wieder einen Fasan. Die Zubereitung übernahm er selbst. Darum durfte sich Queenie nicht kümmern. Dagegen überließ er ihrer Kochkunst die Rüben und die Mehlspeisen, die ihm verhasst waren. So ging drei Tage lang alles gut. Am vierten kamen die ungebetenen Gäste.
Es begann schon am Morgen, als Patrick Bighorn und Goodman, die Alten, mit einem klapprigen Wagen den Wiesenweg heraufsteuerten und sich mit King senior im Hause niederließen. Queenie machte sich draußen zu schaffen; sie sah diese Gäste nicht gern, denn sie hatten etwas in ihren Augen, was an Trunksucht erinnerte.
Um die Mittagszeit tauchten noch zwei der Männer auf, die Stonehorn als »alte Brüder« bezeichnet hatte. Sie schauten etwas verlegen und verstohlen auf die junge Frau. Queenie ging ins Haus und fragte den Vater, ob sie etwas zu essen für sie bringen könne, aber sie erhielt nur den Bescheid, dass die Gäste sich selbst alles mitgebracht hätten, was nötig sei. Einer hatte rasch versucht, die Flaschen zu verstecken, die bei den Schlafgestellen standen, aber Queenie hatte schon gesehen, dass es genug waren, um auch hartgesottene Trinker unter den Tisch zu bringen. Sie wusste, dass sie völlig machtlos war, und bemühte sich nur, diesen und jenen Gegenstand noch in Sicherheit, das hieß aus dem Haus zu schaffen, ehe die Männer schon soviel getrunken hatten, dass es gefährlich war, ihre Aufmerksamkeit in irgendeiner Weise auf sich zu lenken. Sie wusste, dass sie tat, was Indianerfrauen seit Jahrhunderten hatten tun müssen, seit die Watschitschun, diese Geister, die sich weiße Männer nannten, den Alkohol nach Amerika gebracht hatten. Aus den Worten, die Queenie auffing, wurde ihr alles klar. Der alte King hatte sich einige Tage nicht sehen lassen, aber da die anderen wussten, wieviel Geld er etwa noch bei sich haben konnte, hatten sie auf seinen Kredit die Schmugglerware eingekauft und mitgebracht.
In den ersten Nachmittagsstunden wurde es schon laut im Haus, und neue Gäste trafen ein. Wenn man sich eng gedrängt zueinander hockte, fasste die Hütte eine Menge Leute.
Gegen Abend hörte Queenie krachendes Gepolter. Stonehorn hatte sein eigenes Jagdgewehr mitgenommen, aber die Waffe von King senior war im Haus. Das Poltern wurde von einem mächtigen Gebrüll abgelöst, dann schien die Hölle los zu sein.
Queenie lauschte, sie hatte sich an den oberen Hang zurückgezogen. Die Hunde jaulten.
Die Stute spitzte die Ohren. Queenie sattelte das Tier, damit es auf alle Fälle für sie bereit war. Im Grunde war sie froh, dass Stonehorn nicht zu Hause war. Er hätte sicher versucht, diese Männer hinauszuwerfen, und das wäre gefährlich für ihn geworden. Mochte die Habe draufgehen. An einen solchen Gedanken hatte sich Queenie schon gewöhnt. Wenn nur den Pferden und den Menschen nichts geschah.
Der Lärm kam aus dem Haus heraus, die Tür war aufgestoßen worden. Queenie ritt den Hang ein Stück aufwärts.
Mit den alten Wagen konnten die Betrunkenen ihr dahin nicht folgen, und ein Pferd hatte keiner von ihnen dabei.
Drei Männer flogen aus der Tür, hinter ihnen ertönte Hohngelächter, dann gab es ein neues Krachen und Poltern, und ein kämpfender Knäuel rollte heraus auf die Wiesen. Queenie konnte einige improvisierte Waffen erkennen, wahrscheinlich waren es die Tischbeine und Bretter der Schlafgestelle. Ein Schuss krachte, ein Kolben sauste, aber das störte keinen der betrunkenen Kämpfer mehr. Sie machten einen Höllenlärm und waren in voller Wut. Einige hatten schon blutige Köpfe.
Die Sonne war im Sinken. Queenie sah die ersten Messer blitzen. Sie hatte die Hand am Zügel. Wenn nur kein Totschlag geschah … nur das nicht … nur nicht jetzt die Polizei im Hause King.
Unten auf der Autostraße hupte ein Jeep. Da waren sie schon. Vielleicht hatte der Zufall gespielt, vielleicht hatten die Nachbarn die Polizei aufmerksam gemacht. Der Jeep bog auf den Seitenweg ein, der zum Haus und zu dem Knäuel Betrunkener führte. Die Polizisten sprangen schon halben Wegs aus dem Wagen und ließen diesen unter Bewachung zurück.
Dann kamen sie, die Pistolen in der Hand … zunächst zu Queenie herauf.
»Hallo! Junge Frau! Was sind das für Männer?«
Queenie blieb im Sattel. »Ich kenne sie nicht, sie sind einfach gekommen.«
»Wo ist Stonehorn?«
»Schon seit vier Tagen unterwegs.«
»Aha.«
»Nicht, was ihr denkt. Er ist beim Kälberbrennen mit Mary Booth und Doctor Eivie.«
»Wird sich ja zeigen. Und der alte King?«
»Mitten dazwischen … sie sind einfach gekommen und haben den Brandy mitgebracht …«
Der eiserne Ofen flog aus dem Haus. Es ging ein zweiter Schuss los.
»Lass uns warten«, sagte der eine der beiden Polizisten zu seinem Kollegen. »Die machen sich selber fertig, dann nehmen wir sie alle mit.«
Einer der Männer hatte sich auf einen andern geworfen und trommelte ihm mit der Faust in den Nacken. Der Kopf sank herunter. Zwei flohen zu ihren Wagen. Aber da wurden sie von der Polizei geschnappt. Durch einige Polizeigriffe wehrlos gemacht, verschwanden ihre Körper in dem Jeep.
Das Knäuel schien sich aufzulösen. Die Kämpfenden waren erschöpft. Das hätte bei dem Tempo und der Rücksichtslosigkeit der Schlägerei auch Jüngeren geschehen können. Die Polizisten sprangen jetzt hinzu, und es gelang ihnen mit überraschender Schnelligkeit, den beiden letzten Aufsässigen Handschellen anzulegen und die Widerstrebenden ebenfalls zum Jeep zu schaffen. Nur einer war nun noch am Kampfplatz.
Queenie hatte ihn erkannt. Sie stieg ab und ging langsam zu ihm hin. Der alte King lag ausgestreckt im Grase. Sie kniete sich zu ihm nieder. Ein Polizist kam mit einem Eimer Wasser und goss es dem scheinbar Bewusstlosen über den Kopf.
Old King öffnete die Augen mit Mühe, schaute Queenie erstaunt an und schien sie endlich zu erkennen.
»Kind …«, er lallte, aber nicht mehr aus Trunkenheit. »Mit mir … ist es … aus.« Er griff nach der Brust. Queenie erkannte den Einschuss. »Grüß … noch Joe … Inya … Inya …«
Der Sterbende wandte mit einer für ihn beinahe übermenschlichen Anstrengung noch einmal den Kopf zu dem Polizisten hin, der auf der anderen Seite stand. »Und … es ist keiner schuld … keiner … die Büchse … war nicht … richtig gesichert … ein Unfall. Hört ihr … es ist keiner … schuld … wenn der alte … Chief … jetzt stirbt. Komm einmal an mein Grab … Tashina …«
Die Augen des alten Mannes brachen. Queenie drückte ihm die Lider zu.
Der Polizist, der daneben stand, machte sich ein paar Notizen. Es war der kleine, der während des Verhörs die Pistole auf Stonehorn gerichtet hatte.
»Machen Sie sich keine Gedanken, Queenie King«, sagte er jetzt mit seiner etwas hellen Stimme. »Der Alte ist tot, es ist alles protokolliert, und Ihr könnt ihn begraben. Die anderen nehmen wir mit, und von denen wollen wir mal rauskriegen, wer den Brandy auf die Reservation schmuggelt. Ich hoffe, dass Ihr Mann damit nichts zu tun hat.«
»Er trinkt diese Pferdepi … überhaupt nicht«, fuhr es Queenie in ihrer übermäßigen Erregung heraus. »Er wollte auch den Vater immer davon abhalten.«
»So, so, es ist also öfter hier getrunken worden, auch ohne die Gäste.« Der Kleine machte sich noch eine Notiz. »Auf Trinken steht Gefängnis, das wissen Sie!«
Queenie verstummte.
Zwei Tage später saß der Superintendent Peter Hawley in seinem Dienstzimmer, und vor ihm, den Stuhl nahe an den Schreibtisch gerückt, hatte der blinde Richter, Ed Crazy Eagle, Platz genommen.
Runzelmann hatte verstanden, dass er nicht gebraucht wurde, und hatte den Raum verlassen. Die Sekretärin Laura warf einen beobachtenden Blick auf ihn, als er sich ihr gegenüber im Vorzimmer auf einem der Besucherstühle niederließ. Sie schrieb weiter auf der leisen elektrischen Schreibmaschine. Die Polstertür war schalldicht.
»Ja«, sagte der Superintendent zu dem jungen blinden Richter, »was Sie mir bis jetzt berichtet haben, Mr Eagle, war mir im wesentlichen schon bekannt. Es ist wieder einmal der verbotene Brandy hereingeschmuggelt oder auch verbotenerweise auf der Reservation selbst gebrannt worden. Es ist getrunken worden, es hat eine Schlägerei und einen Toten gegeben. Ein paar Männer werden einige Zeit im Gefängnis nüchtern sein. Solche Vorgänge spielen sich leider seit Jahrzehnten und immer wieder ab. Aber da Sie sich selbst zu mir herbemüht haben, scheinen Sie im gegebenen Fall weitere Zusammenhänge zu vermuten, über die Sie mich unterrichten wollen … auch abgesehen davon, dass sich das alles wieder einmal im Hause King abgespielt hat. Diese Familie hat offenbar ein hervorragendes Talent, Schwierigkeiten zu machen. Ich habe das schon den Akten meines Vorgängers entnommen.«
Crazy Eagle konzentrierte seine Gedanken auf den Tonfall des Superintendenten, da er dessen Mienenspiel nicht sehen konnte. »Die Polizei forscht nach, Sir, woher der Brandy in solchen Mengen kam. Es war nicht nur ein einzelnes Trinkgelage; es ist mehrmals im Übermaß getrunken worden, wahrscheinlich eben in diesem Kreise seit Jahren. Das erste hat Queenie King, das zweite hat Joe King zugegeben, der diesmal überraschenderweise die Aussage nicht verweigerte.«
»Worauf deutet das Ihrer Ansicht nach hin?«
»Dass er irgend jemanden bloßstellen will und auch bloßstellen kann.«
»Sogar auf die Gefahr hin, dass er selbst mit in die Grube fällt?«
»Ich glaube, dass Joe King in dieser Sache saubere Hände hat. Es geht um etwas anderes. Es könnte sein, dass er einen Stammesgenossen bloßstellen muss, wenn er etwas aufdecken will, und das ist bei diesen Familien nicht üblich. Es gilt sogar als eine Schande und ein Schwerstverbrechen.«
»Sie gehören nicht zu diesem Stamm hier?«
»Meine Frau gehört dazu, und ich bin als Mitglied aufgenommen und bestätigt worden, als wir heirateten. Es ist ungewöhnlich, dass der Mann die Stammesangehörigkeit der Frau annehmen darf.«
»Aber in diesem Fall ist es ein Glück. Auf welche Weise wollen Sie die Angelegenheit weiter verfolgen?«
»Wir können Miss Laura hereinholen?«
»Sie wollen zu Protokoll geben?«
»Vielleicht wird es nützlich sein.«
Der Superintendent drückte auf den Knopf, und Laura erschien.
»Laura«, sagte der Blinde betont, »es ist soweit … wir haben festgestellt, über welche Verbindungen der Brandy auf die Reservation geschmuggelt wurde. Da Sie selbst für das aufzunehmende Protokoll zu befangen sein dürften, rufen Sie bitte eine Kollegin, am besten Mrs Kate Carson …«
Laura stieß einen unartikulierten Laut aus.
»Sind Sie sich klar über das Verbrechen, bei dem Sie hier mitgewirkt haben!« schrie der Blinde das Mädchen an. Er konnte Laura nicht sehen, aber er hörte den stockenden Atem.
»Rufen Sie Mrs Carson, alles andere später. Sie warten dann im Vorzimmer.«
Laura ging. In ihrer Aufregung trat sie mit dem Pfennigabsatz schief auf, der Hacken brach ab, sie musste den Schuh vom Fuß ziehen und hinkend verschwinden.
Als sie draußen war, sagte der Superintendent: »Leider völlig eindeutig. Aber warten wir ab, was Mrs Carson sagen wird.«
Die blondierte, füllige, nicht unintelligente Vierzigerin war in zwei Minuten zur Stelle.
»Welchen Eindruck hatten sie eben von Laura?« fragte Hawley.
»Desolat. Was hat sie angerichtet?«
»Brandy geschmuggelt.«
»Um des Himmels willen! Aber ich hatte die Göre schon lange im Verdacht. Hätte ich nur früher etwas gesagt. Wo hatte sie nur immer das Geld her! Reiche oder unsolide Männer gibt es hier gar nicht. Und jetzt die Blamage für unsere Agentur! Das geht bis Washington. Es ist nicht auszudenken.«
Hawley sah Ed Crazy Eagle so scharf an, dass dieser die Energieschwingungen bemerkte, obgleich er blind war. »Vollkommen klar jetzt, wen der Besagte hereinlegen wollte … mich! Ich hatte kürzlich eine scharfe Auseinandersetzung mit ihm.«
»Was werden Sie tun, Sir?«
»Mich jedenfalls nicht ausgerechnet von diesem Burschen ruinieren lassen. An meinem Ansehen hängt das Ansehen unserer Verwaltung. Meine Sekretärin … das sind wir alle. Unvermeidlich. Also werden wir diese Sache nicht auf gerichtlichem Wege erledigen, sondern durch Verwaltungsmaßnahmen.«
»Ausgezeichnet«, lobte Kate Carson erleichtert.
»Laura wird auf eine andere Reservation versetzt. Ihre Verbindungen hier reißen damit automatisch ab, und ich benachrichtige meinen Kollegen dort, dass man ihr scharf auf die Finger sehen muss und sie nur in leicht kontrollierbaren, untergeordneten Tätigkeiten beschäftigen kann.«
»Einverstanden«, meinte Crazy Eagle. »Es hat auch keinen Zweck, sie zu bestrafen, denn das Übel wird dadurch nicht ausgerottet. Sicher hat sie nicht allein Schmuggelgeschäfte betrieben.«
Hawley zuckte zusammen, seufzte und lenkte ab. »Wodurch soll man dieses Übel überhaupt ausmerzen? Der Alkoholismus scheint ein im indianischen Nationalcharakter tief verwurzeltes Laster zu sein.« Peter Hawley wurde bei seinen Worten rot, denn er musste an einige seiner Vorfahren denken, die ehrenhafte Männer und Frauen gewesen waren, ebenso wie der Indianer Crazy Eagle, der ihm jetzt gegenübersaß. Aber Crazy Eagle, der nicht wahrnahm, wie die Schamröte dem Superintendenten von den Wangen bis zu den Schläfen stieg, blieb kühl bei der Sache.
»Mir scheint, Sir, es trinken zwei große Gruppen von Menschen im Übermaß, diejenigen, die bequem leben und Zeit verschwenden – seien es auch nur zwei Tage in der Woche –, und diejenigen, die elend leben und hoffnungslos. Zu den letzten gehören unsere indianischen Trinker.«
»Lassen wir die allgemeinen Erwägungen beiseite, Crazy Eagle, und entscheiden wir das, was in unserer Kompetenz liegt. Wie wird das Verfahren in der Sache King weitergehen?«
»Es wird gar nicht weitergehen, Sir. Mit Laura verschwindet es aus der Welt. Niemand wird Joe King einen großen Vorwurf daraus machen können, dass sein Vater getrunken hat … was übrigens unserer Mrs Carson schon seit fünfzehn Jahren und der ganzen Reservation noch viel länger bekannt gewesen ist.«