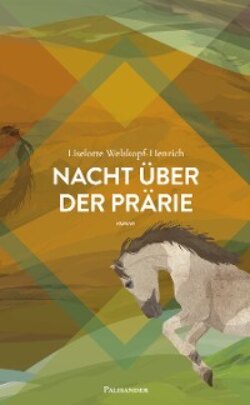Читать книгу Nacht über der Prärie - Liselotte Welskopf-Henrich - Страница 7
Begegnungen
ОглавлениеFür die letzte Strecke ihrer Reise hatte Queenie sich zum ersten Mal in ihrem Leben eine Flugkarte gekauft. Zwar hatte sie ursprünglich alles Geld des »Interessenten« ihren Eltern bringen wollen, aber dann war sie der Versuchung erlegen und hatte einige Dollars abgezweigt. Sie hatte ihre Flugkarte schon von der Kunstschule aus vorbestellt und den Eltern geschrieben, dass sie einen Tag früher in New City eintreffen werde. Zur elterlichen Ranch ging zwar keine Post, aber Queenie hoffte, dass ihr Bruder Henry in diesen Tagen, in denen Post von ihr erwartet werden konnte, zur Agentursiedlung ritt und auf dem Postamt nachfragte.
Nun saß sie in der Propellermaschine der Frontier Airlines, die in ihrem Namen die Erinnerung daran bewahrten, dass die Orte, die sie anflogen, vor noch nicht langer Zeit Grenzgebiet zwischen Wildnis und Zivilisation gewesen waren und in blutigen Jahren zum Wilden Westen gezählt worden waren.
Queenie hatte einen Fensterplatz. Tief unter ihr dehnte sich schon heimatliches Land, endlose Prärie unter dem Nachthimmel; nur hin und wieder erschien für das Auge der Zaun einer Ranch, noch seltener eines der einsamen Häuser. Die Sandfurchen an den Präriehügeln, in denen im Frühling und nach Gewittern das Wasser herunterschoss, lagen ausgetrocknet und gaben dieser Prärie, die schon seit Tausenden und Abertausenden von Jahren bestand, etwas Aufgerissenes, Bloßes und Wildes. Nur zweimal erkannte Queenie Gruppen schwarzer Punkte, das war schwarzes Vieh, und es waren Büffel, die wieder gezüchtet wurden, weil sie die Unbilden von Witterung, Sturm, Schnee, Hitze am besten überstanden, das karge, harte Gras, wenn nicht mit Lust, so doch ohne Widerwillen weideten und neben dem Fleisch das wertvolle Fell lieferten.
Queenie schloss die Augen, und für einen flüchtigen Augenblick wurde sie ganz Tashina. Sie träumte davon, wie Hunderttausende von Büffeln über die Hügel und Täler gezogen waren und Tausende von braunhäutigen Jägern das heilige Tier erlegt hatten, um Nahrung, Kleidung, Zelte zu gewinnen. Dann waren die Watschitschun gekommen, diese Geister in Menschengestalt, die sich Weiße nannten, und sie hatten mehr Wild erlegt, als sie brauchten. Mit ihren Repetiergewehren hatten sie die Büffelherden nicht gejagt, sie hatten gemetzelt. Tashinas Großväter hatten um ihr Land gekämpft, aber sie waren besiegt worden. Die weißen Männer hatten die Prärie, die Wälder, Berge und Flüsse geraubt. Sie hatten New City gebaut und der Erde das Gold aus dem Leibe gerissen. Die großen Häuptlinge waren gefallen, ermordet worden, gestorben, und von manchen kannten ihre Kinder und Kindeskinder nicht einmal das Grab. Die Nachkommen lebten nun auf dürrem Land, das man ihnen als Reservation übriggelassen und immer wieder beschnitten hatte. In allem mussten sie den weißen Männern, dem Superintendenten und seinen Beamten, gehorchen; für jeden Schritt brauchten sie die Erlaubnis und das Geld der weißen Männer; arm waren sie trotz aller Renten und verbrieften Verträge, und sie wurden gehalten wie Unmündige.
Auf Geheiß der weißen Männer aber besuchte Queenie die Kunstschule für Indianer. Sie wollte nicht undankbar sein, denn sie genoss dort, fern der Reservation, eine gute Ausbildung und ein gutes Leben. Aber sie wollte eine Indianerin bleiben, wie der Sprecher der Schüler bei der Schulabschlussfeier gesagt hatte, und sie wollte einmal denen helfen, die darbten.
Queenie wurde wieder wach.
Ein heller rötlicher Schimmer spielte durch ihre Lider, und als sie die Augen öffnete, sah sie unter sich die Prärie in dem Leuchten der hervorkommenden Sonne und in Richtung des Fluges schon die waldigen Berge, an deren Fuß die Gründer von New City sich vor einem Jahrhundert angesiedelt hatten. Autos fuhren, für den Blick von oben so klein wie Spielzeug, Schornsteine rauchten, Scheiben blitzten, Dächer zeigten ihre Konturen mit Licht und Schatten.
Queenie musste den Sicherheitsgurt anlegen, das Flugzeug setzte zur Landung an. Noch schwirrten die Propeller, das Flugzeug setzte auf und rollte aus.
Queenie hatte nicht gewusst, dass der Flug trotz einer Tornadowarnung vor sich gegangen war. Sie ahnte nicht, wie der Pilot jetzt aufatmete. Sie bedauerte nur ein wenig, dass der Flug schon zu Ende war. Als letzte der sieben Passagiere stieg sie aus, das Köfferchen in der Hand. Ihr Geld hatte sie in einem Brustbeutel verwahrt. Es war noch immer sehr viel. Die Eltern würden sich freuen.
Als Queenie frische Luft nicht nur durch den Filter bezog, sondern eingehüllt war von Staub und Wind, von dem Duft vertrockneter Erde und vertrockneten Grases, von einem Hauch wilder Kakteenblüten, wenn auch vermischt mit den Gerüchen der Stadt und der Motoren, da wusste sie auf einmal ebensoviel, wie der Pilot gewusst hatte: Es roch nach kommendem Sturm. Am blauen Himmel standen über den ziehenden Wolken unbewegliche Wolkenstreifen, und auf irgendeine Weise war die Atmosphäre gelb.
Queenie lief durch die Ein- und Ausgangshalle des bescheidenen Flughafens. Unter den wenigen Wartenden fielen ihr drei Gestalten auf von jenem Typ, den sie nicht gerne sah. Obgleich die Kerle still an der Wand lehnten und niemandem Aufmerksamkeit zu zollen schienen, fühlte sich das Mädchen von ihnen beobachtet. Sie wich nicht aus, schlug auch die Augen nicht nieder, sondern verhielt sich, als ob sie nichts Auffälliges bemerkt habe und nichts beabsichtige, als den Flughafen zu verlassen. Aber sie hätte, befragt, jeden der drei schon genau beschreiben können. Der kleinste, ein Weißer, mochte 1,78 m oder 1,80 m groß sein und etwa zwanzig Jahre alt. Er trug Bluejeans, wie es allgemein üblich war, und ein braunrot kariertes Hemd dazu, was nicht eben für Geschmack zeugte. Seine Stulpenstiefel waren von billigem Leder, aber reich verziert, sein Cowboyhut war fleckig, der Rand verbogen. Seine beiden Kumpane lehnten ebenso unbeweglich wie er an der Wand. Diese beiden waren Indianer. Ihre Kleidung war genau die gleiche wie die des Weißen, nur in den Farben unterschied sie sich. Sie hatten zu den dunkelblauen Hosen rot-blau karierte Hemden an.
Noch schlanker und um zwei Handbreit länger, wirkten ihre Figuren schlaksig. Die Haltung der drei war die von Menschen, die herumlungern und lauern. Der Weiße steckte sich eine Zigarette an, als Queenie an ihm vorüberging. In seinen Augen blitzte dabei etwas auf, was das Mädchen beunruhigte. Die beiden jungen Indianer verhielten sich scheinbar völlig gleichgültig.
Queenie war kein ängstliches Mädchen, doch war sie froh, als sie nach Verlassen der Halle schon den alten Ford ihrer Familie unter den wenigen parkenden Wagen stehen sah. Daheim hatte man also die Nachricht, dass sie mit dem Flugzeug und daher einen Tag früher in New City ankommen werde, rechtzeitig erhalten.
Der Wagen war eine alte Karre mit alten Reifen, mit hoher Karosserie, mit abgenutzten Bezügen. Er hatte einmal fünfzig Dollar gekostet, und nicht einmal das war er wert gewesen, denn er hätte verschrottet werden müssen, wenn der indianische Rancher ihn nicht gekauft hätte. Doch liebte Queenie dieses unansehnliche Gefährt.
Der Motor hatte noch nie gestreikt, und der Wagen hatte über furchenreiche Wege oder ganze ohne Weg schon halsbrecherische Touren gefahren. Queenie liebte ihn wie früher ein Indianer das struppige Reitpferd, das zäher war als alle glatt gebürsteten Dragonergäule.
Am Steuer saß Queenies sechzehnjähriger Bruder. Sie hatte ihn sofort erkannt und war sogleich entschlossen, ihm irgendeinen Schabernack zu spielen, denn er war in sich zusammengesunken und schlief offenbar so fest, dass er nicht einmal das Brummen der Flugzeugmotoren gehört oder bemerkt hatte, dass die Fluggäste aus der Halle kamen.
Queenie öffnete die Wagentür leise, setzte sich neben den schwarzhaarigen Burschen und stellte ihr Köfferchen auf den Rücksitz. Sie machte es sich bequem.
Henry schlief weiter.
Queenie erschrak plötzlich tief. In ihrer Freude, den Bruder zu treffen, mit ihm nach Hause zu fahren – und ihm vielleicht einen Possen zu spielen –, hatte sie ihren Wahrnehmungen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt; sie hatte sie nicht in Gedanken umgesetzt. Aber jetzt, am Platz neben dem Steuer, konnte sie es vor sich selbst nicht mehr leugnen: Der Bruder roch nach Alkohol. Er schlief offenbar einen sehr tiefen Rausch aus.
Noch nie hatte Henry getrunken. Queenies ganze Familie gehörte zu der Partei der Nichttrinker auf der Reservation und lag mit den Trinkern in Feindschaft. Wie war es möglich geworden, dass Henry …! Jetzt, an diesem Tag, an dem er den Wagen steuern musste. Woher hatte er das Geld bekommen? Wer … wer hatte ihn verführt?
Queenie saß einen Augenblick nicht nur stumm, sondern steif, wie gelähmt, auf dem abgenutzten Polster.
Den Indianern auf der Reservation war es verboten zu trinken. Wer hatte es gewagt, an Henry auszuschenken?
Am offenen Fenster der Wagentür erschien ein dunkles Gesicht über einem blau-rot karierten offenen Kragen.
»Lass mich ans Steuer, Queenie, ich fahre dich.«
Um die Mundwinkel spielte ein Zug, vor dem Queenie graute. Sie drängte den Körper des Bruders blitzschnell beiseite, ließ den Motor an, gab Gas, fuhr rückwärts und dann voran, was der Motor hergab. In der Morgenfrühe waren die Straßen noch leer.
Der ungebetene Gast am Wagenfenster hatte beiseite springen müssen, um nicht überfahren zu werden. Das war ihm nicht schwergefallen. Er war ein Bursche, der schnell zu reagieren verstand.
Queenie bog um zwei Straßenecken und horchte, ob sie von einem anderen Wagen verfolgt wurde.
Nein, es kam ihr niemand nach.
Sie verlangsamte auf dreißig Meilen.
Das Mädchen versuchte zu überlegen. Wenn irgendein Polizeibeamter bemerkte, dass ihr Bruder betrunken war, kam Henry ins Gefängnis. Indianer aus der Reservation wurden für Trunkenheit schwer bestraft.
Sie hielt an einer unbeobachteten Stelle an und schob Henry, der nicht aufwachte, auf ihren bisherigen Platz, so dass sie nun Raum für sich am Steuer hatte.
Das ging alles schnell. Aber nun rührte Henry sich auf einmal – und es bestand die Gefahr, dass er halbwach in seinem Zustand zu randalieren begann. Es war sein erster Rausch, und Queenie wusste vom Hörensagen, was ein Betrunkener anrichten konnte. Der Weg zur Reservation war noch weit.
Sie bog in eine Ausfallstraße ein und hielt auf die Vorstadt zu, wo die Slums der indianischen Kolonie lagen. Dort kannte sie einen jungen Priester, und diesen wollte sie um Rat fragen.
In den kleinen Hütten, wo die kinderreichen Familien wohnten, und ringsumher war in der Morgenfrühe schon Leben.
Die Frauen waren mit Eimern unterwegs, manche mit dem Wagen und Fässern, um von dem weit entfernten Brunnen Wasser zu holen. Die Leitung war nicht bis zu der Siedlung gelegt. Queenie hielt bei einer der Hütten. Die Kinder schauten neugierig und zugleich scheu auf sie, aber da Queenie eine Indianerin war und mit den Mädchen und Jungen in ihrer Muttersprache sprechen konnte, erfuhr sie bald, was sie wissen wollte. Der junge Priester und seine Frau waren zum Brunnen gefahren. Sie mussten aber bald wieder zurück sein.
Queenie brach der Schweiß aus, während sie wartete. Es war am frühen Morgen schon heiß, doch das war es nicht, was sie störte. Sie hatte Angst, einfach Angst. Der Alkoholgeruch, den der Körper des Bruders ausströmte, quälte sie.
Elk, so hieß der Gesuchte, kam bald zurück, doch dem Mädchen war die Wartezeit wie eine böse Ewigkeit erschienen. Er begriff sofort, was hier zu tun war, brachte Henry in sein Haus und bat Queenie, ebenfalls einzutreten. Sie verschloss den Wagen und steckte den Schlüssel ein, eine ungewöhnliche Vorsichtsmaßnahme.
Sie setzte sich mit der Frau in der kleinen Hütte auf das Bett, das zugleich die einzige Sitzgelegenheit bot, und berichtete alles, was sie erlebt hatte und vermutete. Elk stand in seinen abgetragenen Arbeitskleidern vor den Frauen. Den Betrunkenen hatte er einfach auf den Bretterboden gelegt.
Queenie beschrieb noch einmal genau die drei verdächtigen Gestalten. »Ich glaube«, schloss sie, »dass sie Henry beschwatzt und betrunken gemacht haben, und nun warteten sie auf mich. Wahrscheinlich hat Henry ihnen von mir erzählt. Vielleicht hat er ihnen auch gesagt, dass ich viel Geld nach Hause bringen würde.«
»Es sind üble Burschen.« Elk sprach langsam und war bemüht, seine große Besorgnis nicht in seiner Stimme spürbar werden zu lassen. »Die Kumpane von Stonehorn.«
Queenie senkte den Kopf und schaute zu Boden. Aber sie fühlte dabei, wie Elk sie von der Seite beobachtete, und sie senkte den Kopf noch tiefer, als ob sie einen Schlag in den Nacken entgegennehmen müsse und doch alle ihre Empfindungen verbergen wollte.
»Er war hier«, sagte Elk.
Queenie fuhr auf. Sie hatte vergessen, dass sie sich beherrschen wollte.
»Sie hätten ihn nicht hinauswerfen sollen, damals. Jetzt ist alles schwer – verzweifelt schwer.«
Queenie starrte Elk an.
»Er hat nach dir gefragt.«
Queenie sagte nichts. Aber sie dürstete danach, dass Elk mehr berichten werde.
Elk sah das glühende Gesicht. »Liebst du ihn, Queenie? Du warst damals, als er gehen musste, noch ein Kind – fast – ja, fast – noch – ein Kind. Seine Kumpane heute sind üble Burschen.«
Elk wiederholte die letzten Worte mit einer Härte, mit der er auch gegen sich selbst zu kämpfen schien.
Queenie verwandelte sich wieder. Sie glaubte Elk zu hassen, weil er gewagt hatte, von ihrem Gefühl zu sprechen. Wie schamlos waren alle Worte! Das Blut ging ihr zum Herzen zurück, sie wurde blass statt rot. Ihre Haltung und ihr Ausdruck wiesen darauf hin, dass sie um nichts besorgt sei als um ihren Bruder.
Elk verstand. Er glaubte wenigstens zu verstehen.
»Willst du hierbleiben, Tashina?«
Nahm er etwa an, dass Queenie Halkett auf Joe King warten werde?
»Ich bleibe nicht. Ich will heim.«
»Henry kannst du nicht mitnehmen.«
Das Mädchen zuckte hilflos mit den Schultern. »Kann ich das Geld hierlassen?«
»Du kannst Henry und das Geld hierlassen. Aber ich kann dich nicht fahren, und meine Frau kann dich nicht fahren. Wir müssen zur Arbeit gehen.«
»Ich fahre allein.«
»Das ist nicht gut, Tashina.«
»Ich kann hier nicht mit Henry sitzenbleiben. Der Vater muss alles erfahren, ehe es ein anderer hört. Ich fahre.«
Queenie stand auf.
Elk und seine Frau sagten kein Wort mehr. Mögen Wakantanka, das Große Geheimnis, und ihr Schutzgeist sie behüten, dachten sie. Sie waren Christen, aber sie dachten noch in den Worten und Vorstellungen ihrer Väter.
Queenie übergab Elk den Lederbeutel mit der hohen Geldsumme und räumte auch noch einen Teil ihres Köfferchens aus.
Dann eilte sie zum Wagen, der Motor sprang an, und sie fuhr auf die laute Weise, die dem alten Gefährt allein noch möglich war, die Landstraße bei der Siedlung entlang, dann auf einem Umweg zu der betonierten Straße, die um den Fuß der bewaldeten Hügel herum in Richtung der Reservation führte.
Weit und breit waren kein Wagen und keine Behausung zu sehen. Der Wind wehte kräftig.
Queenie dachte jetzt nicht mehr darüber nach, was die Banditen unterdessen unternommen haben konnten oder was sie planten. Sie beschäftigte sich nur mit Steuer und Straße, und sie holte alles aus dem Motor heraus, was herauszuholen war. Mehr als fünfzig Meilen die Stunde gab er nicht her.
Der Wagen bockte. Vielleicht war die Benzinleitung durch feinen Sand verstopft, vielleicht funktionierte eine Kerze nicht, vielleicht war die Batterie locker. Queenie konnte nur noch vorsichtig und langsam fahren.
Die Wolken am Horizont versprachen ein Hagelwetter. Ehe es herunterschlug und alle Sicht unmöglich machte, wollte das Mädchen noch zu einem bewohnten Platz. Es gab allerdings auf der ganzen Strecke nur einen einzigen, das Schaustellungsgelände »Crazy Horse«. Die Schaustellung war um diese Zeit noch nicht offen, aber da sie in den nächsten Kalendertagen eröffnet zu werden pflegte, war vermutlich schon ein Wächter da.
Queenie horchte auf ihren Wagen, fuhr langsam und stetig und beruhigte sich selbst, als sie das große Zeltstangengerüst und die Bretterwand erkennen konnte, die ein Fort darstellen sollte. Sie kam nicht mehr ganz heran, etwa dreihundert Fuß vorher blieb der Wagen stehen.
Queenie stieg aus, schloss ab, steckte den Schlüssel ein und ging mit ihren modern nachgeformten Mokassins schnell bis zu dem Gelände und der kleinen Bude, in der sie einen Wächter oder einen Pförtner vermutete. Die Tür war jedoch verschlossen.
Queenie wartete einige Zeit, da der Mann vielleicht einen Rundgang machte, und es zeigte sich, dass sie richtig vermutet hatte. Ein Mann von mittleren Jahren in Cowboykleidung erschien, und als er das Mädchen warten sah, steuerte er auf sie zu.
»Hallo!«
»Hallo! Versteht Ihr etwas von einem Wagen?«
Der Mann blinzelte das Mädchen an. »Von einem solchen Wagen wie dem dort? Na, wollen mal sehen. Aber Ersatzteile habe ich für den nicht.«
Queenie war ärgerlich, dass der Wagen ihres Vaters verächtlich gemacht wurde. Doch musste sie sich wohl oder übel freuen, dass ihr jemand helfen wollte.
Der Mann klappte die Motorhaube auf und erwartete von Queenie nichts weiter, als dass sie geduldig und ohne dazwischenzureden zusah, wie er Teilchen für Teilchen durchprüfte.
Die Benzinleitung war jedenfalls verstopft. Der Mann pustete durch. Das Kabel, das die Batterie verband, war auch locker.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Wer da zuletzt an dem Motor war … hat ihn wohl mehr in Unordnung gebracht als in Ordnung.« Er schaute mit einem vorwurfsvollen Blick auf Queenie.
In Queenie stieg auf einmal ein Verdacht auf. Wenn diese Banditen in der Zeit, in der ihr Bruder schon betrunken war, sich an dem Motor zu schaffen gemacht hatten …?
»Ist noch ein weiterer Schaden zu finden?« fragte sie schüchtern.
»Scheint nicht. Also gute Fahrt.« Der Mann klappte die Motorhaube wieder zu. Queenie fuhr vorsichtig an. Der Motor gehorchte wieder.
»Stop«, befahl jedoch der Mann, als er umherschaute. »Es geht los. Das warten Sie hier ab.«
Queenie wusste, was er meinte, denn die ersten Hagelkörner prallten bereits auf die Scheiben. Sie blieb im Wagen, der Mann sprang in seine Bude. Das Unwetter prasselte mit der Gewalt herab, die für das Indianermädchen nichts Neues war. Wasser und Hagel schlugen und klatschten. Es war durch die Scheiben nichts mehr zu sehen, auch der Scheibenwischer konnte dem Wasser und Hagel nicht mehr Herr werden. Wie blind saß Queenie auf ihrem Führersitz und hörte das Heulen, Klatschen, Prasseln des mächtigen Unwetters, das nahezu auch das Gehör verschlug.
Als die Panne eintrat, hatte sie ihren Wagen noch etwas zur Seite fahren können, etwa anderthalb Meter, so dass er nicht vom Verkehr gefährdet war. Es zeigte sich, dass sie damit Glück gehabt hatte. Denn in dem dunklen, regentrüben Wetter raste jetzt ein anderer Wagen mit hoher Geschwindigkeit an dem ihren vorbei. Sie hatte das Gefühl, dass eine Gefahr an ihr vorübergezogen war, und wartete mit Ruhe, bis das Wetter sich ausgetobt hatte.
Der Mann in der Cowboykleidung schaute aus seiner Bude heraus und nickte noch freundlich hinterher, als Queenie mit ihrer alten Karosse in einen immer sanfter werdenden, bald ganz nachlassenden Regen hineinfuhr und auf der nassen Straße sicher steuerte.
Nach dieser Begegnung konnte Queenie erst wieder Menschen treffen, wenn sie die Agenturgebäude erreichte, von denen aus sie dann noch viele Meilen bis zu der väterlichen Ranch zu fahren hatte. Das Land war öde und leer.
Queenie wagte nicht mehr, ein hohes Tempo aufzunehmen. Sie fuhr fast gemächlich auf der einsamen Straße, die durch die Prärie führte, vorbei an Bachbetten, in denen plötzlich wieder Rinnsale flossen, vorbei an den abgestorbenen Bäumen, die der Winter mit Sturm und Kälte getötet hatte, über eine kleine Brücke mit dem Blick auf einen Zaun, der ein Ranchgelände abgrenzte. Vieh war nicht zu sehen. Es hatte vor dem Unwetter in den Bodensenken Schutz gesucht. Das Hagelwetter schien nur ein Vorbote weiterer Stürme gewesen zu sein. Queenie schaute nach dem unheilverheißenden Horizont. Ein Fasan kreuzte die Straße. Die Tiere einer verlassenen Fasanerie hatten sich auf der freien Prärie fortgepflanzt. Das Mädchen hatte rücksichtsvoll gebremst.
Der Motor stotterte erneut. Queenie fuhr noch langsamer. Aber da so lange alles gut gegangen war, ließen sich ihre Nerven nicht mehr aufstören. Die Agentur war schon nahe.
Am späten Nachmittag lenkte Queenie in die Straße mit den Vorgärten, den Einfamilienhäusern und den einstöckigen Bürohäusern ein, in denen der Superintendent und seine Verwaltung sowie der Stammesrat und das Stammesgericht arbeiteten. Jetzt waren die Büros allerdings schon geschlossen. Die Straße lag fast leer. Zwei Fußgänger verschwanden auf Nebenwegen. Queenie hatte nicht erkannt, wer es war.
Als Queenie mit ihrem Wagen an dem kleinen Laden mit dem vielverheißenden Namen »Supermarkt« vorbeikam, meldete sich ihr Hunger, und sie erinnerte sich, dass sie etwas Geld bei sich trug. So hielt sie an, schloss den Wagen wieder ab, steckte den Schlüssel zu sich – alles dies mit mehr Bedacht als sonst – und trat ein. Außer ihr befanden sich nur noch drei Kunden in dem Selbstbedienungsladen. Sie nahm einen der Einkaufswagen, fuhr damit um den einzigen Warenstand herum, bewunderte leckere Dinge und kaufte schließlich etwas tiefgekühltes Fleisch für Eltern und Geschwister und ein Päckchen Vollkornbrot für sich selbst. Als sie bezahlte, begrüßte die Kassiererin sie offensichtlich erfreut. Queenie kannte die Frau an der Kasse flüchtig von früheren Einkäufen her. Sie war eine Weiße, allerdings nur beinahe eine Weiße, da sie ein paar Tropfen Indianerblut in den Adern hatte.
Als Queenie sich zum Gehen wandte, stockten ihr plötzlich die Glieder. Sie konnte für eine Sekunde nichts wahrnehmen und nichts denken. Als sie wieder bei sich war, erkannte sie durch die große lichte Scheibe hindurch die Gestalt von Joe King, genannt Stonehorn. Er schaute nicht in den Laden hinein, sondern am Laden vorbei nach Osten, wo die Straße auf einem Hügel zu enden schien und der Himmel darüber schon dunkelte. King musste in dem Hagelwetter draußen gewesen sein, denn seine schwarzen Jeans waren bis über die Knie nass, das weiße Hemd war klatschnass und klebte am Körper, und nass war auch der Cowboyhut.
Da es auffällig gewesen wäre zu zögern, verließ Queenie mit ihrem Päckchen den Laden und ging schnell auf ihren Wagen zu. Da geschah genau das, was sie aus innerer Verwirrung hatte vermeiden wollen.
Joe King hatte sich umgewandt. Er kam auf sie zu, sagte »Hallo!« mit der Stimme, die sie seit ihren frühen Schuljahren kannte und nie vergessen hatte, und schien einen Augenblick zu warten, was sie nun tun werde. Das Blut schoss ihr in die Wangen, denn es machte sie verlegen, von Joe King angesprochen zu werden. Die Kassiererin – mindestens die Kassiererin – beobachtete diese Begegnung, und vielleicht glaubte sie, Queenie habe das so eingerichtet.
»Hallo!« antwortete Queenie scheinbar leichthin.
Joe King mit seinen merkwürdigen Augen aber zwang sie zu einem antwortenden Blick, und in diesem Blick lag alles von einsamer Weite und unschuldigem Kindertraum, von Geheimnis und Mitwissen und auch von Bekenntnis des Gefühls, was in Queenie geschlafen hatte und doch nicht erstorben war.
Joe King lächelte ein wenig, mit jener Überlegenheit, die Queenie schon als Kind bis aufs Blut gereizt und doch stets von neuem angezogen hatte.
Nun musste es wohl geschehen – denn es war durchaus nicht unvorbereitet, und Queenie begriff diese Seite der Sache sofort –, dass von jenseits des Fahrdammes ein zweites »Hallo!« erklang, von einer breiten Stimme getragen. Wenn Queenie hätte tun können, was sie am liebsten getan hätte, so hätte sie irgendeinen Riesen gezaubert, der die beiden jungen Männer mit ihren harten Schädeln aneinanderstieß oder ihnen auch kaltes Wasser über den Kopf sprühen ließ, bis sie zu dem kamen, was Queenie als Vernunft zu bezeichnen pflegte. In Ermangelung eines solchen Zauberriesen tat sie, als habe sie nicht begriffen, dass auch dieses zweite Hallo ihr galt. Sie huschte zu ihrem Wagen, schloss etwas ungeschickter und umständlicher auf als sonst, schob sich auf den Fahrersitz, warf das Päckchen neben sich und startete, so schnell der alte Wagen es eben erlaubte. Als sie auf höhere Beschleunigung ging, schaute sie doch noch für einen Moment zu Joe King zurück. Es schien ihr, dass er sie verachtete und vollständig abtat ob ihres albernen Teenagerverhaltens. Der Wagen machte einen Sprung. Sie bekam kühle Hände und musste fest zupacken, um nicht zu zittern.
Was sie gemacht hatte, erschien ihr jetzt falsch. Sie hätte sich selbst zerreißen mögen. Entweder hätte sie für Joe Partei nehmen müssen, so einfach und ohne alle Scheu, wie sie es als Kind einmal getan hatte. Oder sie musste sich verhalten wie eine Häuptlingstochter, die wusste, dass man kein Schauspiel vor anderen Leuten gab … die wusste, dass man das eine Hallo so ruhig und selbstverständlich beantwortete wie das andere. Aber sie war nicht rund und nicht ausgeglichen, wie Ella behauptet hatte, oder war vielleicht der Ring, der alles zusammenhielt, zerbrochen? Ihr Denken und Fühlen zuckte, kräuselte sich und schlug gegeneinander wie Wasser unter streitenden Winden. Sie erinnerte sich daran, was Elk zu ihr gesagt hatte. Das … das … das sind die Kumpane … von Joe … King.
Queenie fuhr den Hügel hinauf, hinter sich die Sonnenscheibe, die im gelben Dunst schwebte. Steil ging es wieder hinab, dann linker Hand in den Weg hinein, der schon nicht mehr als Straße bezeichnet werden konnte. Das Mädchen musste Willen und Gedanken wieder auf das Steuer konzentrieren. Haufen von Hagelkörnern lagen noch in den tiefen Wegfurchen. Das Gras flatterte unter den Böen, die langstieligen Blütenkolben der Yucca spielten frech im Wind. Ausgetrocknete Büsche, ohne Blätter, mit den Wurzeln ausgerissen, tanzten mit dem Staub über das Gelände. Das alles war Queenie vertraut gewesen, aber heute erschien es neu, angreifend und gefüllt mit Rätseln, die wie schwarze Kerne aus Fruchtkapseln hervorkommen und sich verbreiten konnten, um neue Rätsel hervorzubringen.
Der Motor gehorchte überraschend gut. Queenie fuhr, wie sie auch zu reiten pflegte, mit leichter Hand steuernd, mit raschem Ruck, mit genau berechneter Wendung, wenn ein Hindernis auftauchte. Diesen Weg zu fahren, auf dem sich Queenie jetzt befand, bedeutete eine Art von Artistenkunst. Sie war mit vierzehn Jahren eine solche Artistin am Steuer geworden. Ohne solches Geschick konnte man von der Ranch nicht mit dem Wagen zur Schule oder zur Agentur kommen. Es war eine durchschnittliche mittlere Fähigkeit des modernen Prärie-Indianers, sagte sie vor sich hin, als ihr Ella und das Gespräch am Abschiedsmorgen des Ferienbeginns wieder einmal einfielen. Queenie gewann ihre Selbstsicherheit zurück, die sie nach ihrer Begegnung mit Joe King verloren zu haben fürchtete. Sie besaß die Fähigkeiten, die hier gebraucht wurden.
Der Sturm heulte plötzlich auf. Es wurde finster, und das Mädchen brach alle Gedanken ab. Sie war schon zu weit von der Agentur entfernt und dem Haus des Vaters noch nicht nahe genug, um von irgendeinem Menschen Hilfe erwarten zu können. Jetzt galten nur noch der Sturm und das baumlose Land und ein bisschen Leben, das sich behaupten wollte.