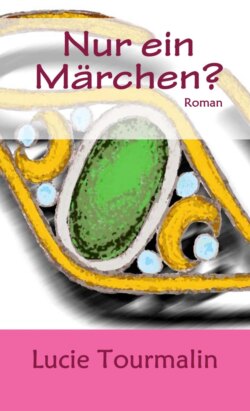Читать книгу Nur ein Märchen? - Lucie Tourmalin - Страница 4
Samstag
Оглавление„Ach Hilda, Darling, komm schon. Wir werden eine Menge Spaß haben, wir gehen shoppen, wir werden lecker essen und ein wunderschönes Hotel haben. Das Wetter soll wirklich great sein. Wir spazieren am Rhein, wir essen mittags Eis und abends Pizza. Ich führe dich jeden Abend schön aus, du kannst deine ganzen schicken Klamotten und Schuhe mitnehmen und damit so richtig angeben. Come on. Lass mich nicht noch mehr betteln. Wenn du mich sehen könntest, dann wüsstest du, dass ich auf dem Boden knie!“ George, der seit Minuten heftig auf mich einredet, macht plötzlich eine erwartungsvolle Pause.
Ich wette, er drückt den Hörer jetzt ganz fest ans Ohr, um bloß nicht zu verpassen, was ich sage.
„George, ich weiß nicht. Ich hab‘ noch unheimlich viel zu tun…“, entgegne ich zögernd. Und das ist nicht einmal eine faule Ausrede, weil ich keine Lust habe, ihn zu begleiten. Nein, ich habe wirklich viel zu tun.
George holt tief Luft. Ich kann ihn förmlich vor mir sehen, wie er in seiner luxuriös eingerichteten Designerwohnung sitzt, ein ernstes Gesicht aufsetzt und zum entscheidenden Schlag ausholt.
„Hilda“, beginnt er in genau dem Tonfall, den ich erwartet habe. „Honey, niemand arbeitet so hart wie du. Niemand hat diese kleine Auszeit mehr verdient als du. Please, I want you to come with me.“
Gegen meinen Willen muss ich lachen, kann die Fassade der Teilnahmslosigkeit nicht mehr aufrechterhalten. George, der, obwohl er aus London stammt, ein perfektes Deutsch spricht, gefällt sich sehr darin, ständig englische Wörter in seine Sätze einzubauen. Er findet das charmant – charming – und wenn er besonders charmant sein will, dann lässt er eben auch mal ganze Sätze in seiner Muttersprache in die Unterhaltung einfließen.
„Na gut“, seufze ich ergeben, „was soll’s. Ich rufe gleich Tina an und kläre mit ihr, ob ich die nächste Woche frei machen kann. Überstunden habe ich genug. Und dann komme ich mit dir nach Worms.“
Worms. Wie das schon klingt. Gibt es nicht ein Computerspiel, das auch so heißt? Worms. Das klingt richtig nach Langeweile, nach Trostlosigkeit. Eine ganze Woche, was soll ich denn da? Aber vielleicht hat George Recht und ein bisschen Abstand wird mir guttun. Die Frage ist nur: Abstand – wovon?
„You’re great!“, jubelt George und unterbricht meine Gedanken. Na wenigstens einer, der sich freut. Wir vereinbaren, uns später noch bei mir zu treffen, und legen auf.
Agnes, meine Chefin, erscheint plötzlich wie aus dem Nichts neben mir – sie ist gut darin – und sieht mich stirnrunzelnd an – auch das kann sie gut.
„Was hatten wir über private Telefonate während der Arbeitszeit vereinbart?“, fragt sie mich mit vorwurfsvoller und gezierter Stimme. Schon allein diese Frage! Was hatten wir doch gleich vereinbart?
So eine dumme Kuh. Sie könnte auch einfach sagen, dass ich nicht telefonieren soll, das ist nämlich die Vereinbarung. Oder vielmehr die Anordnung. Der Befehl.
Ich senke scheinbar zerknirscht den Kopf und murmle: „Tut mir leid, kommt nicht wieder vor.“
Agnes schüttelt den Kopf wie ein Pferd, das eine lästige Fliege verscheuchen will.
„So, jetzt pack dein Handy weg und hilf Sonja mit den Salaten.“ Sie benutzt ihre Ich-bin-hier-nur-von-Kleinkindern-umgeben-Stimme und klingt, wie eigentlich fast immer, ungeheuer herablassend. Ich stopfe mein Handy in die Schürzentasche und gehe zur Salatbar, nicht ohne insgeheim eine wahre Kanonade an Schimpfwörtern auf sie abzufeuern.
Während ich die Salate zubereite – einen kleinen italienischen Salat, zweimal großer Salat mit Hähnchenbruststreifen und einmal Tomate-Mozzarella – denke ich über meinen Job nach. Oder besser gesagt, meine beiden Jobs. Und weil Studieren auch irgendwie als Arbeit zählt – man gibt schließlich als Berufsbezeichnung „Student“ an – sind es eigentlich drei Jobs. Und ich kann gar nicht sagen, welcher der drei Jobs mich mehr nervt. Vermutlich immer gerade der, mit dem ich mich im Moment beschäftige. Bin ich an der Uni, finde ich das am nervigsten, bin ich in Tinas Laden, denke ich, das sei der schlimmste meiner Jobs, und bin ich hier – das Schema sollte jedem klar sein.
Nach dem Abitur hatte ich große Pläne, wollte unbedingt in die Medienbranche. Ich sah mich selbst als die neue Anna Wintour – die Chefin der amerikanischen ‚Vogue‘. Oder als Carrie Bradshaw, ja, die aus ‚Sex and the City‘. Nur wie wird man Anna Wintour oder Carrie Bradshaw? Gut, blond war ich schon von Geburt an, aber ob das allein schon reicht? Eher nicht.
Ich entschloss mich zum Studium der Germanistik. Kann ja nicht schaden, wenn man gut deutsch kann, und Medienwissenschaften hatte eine Zulassungsbeschränkung, da kam ich mit meiner mittelprächtigen Abiturnote einfach nicht rein. Blauäugig wie ich damals war – und damit meine ich nicht meine Augenfarbe, die ist nämlich braun – ging ich davon aus, dass man mit einem Magister in Germanistik einfach alles machen könne, dass einem die Welt quasi zu Füßen läge.
Bald merkte ich, dass man möglichst früh sozusagen einen Fuß in die Tür der Medienbranche bekommen muss. Am besten hätte man schon in der Schülerzeitung der Grundschule mitgearbeitet und als Schüler beim Radio oder besser noch bei einem Fernsehsender gejobbt. Leider hatte ich all dies versäumt und musste dann feststellen, dass keine der von mir angeschriebenen Zeitschriften Interesse an meiner Bewerbung hatte – wegen fehlender Vorkenntnisse.
Das Problem war, ich konnte mir auch keine „Vorkenntnisse“ mehr nachträglich aneignen, da ich bei der Finanzierung meines Studiums größtenteils auf mich selbst angewiesen war. Meine Eltern unterstützten mich natürlich so gut es ging, aber ohne mir etwas dazu zu verdienen, hätte es vorn und hinten nicht gereicht. An die guten, die bezahlten, Nebenjobs in der Pressewelt kam ich nicht heran und für die unbezahlten Praktika fehlte mir die Zeit. Ein Teufelskreis.
Ich streue großzügig die Käsemischung aus gehobeltem Gouda und Mozzarella in die Salatschachteln und mir wird klar, dass ich jetzt schon seit fünf Jahren diesen Job bei „Pizza-Pasta-Pronto“ habe, dem bekanntesten Pizza-Service der Stadt.
Eigentlich ist es kein schlechter Job, aber mit Mitte-Ende zwanzig wollte ich eigentlich in einem großen Loft wohnen, ein schickes Auto fahren, teure Designerkleidung tragen und einen weit verbreiteten Ruf als stilsichere Modeikone haben.
Das war der Plan, welchen Buchstaben ich diesem Plan verpasst hatte, weiß ich nicht mehr, irgendetwas zwischen Plan D und Plan L wird es wohl gewesen sein. Ach ja, und natürlich wollte ich schon längst meine eigene, erfolgreiche Modezeitschrift leiten, das war essentieller Bestandteil von Plan E, H, K oder wie auch immer.
Thema Mode, das bringt mich zu meinem anderen Nebenjob. Vor ein paar Jahren überlegte ich mir, dass es nicht schaden könnte, mir eine Arbeit in der Modebranche zu suchen, außerdem war gerade wieder das Geld knapp. Doch auch hier konnte ich lediglich eine schlecht bezahlte Stelle als studentische Aushilfskraft bekommen, auch hier gab es für jemanden ohne besondere Qualifikationen keinen Posten als Chefeinkäuferin – nur um mal ein Beispiel dessen zu nennen, was ich gerne gemacht hätte.
Besser Verkäuferin als gar nichts, Hauptsache einen Job in der glitzernden Modewelt ergattern, dachte ich mir. Es stellte sich dann jedoch schnell heraus, dass das Aufräumen von Umkleidekabinen und das Zusammenfalten zerknüllter Shirts weit weniger glamourös war, als ich mir das zuerst vorgestellt hatte.
Da hänge ich nun. Trage eine knallrote Schürze mit der neongelben Aufschrift „Pizza-Pasta-Pronto“, bereite Salate zu, sortiere Kleidungsstücke auf die richtigen Kleiderbügel und habe mit meinen beiden Jobs einfach nicht die Zeit, meine Abschlussarbeit zu schreiben. Mehr brauche ich eigentlich nicht mehr, dann ist mein Studium beendet. Aber ich habe Angst davor, wie es danach weitergehen soll. Mir fehlt ein Plan.
Zu meiner größten Verzweiflung muss ich gestehen, dass ich noch nicht ein Wort geschrieben habe, das es Wert wäre, an irgendeine Zeitschrift geschickt zu werden. Es sieht wohl eher so aus, dass ich nach Abschluss des Studiums weiter Gelegenheitsarbeiten machen werde, da ich einfach nicht weiß, was ich sonst machen soll. Taxifahrerin könnte ich sicher auch noch werden, oder Raumpflegerin.
„Hilda!“ Agnes steht schon wieder neben mir und unterbricht meine Grübelei. Dabei fällt mir auf, dass niemand meinen sowieso schon ungeliebten Namen so abwertend aussprechen kann wie sie.
„Warum dauert das denn heute so lange? Sind die Salate fertig?“
„Ja, äh, hier, bitte“, stammle ich mit rotem Gesicht. Auweia. Heute schon der zweite Anpfiff von der Chefin. Die Chefin. Wie das klingt. Agnes ist zwei Jahre jünger als ich, aber sie hat ihr Studium schnell absolvieren können, da ihr Vater alles bezahlt hat. Die Wohnung, die Gebühren, die Auslandsaufenthalte und den roten Mini-Cooper. Sie hat Betriebswissenschaften studiert und ist dann sofort als Filialleiterin bei „Pizza-Pasta-Pronto“ eingestiegen. Entsprechend hochnäsig behandelt sie mich, da ich außer zwei Jahren mehr Lebenserfahrung nichts vorweisen kann.
„Ach, und was habe ich eben bei deinem unerlaubten Privatgespräch mitbekommen? Du planst eine Urlaubsreise?“ Sie spricht total geziert, was mich wiederum total ärgert.
„Nein, Urlaub ist das falsche Wort. Mein Freund George, du weißt schon, der Dozent an der Uni, macht eine Exkursion mit einem seiner Seminare. Und er hat mich gebeten, ihn zu begleiten.“ Ich weiß zwar nicht, warum ich ihr gegenüber Rechenschaft ablegen sollte, aber andererseits will ich das sowieso schon angespannte Verhältnis zwischen uns nicht durch unnötige Zickereien verschlechtern.
„Aha.“ Wie viel Verachtung doch in einem Wort stecken kann! Und schon wünschte ich, ich hätte ihr einfach nicht geantwortet.
„Und wann wolltest du mich darum bitten, Samstag und Sonntag frei zu bekommen?“ Ah, daher weht der Wind. Sie nimmt eine affektierte Haltung ein, die sie sich wahrscheinlich bei Kleopatra aus dem Film ‚Asterix und Kleopatra‘ abgeguckt hat. Nur leider fehlt ihr die nötige Anmut, um eine solche Haltung glaubhaft und mit Würde rüberbringen zu können.
„Ach, da mach dir keine Sorgen, wir fahren morgen los, ich hab‘ ja die Frühschicht, und wir starten danach. Und wir kommen nächsten Samstag zurück, aber vormittags. Da ich dann die Spätschicht habe, brauche ich keinen freien Tag“, erkläre ich ihr gespielt fröhlich.
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sie niemals merken zu lassen, dass ich mich wegen ihres Gehabes und Getues tatsächlich manchmal nutzlos und als Loser fühle. Immer den Schein wahren, das ist das Wichtigste im Umgang mit solchen Schnöseln. Zu meinem größten Leidwesen gelingt mir das nicht immer, aber ich arbeite daran.
Agnes schnaubt und geht in ihr Büro. Dann, als sie schon fast aus meinem Blickfeld verschwunden ist, dreht sie sich wieder zu mir um.
„Ja und übrigens, Hilda“, sagt sie zuckersüß, „wie oft muss ich dir denn eigentlich noch sagen, dass du keinen Schmuck bei der Arbeit tragen sollst? Das ist unhygienisch!“
Ich streife ertappt meinen Armreif ab und stecke ihn in die Tasche meiner Schürze.
„Und dann auch noch so furchtbaren Modeschmuck.“
Das ist dann zum Glück das vorerst Letzte, was ich von Agnes hören muss. Trotzdem ärgere ich mich über ihre Hochnäsigkeit. Dieser Armreif ist sicher nicht so exklusiv wie das Armband von Cartier, das ihr Vater ihr zum bestandenen Abschluss geschenkt hat, aber er ist auch kein billiger Modeschmuck. Ich habe ihn von meiner Oma Gerda geschenkt bekommen, und die hat ihn auch schon geerbt.
Ich lasse die Hand in die Tasche meiner Schürze gleiten und streiche versonnen über die Konturen meines Lieblingsschmucks. In der Mitte befindet sich ein großer, grüner Stein, der warm schimmert. Eingefasst ist er mit einem Ring aus Silber. Dieser klemmt oben und unten zwischen zwei goldenen Bögen, die rechts und links zusammenlaufen. Zwischen den Bögen und dem silbernen Ring ist auf jeder Seite eine kleine, goldene Mondsichel angebracht, die von jeweils drei weiß glänzenden Steinen umgeben ist. Je nachdem, wie das Licht darauf fällt, funkeln die Steine so schön wie echte Diamanten. Modeschmuck – pffft. Wertvoll oder nicht – mir bedeutet dieser Armreif viel und ich trage ihn fast immer.
Komplett in Gedanken versunken und von weiterer Kritik verschont, verbringe ich den Rest meiner Schicht mit der Zubereitung von Salaten, die uns dank des warmen Wetters geradezu aus den Händen gerissen werden.
Zu Hause angekommen, denke ich kurz darüber nach, dass ich mich bei Tina im „Modern Fashion Store“ für nächste Woche abmelden muss, aber ich will jetzt erst einmal meine Ruhe haben und beschließe, ihr später eine E-Mail zu schreiben.
Ich ziehe die Schuhe aus, tolle Ballerinas, die auch nicht ganz billig waren und super aussehen, aber leider vorne sehr eng sind und an den Zehen drücken. Seufzend lasse ich mich auf die Couch sinken, wackele mit den befreiten Zehen und schalte den Fernseher ein.
Prima, die ‚Gilmore Girls‘. Die Kaffeesucht von Lorelai und ihrer Tochter Rory erinnert mich daran, dass ich selbst noch keinen Kaffee hatte. Aber ich bin jetzt zu faul, um aufzustehen. Lorelai, Lorelai… Ich wiederhole den Namen in Gedanken und mir wird schlagartig bewusst, dass ich schon seit Tagen nicht mehr an meiner Magisterarbeit weitergeschrieben habe. Die Loreley, ihre Darstellung in der Literatur vom Mittelalter bis heute und ihre Bedeutung innerhalb des Gefüges der Sagengestalten am Rhein. So lautet der hochtrabende Titel meiner Abschlussarbeit, den ich ausgewählt habe, bevor mir klarwurde, dass mich die „Sagengestalten am Rhein“ doch recht wenig interessieren.
Vielleicht gehe ich mir doch lieber eine Tasse Kaffee holen, damit ich nicht weiter über die Loreley grübeln muss. Ich erhebe mich schweren Herzens von der Couch und schlurfe barfuß in die Küche, als ich plötzlich ein Poltern höre.
„Hallo? Emily?“, rufe ich. Emily ist meine Mitbewohnerin und sollte eigentlich übers Wochenende auf einer Konferenz in Berlin sein. Keine Reaktion. Ich warte noch einen Moment, aber ich höre nichts mehr. Schulterzuckend gehe ich zur Kaffeemaschine. Das Geräusch kam wohl doch von oben aus Eriks Wohnung – seit er dort eingezogen ist, hat man öfter mal das Gefühl, die Decke würde einem gleich auf den Kopf fallen.
Das laute Mahlen der Maschine – Emily und ich haben uns vor drei Jahren zu Weihnachten einen Kaffeevollautomaten gegönnt – und der entstehende Kaffeeduft leiten schon ein angenehmes Entspannungsgefühl ein und ich gerate in Feierabendstimmung.
Zufrieden ziehe ich mit meiner Tasse dampfenden Kaffees durch den Flur, als es erneut poltert. Diesmal ist es richtig laut und definitiv nicht in der Wohnung über mir.
Vor Schreck lasse ich die Tasse fallen, genau vor Emilys Zimmertür. Ein Teil des Kaffees schwappt auf meine Hose und rinnt mir das Bein hinunter auf meinen nackten Fuß. Es tut höllisch weh – der Kaffee ist kochend heiß.
„Mist, heiß, aua, nein“, fluchend und hektisch herumfuchtelnd hüpfe ich durch den Flur und versuche, die enge Röhrenjeans auszuziehen. Geschafft. Was zum Vorschein kommt, sieht besorgniserregend aus: Ein breiter, krebsroter Streifen zieht sich von der Mitte des rechten Oberschenkels bis hinunter zu den Zehen. Doch das muss warten.
Ich hüpfe auf dem unverletzten Bein in die Küche und hole einen Lappen, um schnell den Kaffee vom Boden aufzuwischen, bevor er den Holzfußboden ruiniert. Schließlich will ich unbedingt die Kaution zurückbekommen, wenn ich hier einmal ausziehe.
Als ich nur mit Slip und T-Shirt bekleidet vor Emilys Tür hocke, um die Lache aufzuwischen, öffnet sich besagte Tür und eine leicht bekleidete und sehr zerzauste Emily erscheint in dem schmalen Spalt.
Vor Schreck kippe ich nach hinten und sitze verblüfft auf dem Fußboden.
„Emily, was machst du denn hier?“
„Na, du hast Nerven, das wollte ich dich auch gerade fragen“, antwortet Emily atemlos und macht dabei einen seltsam beschämten Eindruck. Ihre sonst schalkhaft blitzenden Augen weichen meinem Blick aus, eine unübersehbare Röte kriecht ihr ausgehend von dem T-Shirt, das sie verkrampft an die Brust presst, über den Hals, das Gesicht hinauf, bis an den dunkelbraunen Haaransatz.
Ich verstehe gar nichts mehr. EMILY sollte doch auf einer Konferenz in Berlin sein, warum denkt SIE denn, ICH sollte nicht hier sein?
„Aber deine Konferenz“, beginne ich erneut. Emily sieht mich mit ihren großen braunen Kulleraugen zum ersten Mal direkt an und streicht sich nervös eine lockere Strähne aus dem noch immer roten Gesicht.
„Ähm, ja, also, das ist jetzt so, hör mal“, druckst sie herum, will etwas sagen, findet aber offensichtlich nicht die richtigen Worte. Auf einmal höre ich jemanden niesen – einen Mann. In Emilys Zimmer.
„Haha. Ich versteh‘ schon“, rufe ich lachend und ein Stein fällt mir vom Herzen, da sich diese bizarre Situation schlagartig aufklärt.
„Nils, hallo!“, johle ich. „Emily! Du hättest mir doch sagen können, dass Nils da drin ist und dass ihr gerade, naja, das tut, was Verlobte nun mal so tun.“ Ich zwinkere Emily wissend zu.
„Wurde die Konferenz abgesagt? Oder machst du blau? Habt ihr Lust, später noch was vom Chinesen kommen zu lassen?“, quassele ich auf meine Mitbewohnerin ein.
„Nun ja, ähm, es ist nicht, also“, setzt sie an, doch sie kommt nicht weit.
Von drinnen ist Gepolter zu hören, dann wird die Tür aufgerissen und ein unglaublich wütend aussehender und unglaublich nackter Mann funkelt Emily zornig an.
„Was? Du bist verlobt? Was soll ich denn davon halten? Und wer ist denn DAS überhaupt?“ Er zeigt auf mich, als wäre ich ein widerliches Insekt. Mir wird bewusst, dass ich gerade in der Unterhose in einer Kaffeepfütze sitze und ich möchte am liebsten im Erdboden versinken.
„Das ist, äh, Hilda, meine, äh, Mitbewohnerin“, stammelt Emily mit nun so hochrotem Kopf, dass es ungesund aussieht.
Der nackte Mann runzelt die Stirn, anscheinend nicht zufrieden mit ihrer Erklärung. „Also eine Mitbewohnerin. Von der hast du mir nichts gesagt. Aber offenbar ist das nicht das einzige, wovon du mir nichts gesagt hast.“
Ich mag nicht, dass er mich so geringschätzend ansieht, Geringschätzung hatte ich heute schon genug von Agnes. Dennoch – oder vielleicht auch gerade deswegen – trotze ich seinem Blick, immerhin ist das hier MEINE Wohnung und ICH habe mir nichts zuschulden kommen lassen.
Er scheint zu bemerken, dass er am wenigsten von uns dreien am Körper trägt, und verschwindet wieder im Zimmer. Emily wirft mir einen Blick zu, den ich nicht deuten kann, macht ein zerknirschtes Gesicht und schließt vorsichtig die Tür.
Ich sitze auf dem Boden und schüttele ungläubig den Kopf. Was ist denn da gerade passiert? Im Moment weiß ich nur eins: Wenn die beiden da wieder herauskommen, will ich nicht in Unterwäsche vor ihrer Tür hocken.
Also wische ich schnell den Rest Kaffee auf und bringe den nassen Lappen und die Tasse in die Küche. Zum Glück ist die Tasse noch ganz und die Holzdielen scheinen auch keinen nachhaltigen Schaden davonzutragen.
Anschließend husche ich in mein Zimmer und schmiere Brandsalbe auf die gerötete Haut. Aus Emilys Zimmer höre ich einzelne Gesprächsfetzen, aber ich kann nicht alles verstehen, da sie sich offensichtlich bemühen, trotz der hitzigen Diskussion so leise wie möglich zu sprechen. Verlobter – Ausrutscher – zu spät, um es dir zu erklären – auf deine Diskretion verlassen – Frau das erfährt – Hilda – nicht da.
Ich sitze auf meinem Bett, begutachte meinen verbrühten Fuß und versuche, die Satzbruchstücke in Zusammenhang zu bringen. Also Emily und dieser nackte Mann haben eine Affäre, von der ihr Verlobter Nils wohl nichts weiß. Der nackte Mann wiederum weiß nichts von dem Verlobten – bis vorhin wusste er zumindest nichts davon. Er scheint aber selbst auch verheiratet zu sein, also kann es ihm doch egal sein, wenn Emily ihren Partner ebenso betrügt wie er seine Frau. Und von Betrug sprechen wir hier ganz unmissverständlich.
Schade. Nils und Emily waren für mich das perfekte Paar. Emily und ich kennen uns schon seit der Grundschule, sind nach dem Abitur gemeinsam in diese Wohnung gezogen und haben uns bis auf kleinere Streitereien unter Mitbewohnerinnen immer gut verstanden. Mehr als das.
Als Lukas mich nach zwei Jahren Beziehung aus mir unerfindlichen Gründen verlassen hat, hat Emily die ganze Nacht mit mir im Wohnzimmer gesessen und mich getröstet.
Als Viktor sie betrogen hat, haben wir gemeinsam alle Sachen, die er in unserer Wohnung gelassen hatte, in kleinste Schnipselchen geschnitten und aus dem Fenster geworfen.
Wir wussten immer, in wen die andere gerade verliebt war, welche Beziehung gut lief und welche kurz vor dem Aus stand. Wir lachten, weinten, feierten, lernten, kochten und lebten zusammen, waren beste Freundinnen, jede wusste, wie es der anderen ging.
Dann kam Nils und nach wenigen Wochen erzählte Emily mir, dass sie sicher sei, den Richtigen gefunden zu haben und dass sie hoffe, er sehe das auch so.
Er sah es auch so. Nach einem Jahr Beziehung machte er Emily einen Heiratsantrag und sie nahm ihn überglücklich an.
Seitdem liegen in der Wohnung Hochzeitszeitschriften und Zeitungen mit aufgeschlagenem Immobilienteil herum. Emily und Nils wollen noch getrennt wohnen, bis sie genug Geld gespart haben, um eine luxuriöse Hochzeit bezahlen und die Anzahlung für ein Haus leisten zu können.
Meiner Meinung nach etwas altmodisch, aber irgendwie passt es zu den beiden. Und jetzt so was – ein nackter Mann in Emilys Zimmer. Und ich habe es nicht kommen sehen. Seit Emily Nils kennen gelernt hat, habe ich sie nicht mehr von einem anderen schwärmen gehört. Und nun das.
Ich schrecke hoch, weil die Wohnungstür geräuschvoll zugeschlagen wird. Gleichzeitig höre ich leise Schritte auf dem Flur, die vor meiner Tür stoppen.
„Hilda?“, Emily steckt zögerlich den Kopf durch den Türspalt. Ihr Gesicht ist ganz verquollen, sie hat geweint. Getrocknete Tränen haben glitzernde Streifen auf ihren Wangen hinterlassen.
Ich humpele auf sie zu und umarme sie. „Was ist denn los? Was war das denn? Und WER war das denn? Komm, wir gehen ins Wohnzimmer.“ Wir setzen uns auf die Couch – im Fernsehen laufen immer noch die ‚Gilmore Girls‘ – und ich ziehe eine Schachtel Oreos aus der Schublade unter dem Tisch.
Emily greift auf der anderen Seite der Couch neben die Lehne und holt unsere Notfall-Flasche Baileys hervor. Jede von uns isst schweigend einen Keks und trinkt ein Gläschen Baileys, dann sehen wir uns zum ersten Mal richtig an.
Ich pruste los. „Emily, ich bitte dich, ein nackter Mann in unserem Flur? Warum kommt der denn nackt zur Tür? Der hat doch gehört, dass ich da bin!“ Emily kichert verhalten.
„Aber du. Sitzt da in der Unterhose vor meiner Tür. In einer Pfütze. Ich dachte, du wärst stubenrein! Pfui!“ Sie schüttelt den Kopf und plötzlich müssen wir beide laut lachen.
Ich lache und lache, mir tut der Bauch weh, Tränen rinnen mir über das Gesicht und ich japse nach Luft. Emily hält sich ebenfalls den Bauch und ihr Gesicht ist noch röter als vorhin.
Das Gelächter hat die Anspannung gelöst und wir trinken noch ein Gläschen, sicher ist sicher, wir wollen ja nicht, dass die Anspannung zurückkehrt. Dann fängt Emily an zu erzählen.
„Also, der nackte Mann hat auch einen Namen. Sein Name ist Walter und er arbeitet bei mir in der Firma. Er ist eins von den ganz hohen Tieren, aber in einer anderen Abteilung. Er ist also nicht mein Vorgesetzter oder so.“ Sie blickt mich entschuldigend an, wobei ich die leise Vermutung habe, dass sie sich nicht dafür entschuldigen will, dass der nackte Mann in ihrer Firma arbeitet.
„Ja, ok“, sage ich, „aber warum ist der nackte Mann, ich meine Walter, warum ist er hier gewesen und warum hast du mit ihm, du weißt schon?“ Ich weiß, das ist sehr direkt gefragt, aber ich finde, es steht mir als bester Freundin, Mitbewohnerin und engster Vertrauten durchaus zu, indiskrete Fragen zu stellen. Sie sieht mich lange an und nippt an ihrem Glas, bevor sie weiterspricht.
Und dann erfahre ich nach und nach die Geschichte, wie der nackte Mann Emily auf der Arbeit angeflirtet, ihr über das firmeninterne Mailprogramm versaute kleine Nachrichten geschickt und sie schließlich in einer Mittagspause verführt hat.
„Ich hätte das nie von mir gedacht, aber ich wollte es in diesem Moment wirklich. Vielleicht weil es eben so unwirklich war – im Auto, in der Tiefgarage, während ich eigentlich drei Reihen hinter meinem Chef in der Tagung sitzen sollte. Das war jetzt vor zwei Wochen. Wir haben es jetzt schon in nahezu jedem Lagerraum in der Firma getan, sogar auf der Toilette und in seinem Büro nach Feierabend.“
Sie schüttelt sich. „Ich habe ihm nicht erzählt, dass ich einen Freund, einen Verlobten, habe. Ich dachte irgendwie, so bleibt es weiterhin irreal. Ich liebe Nils wirklich. Mit Walter, das ist nur“, sie atmet tief ein, „ich weiß nicht, was es ist.“
Naja, ich würde mal sagen, es ist eine Affäre. Und weil niemand von der Affäre erfahren sollte, war der nackte Mann auf enorme Geheimhaltung bedacht. Sollte nämlich seine betrogene Frau Wind davon bekommen, wäre er laut Ehevertrag zur Zahlung horrender Summen verpflichtet, erzählt Emily schniefend.
„Ich dachte, wir könnten uns hier treffen, weil du nicht da bist.“
Noch ganz benommen von der Geschichte schüttele ich den Kopf. „Aber wo sollte ich denn sein?“
„Na, bei deinen Eltern? Der Geburtstag von deiner Oma? Oder ist das nicht heute? Ich dachte, du fährst direkt nach der Arbeit dorthin.“ Oh nein.
Ich fluche. „So ein Mist! Das hab‘ ich ja total vergessen. Argh! George mit seinem Trip nach Worms hat mich ganz aus dem Konzept gebracht!“ Ich springe auf und renne zum Telefon. Mit zitternden Händen wähle ich die Nummer meiner Eltern. Emily guckt mir dabei zu und sieht jetzt wieder sehr zerknirscht aus. Dabei ist es doch nicht ihre Schuld, dass ich den Geburtstag meiner Oma vergessen habe.
„Mama, hallo, tut mir leid, dass ich nicht da bin“, rattere ich los, sobald meine Mutter sich meldet. „Ich musste länger arbeiten und George hat mich dazu überredet, ihn ab morgen auf eine Exkursion zu begleiten, also muss ich noch packen. Und morgen früh muss ich auch noch arbeiten.“ Ich hole tief Luft und bereite mich innerlich auf die nun folgende Standpauke vor.
„Ach Hilda.“ Meine Mutter klingt gar nicht wütend. Eher traurig. „Oma Gerda hat heute keinen guten Tag. Sie erkennt uns kaum und redet nur zusammenhanglose Sachen, die keiner versteht. Ich hätte mich zwar gefreut, dich zu sehen, aber deine Oma bekommt gar nicht mit, ob du hier bist oder nicht.“
Was soll ich dazu sagen? „Mama, es tut mir leid“, flüstere ich kaum hörbar, wohlwissend, dass dies eine ziemlich einfallslose Antwort ist.
„Es ist in Ordnung, Schatz. Aber Papa und ich würden uns freuen, wenn du demnächst mal Zeit hast, bei uns vorbeizuschauen.“ Mein schlechtes Gewissen meldet sich prompt, meine Mutter weiß aber auch genau, welche Knöpfe sie drücken muss.
Obwohl meine Eltern nur eine knappe Stunde Fahrt entfernt wohnen, besuche ich sie selten. Zu selten. Ich nehme mir immer wieder vor, öfter mal bei ihnen vorbeizufahren, aber dann kommt mir jedes Mal wieder etwas dazwischen.
„Mach‘ ich, Mama“, verspreche ich und schwöre mir innerlich, dieses Mal auch wirklich bald hinzufahren.
„Schatz, ich muss jetzt auflegen, Onkel Friedrich kommt gerade. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Ausflug. Pass auf dich auf und melde dich, wenn du wieder da bist“, sagt Mama.
Hastig rufe ich: „Ja, mach‘ ich, und sag allen liebe Grüße von mir!“, und dann ist die Verbindung auch schon unterbrochen.
Ich halte den Hörer noch in der Hand und will gerade etwas zu Emily sagen, die wie hypnotisiert auf der Couch sitzt, als es an der Tür klingelt. Himmel, was ist denn heute nur los?
Als ich die Wohnungstür öffne, tänzelt ein unglaublich gut gelaunter George an mir vorbei, küsst mich im Vorübergehen auf die Wange und lässt sich neben Emily auf das Sofa plumpsen. Den hatte ich schon ganz vergessen!
„Honey, wir werden uns ein paar schöne Tage machen“, verspricht er mir vergnügt. Ich verziehe das Gesicht und sage leidend: „So schön es halt in Worms sein kann.“ Und betone dabei das Wort „Worms“ besonders verächtlich, so verächtlich wie es nur geht.
„Was, wo fahrt ihr hin? Und warum?“, will Emily wissen. Das ist das Stichwort für George. Er springt auf und beginnt ganz euphorisch zu erzählen.
„Ich gebe doch dieses Semester ein Seminar an der Uni über die Geschichte der Nibelungen.“ Emily guckt verständnislos, im Gegensatz zu mir hat sie noch nicht viel von Georges Arbeit gehört.
„Was für Lungen?“, fragt sie, ohne den geringsten Anflug einer Ahnung, worum es sich dabei handeln könnte.
„Nicht Lungen. NIBELUNGEN“, erklärt George, ohne seine gute Laune zu verlieren.
„Hach Emily, my dear, du bist genauso ein Kulturbanause wie Hilda. Die Nibelungensage ist so etwas wie das deutsche Pendant zur Artussage in England. Eine Geschichte voller Liebe und Leid und Verrat, und einen Schatz gibt es auch! Ihr seid mir eine Nation! Ihr habt eine der spannendsten Legenden des Mittelalters und wisst nichts darüber, aber auch rein gar nichts! Aber fragt man euch nach König Artus, dann könnt ihr einem stundenlang was von den Rittern der Tafelrunde, dem Schwert Excalibur und dem Zauberer Merlin erzählen!“ Er schnappt in gespielter Empörung nach Luft. „Ihr interessiert euch nicht für eure Kultur, dabei hat dieses Land doch so viel zu bieten!“
Emily und ich werfen uns einen Nicht-schon-wieder-Blick zu. Wenn George richtig in Fahrt gerät, dann hält er uns lange, sehr lange, Vorträge über das, was unsere Kultur schon alles Großartiges hervorgebracht hat. Er als ausgewanderter Engländer versteht nicht, dass man als Deutscher nicht gut mit einem zu großen Stolz auf die Kultur des eigenen Landes herumlaufen kann. Und er versteht nicht, dass es andere Themen gibt, die uns brennender interessieren. Die neue Sommerkollektion von Prada zum Beispiel.
George bemerkt unser Desinteresse und die Blicke, die wir austauschen. „Okay, machen wir es kurz. Ich gebe dieses Seminar über die Geschichte der Nibelungen, verstanden?“ Emily nickt gehorsam, George fährt zufrieden fort.
„Einer der Handlungsorte dieser Sage ist Worms. Und dort finden jedes Jahr die Nibelungen-Festspiele statt. Ähnlich wie Karl-May-Festspiele, halt nur ohne Indianer. Und es geht dabei um die Geschichte von Kriemhild und Siegfried. Das sind, um es vereinfacht auszudrücken, die Hauptpersonen. Ich fahre mit den Studenten, die mein Seminar besuchen, nach Worms, um dort die Sage der Nibelungen und ihre Wurzeln genauer zu untersuchen.“ Mit dem Stolz, wie nur ein waschechter Brite ihn authentisch zur Schau stellen kann, sieht er Emily erwartungsvoll an. Ich weiß, dass er nun Komplimente hören will. Er sei der beste Dozent, den man sich nur vorstellen könne, er sei so einfallsreich, so engagiert – das volle Programm.
„Aha. Das klingt ja unheimlich spannend“, kichert Emily, die für solche Sachen noch weniger übrig hat als ich, und zerschmettert damit Georges Hoffnung auf eine ordentliche Lobeshymne.
Als persönliche Assistentin in einem Großkonzern ist sie auch denkbar weit von dieser Thematik entfernt. George verdreht die Augen und seufzt, dabei fällt sein Blick auf den Couchtisch.
„Oreos und Baileys?“, fragt er. „Was ist passiert?“ Nicht nur ich kenne ihn gut, auch er kennt mich und meine Angewohnheiten.
Emily wirft mir einen flehenden Blick zu. Sag ihm nichts, soll das wohl heißen. Okay, wir müssen ihm nicht die ganze Geschichte erzählen.
„Ich hab‘ mich mal wieder ein bisschen tollpatschig angestellt“, beginne ich und liefere Emily damit den Einstieg, um die Geschichte so zu erzählen, wie sie es für richtig hält.
Sie greift dankbar meine Vorlage und damit mein Missgeschick auf und erzählt George ausführlich von unserem Zusammentreffen auf dem Flur, ich in der Unterhose in einer Kaffeepfütze sitzend. Dabei verschweigt sie unseren Besucher, den nackten Mann, geflissentlich. Walter.
Nein, über Emilys Affäre will ich jetzt nicht nachdenken, sonst kann ich mich nicht beherrschen und muss mit ihr darüber sprechen. Also denke ich lieber an etwas anderes. George.
Ich sehe ihn an und muss lächeln. Aufmerksam hört er Emily zu, seine blauen Augen sind konzentriert auf sie gerichtet, der Kopf mit den hellbraunen Haaren – und ein paar grauen Strähnen darin, auch wenn er das nicht wahrhaben will – nickt leicht, während sie spricht. Er ist ein außergewöhnlich guter Zuhörer, das muss man ihm lassen.
Spontan fällt mir ein, wie wir uns damals kennen gelernt haben. Es war zu Beginn meines fünften Semesters an der Uni, ich kam mir schon wahnsinnig erfahren vor, wie ein richtig alter Uni-Hase. Ich hatte den Plan. Nicht irgendeinen Plan A, B, C oder D. Nein, ich hatte DEN Plan.
Ich hatte schon gute Beziehungen und schlechte, ich habe Prüfungen gut und andere weniger gut bestanden, kurzum: Ich dachte, ich wüsste, wie es läuft und mir könnte keiner mehr etwas vormachen.
An dem Tag, an dem ich George zum ersten Mal traf, war ich auf dem Weg zu einer Vorlesung über die Dichtung im Mittelhochdeutschen. Vorher wollte ich mir noch schnell einen Kaffee in der Cafeteria besorgen, obwohl ich schon etwas spät dran war.
Ich stand in der Schlange, trippelte von einem Bein auf das andere und sah nervös auf die Uhr. Nur noch einer vor mir, gut. Doch dieser Kerl wusste anscheinend nicht, dass man in der Cafeteria nicht in bar zahlen konnte. Dazu benutzten wir den aufladbaren Chip, der in unseren Universitätsausweis integriert war. Mit unserer Studi-Card konnten wir auch kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, in der Uni-Bibliothek Bücher ausleihen und mit der Chipkartenfunktion bezahlten wir unsere Kopien und eben auch das Essen.
Davon wusste dieser Typ zu meinem Ärger nichts und wollte unbedingt sein Salami-Käse-Sandwich und die Cola in bar bezahlen. Schätzungsweise zehn Jahre älter als ich, aber keine Ahnung vom Leben. Typisch Langzeitstudent eben, dachte ich mir.
Er sah nicht schlecht aus, ein bisschen wie Eric Dane, alias Dr. Mark Sloan aus ‚Grey’s Anatomy‘. Daher half ich ihm und bat die Kassiererin, seinen Betrag von meiner Karte abzubuchen.
„Äh, thank you so much“, sagte er und lächelte mich verlegen an.
„Ach, das ist schon in Ordnung. Du bist sicher neu hier“, antwortete ich – ein bisschen großspurig.
„Ja, ich bin George“, stellte er sich vor. „Jetzt schulde ich dir was.“
„Ich bin Hilda“, sagte ich, „und ich hab’s eilig. Ich komme sonst zu spät in die Vorlesung. ‚Dichtung im Mittelhochdeutschen‘.“ War ich cool – dachte ich.
„Das trifft sich gut, da muss ich auch hin, und ich kenne die Wege hier noch nicht so gut. Dann schließe ich mich dir an“, strahlte George und fand mich auch total cool – dachte ich. Meine Gelegenheit, mich noch etwas mehr aufzuspielen.
„Klar, komm nur mit. Aber ich sag‘ dir gleich, dieser Typ, Darnett, scheint ein neuer Dozent zu sein. Ich kenne ihn nämlich nicht. Ich hoffe, dass er keine Anwesenheitsliste führt. Dann brauche ich mir diesen langweiligen Mittelalter-Kram nicht anzuhören und lasse mir trotzdem am Ende des Semesters eine Teilnahmebescheinigung ausstellen. Das checke ich nur schnell ab. Ich setze mich ganz hinten rein, und wenn es keine Liste gibt, dann verzieh‘ ich mich direkt wieder“, erklärte ich ihm mit aller Gleichgültigkeit, die ich aufbieten konnte.
„So, wir sind da, hier ist der Hörsaal“, deutete ich mit einer so lässigen Handbewegung auf das Schild mit der Raumnummer, dass ich selbst überrascht war, wie lässig ich doch war. So lässig. So cool.
George nickte mir freundlich zu und ließ mich zuerst in den Hörsaal eintreten. Ich setzte mich – wie angekündigt – auf einen Platz in der letzten Reihe, davon ausgehend, dass er sich neben mich setzen würde – ich war doch einfach zu cool. Und er war neu und kannte noch niemanden, die Chance konnte er sich nicht entgehen lassen – dachte ich.
Zu meinem Entsetzen ging er an mir vorbei, ging weiter nach vorn.
„George“, zischte ich, SEIN Fauxpas war MIR regelrecht peinlich, „nicht, vorne sitzen immer nur die Streber.“
Er zwinkerte mir zu, ging weiter – und betrat das Podium.
Ich wusste zuerst nicht, was ich davon halten sollte, so verdutzt war ich. Er ging zum Mikrofon. Er nahm es. Er schaltete es ein. Er sagte: „Guten Tag liebe Studentinnen und Studenten. Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung ‚Die Dichtung des Mittelhochdeutschen‘. Ich bin George Darnett und freue mich über Ihr reges Interesse an dieser Veranstaltung.“
Er sah mir direkt in die Augen und zwinkerte wieder. Ich wollte im Erdboden versinken. Ich wollte unsichtbar sein. Ich wollte sterben. Mit hochrotem Kopf saß ich da und starrte auf den Tisch vor mir, ich traute mich nicht, den Blick zu heben. An meinen tollen Plan – checken, ob es eine Anwesenheitskontrolle gibt und mich wieder verziehen – wagte ich gar nicht, zu denken.
Nach der Vorlesung rannte ich aus dem Saal und in den nächsten Tagen wechselte ich stets die Richtung, wenn ich George kommen sah. Bis er mich ein paar Tage später doch abfing und mich in ein Gespräch verwickelte. Nach wenigen, angespannten Minuten wurde ich zunehmend ruhiger und merkte, dass ER MEINEN Fauxpas mit Humor nahm. Heute können wir beide herzlich darüber lachen und George liebt es, diese Geschichte zu erzählen.
Ich sehe ihn verträumt an. Wovon sprechen George und Emily da gerade?
„… benimmt sich ja immer wie ein Elefant im Porzellanladen“, höre ich ihn sagen. Aha, es geht immer noch um mich. George sieht mich an und legt mir einen Arm um die Schultern, ich lehne mich gemütlich an ihn.
„Ihr beide wärt so ein tolles Paar“, seufzt Emily. George und ich grinsen uns an.
„Ja, wenn Hilda ein echter Kerl wäre, dann könnte ich mich sicher nicht von ihr fernhalten“, stänkert George.
„Von mir fernhalten kannst du dich auch so nicht, das einzige, was wir nicht miteinander tun, ist ES. Sonst jawohl alles“, gebe ich zurück und boxe ihn in die Seite.
Und es stimmt. Seit unserem turbulenten Kennenlernen sind wir fast unzertrennlich. Eine kurze Krise hatten wir, als ich noch nicht wusste, dass George schwul ist, und einige Zeichen falsch gedeutet habe. So richtig verliebt in ihn war ich nie, es gab aber von Anfang an diese Zuneigung zwischen uns.
Naja, und an einem Abend – ich hatte etwas zu viel getrunken und hegte schon länger den Verdacht, George wäre in mich verliebt – ging ich aufs Ganze und versuchte, ihn zu verführen.
Mit mäßigem Erfolg. Er eröffnete mir, dass er schwul ist, ich schämte mich einige Tage lang und verweigerte jeden Kontakt zu ihm, und dann war wieder alles wie immer, nur noch entspannter. Der Druck war weg. Ich wusste, dass zwischen uns nie etwas laufen würde und deutete dann auch keine Zeichen mehr falsch.
„Darling, ich freue mich wirklich, dass du mitkommst“, unterbricht George meine Gedanken. „Ich habe uns ein tolles Hotel gebucht. Wir fahren morgen um 15 Uhr mit dem Bus an der Uni ab. Bitte sei pünktlich. Ich muss jetzt los.“ Er verabschiedet sich mit Küsschen von Emily und mir und dann sind wir wieder allein.
Ich lasse mich neben ihr auf das Sofa sinken. „So, wir waren bei dem nackten Mann und Nils“, greife ich unser Thema von vorhin wieder auf.
Sie sieht mich lange an. „Das war wohl ziemlich daneben, oder?“ Dumme Frage, was soll ich dazu sagen?
Sie weiß, dass ich Fremdgehen mies finde, aber so richtig mies, und dass sie meine beste Freundin ist und dass es ihr jetzt leidtut, ändert auch nichts an meiner Einstellung.
„Naja, ein netter Kerl wie Nils hat es eigentlich nicht verdient, dass du ihn so hintergehst“, sage ich zögernd. Pause. Schweigen. Jede knabbert noch einen Keks. Wir haben es schon immer so gehalten, dass wir uns die Wahrheit sagen. Das tut zwar manchmal weh, so wie in diesem Moment, aber letztendlich ist es gut für uns.
Emily gibt sich einen Ruck. „Ich kann es irgendwie selbst noch nicht fassen, dass ich das getan habe. Es fing so unwirklich an, und da ich es niemandem erzählt habe und Walter so extrem auf Geheimhaltung bedacht war, ja, da hab‘ ich wohl gedacht, wenn es keiner weiß, dann passiert es auch nicht, jedenfalls nicht richtig.“ Sie lässt den Kopf sinken. Traurig, mutlos, ein Bild des Elends.
„Also du meinst so was wie ‚Wenn im Wald ein Baum umfällt, aber keiner da ist, der es hören könnte, hat es dann überhaupt ein Geräusch gegeben?‘ Die große Frage der Philosophie. Dazu habe ich mal ein ganzes Semester lang ein Seminar besucht. Diese Rumphilosophiererei liegt mir nicht. Wenn du einen Betrug begehst und niemand davon weiß, ist es dann also wirklich passiert? Ich bitte dich!“ So leid sie mir auch tut, ich hasse solche lahmen Ausreden. Das ist feige und unfair, sonst nichts. Und eigentlich sollte sie das auch wissen, immerhin wurde sie selbst auch einmal betrogen und fand es gar nicht toll.
Sie hebt den Kopf ein wenig und schielt mich von der Seite an. „Eine schwache Ausrede, oder? Oh Hilda, was hab‘ ich nur getan? Was hab‘ ich mir denn nur dabei gedacht?“ Emily beginnt zu schluchzen. „Ni-hi-hils ist der be-he-heste Ma-hann, den i-hi-hich mir vo-horstellen ka-hann.“ Jetzt, wo die Tränen einmal fließen, gibt es kein Halten mehr. Ich nehme sie in den Arm.
„Ach, Liebes, du beendest erst einmal die Sache mit dem nack – mit Walter. Und dann…“ Ja, was dann? Emily sieht mich mit rotgeränderten Augen an, eine Haarsträhne hängt ihr ins Gesicht, doch es scheint sie nicht zu stören.
„Meinst du, ich muss es Nils sagen?“, flüstert sie. Ich denke nach. Schwierig. Aber eindeutig. „Ja. Ihr wollt heiraten. Du willst doch deine Ehe nicht auf einer Lüge aufbauen“, sage ich schließlich langsam. Sie zuckt zusammen. „Aber was, wenn er mich dann verlässt?“ Ihr Gesicht ist schmerzverzerrt. „Wenn er mich nicht mehr heiraten will?“
„Machen wir uns nichts vor, er wird sich nicht darüber freuen. Aber es wäre unfair, ihm nichts zu sagen.“ Sie nickt.
„Sieh mal, wenn du es ihm nicht sagst“, fahre ich fort, „dann schleppst du das immer mit dir herum. Und du lebst ständig in der Angst, dass er es vielleicht doch noch herausfindet. Und stell dir mal vor, er erfährt es in ein paar Jahren. Dann wird er dir nicht nur den Betrug vorwerfen, sondern auch, dass du es ihm verheimlicht hast. So kann er jetzt entscheiden, ob er mit dir zusammenbleiben will oder nicht. Aber du spielst mit offenen Karten.“ Ich lege den Arm um ihre Schultern, in der Hoffnung, ihr so Mut zu machen und sie zu trösten. „Du schaffst das.“
Emily sieht mich an, zieht die Nase hoch und versucht ein schiefes Grinsen. „Kann ich nicht noch warten, bis du wieder da bist? Ich glaube, ich brauche deine Unterstützung! Ich sage es ihm nächstes Wochenende.“
„Nein“, entgegne ich energisch, „das ist wichtig. Du kannst nicht noch eine Woche verstreichen lassen. Morgen gehst du zu Nils und sprichst mit ihm. Ich bin auf dem Handy erreichbar. Wenn du hier nicht klarkommst, rufst du mich an. Und wenn das nicht reicht, dann komme ich halt früher zurück.“
Sie schließt die Augen, atmet tief ein und dann ganz langsam aus, dreimal hintereinander, das ist ihr Ritual in Stress-Situationen. „In Ordnung. Alles wird gut.“
Ich lache und gebe ihr einen Kuss auf die Wange. „Genau, alles wird gut. Weißt du noch, dieses Buch, das ich mal gelesen habe, über Autosuggestion? Man muss sich nur immer wieder selbst sagen, was man möchte, dann glaubt man daran und schließlich wird es auch so. Alles wird gut. Alles. Wird. Gut.“
Anschließend sitzen wir noch eine Weile zusammen und sehen fern, aber keine von uns sieht richtig hin. Wir hängen beide eigenen Gedanken nach. Schließlich gehe ich in mein Zimmer und packe meine Tasche für die anstehende Reise nach Worms. Da ich direkt von der Arbeit aus zum Bus gehen werde, muss ich meinen Koffer heute Abend noch fertig packen.
Aber ich bin total neben der Spur, kann mich nicht auf das Packen konzentrieren. Ich stopfe wahllos Kleidungsstücke in den Koffer und mache mich bettfertig. Als ich im Bett liege, kann ich nicht einschlafen.