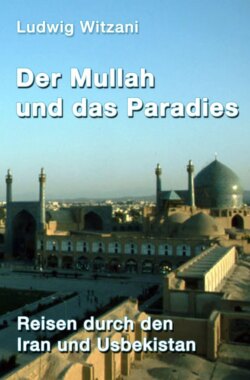Читать книгу Der Mullah und das Paradies - Ludwig Witzani - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
Statt einer Einleitung:
Azila
Vor vielen Jahren, lange bevor ich meine Reisen begann, hatte ich eine kleine Freundin. Ihr Name war Azila, sie war jung und schön – und sie war Iranerin. Damals hatte das einen anderen Klang als heute, wo alles Mohammedanische schnell unter Generalverdacht gerät. Damals war der Orient noch der verträumte Bruder des Westens, jedenfalls erschien es mir so, als ich Azilas Elternhaus in Bonn betrat, in dem der gutmütige Vater Farid und seine deutsche Frau Sabine mich herzlich willkommen hießen. Da war nichts von der strengen Kontrolle zu spüren, der heute viele moslemische Töchter unterworfen sind - im Gegenteil: Farids drei Töchter Azila, Roxana und Rosa waren so deutsch, wie man es sich nur vorstellen konnte. Sie kicherten und lachten, wie es alle Backfische in ihrem Alter tun und wickelten ihren Vater um den Finger, wie sie nur wollten.
Vater Farid hatte ein gutmütiges Gesicht, dunkle Haut und die runden Augen eines Teddybären. Er war mittelgroß und kräftig, seine Stimme war tief und seine Umgangsformen besaßen etwas Vornehmes. Als iranischer Student in Deutschland hatte er noch in der Schah-Zeit die damals blutjunge Sabine kennengelernt, hatte um sie geworben und sie schließlich geheiratet. Solche deutsch-iranischen Ehen waren damals an der Tagesordnung gewesen, denn der Iran befand sich unter der Herrschaft Schah Muhammed Reza Pahlawis in stürmischem Aufbruch. Eine Landreform hatte den Ärmsten der Armen endlich eine Existenzgrundlage verschafft, die Frauen waren offiziell gleichberechtigt, und von außen betrachtet schien es so, als führe die Weisheit eines orientalischen Augustus den Iran in eine glorreiche Zukunft. So dachten wir damals, und keiner hätte sich ernsthaft vorstellen können, dass alles ganz anders kommen sollte.
Jedenfalls heirateten Farid und Sabine und zogen nach Teheran. Dort bekamen sie sehr zügig drei Töchter, Rosa, die Scheue, Azila, die Schöne und Roxana, die Fröhliche. So weit so gut, doch Sabine wurde im Iran nicht glücklich. Was genau damals in Teheran geschehen ist, weiß ich nicht, aber offenbar war das alltägliche Leben in den Vorstädten einer orientalischen Millionenstadt doch erheblich anders, als es sich Sabine vorgestellt hatte. Es kam zu Konflikten, und eines Tages nahm Sabine ihre drei Töchter und kehrte nach Deutschland zurück. Die Zeiten von „Nicht ohne meine Tochter“ befanden sich noch in weiter Ferne. Farid, der verlassene Ehemann, blieb in Teheran zurück. Erst als ihm vor Kummer alle Haare ausgefallen waren, reiste er Sabine hinterher und erklärte sich bereit, hinfort mit seiner Familie in Deutschland zu leben. Er fand eine gutbezahlte Stellung bei einem Exportunternehmen, man bezog eine geräumige Wohnung in einem Bonner Vorort, und die drei kleinen Töchter vergaßen bald in Kindergarten und Grundschule alles Iranische und wurden waschechte Deutsche.
Nur einmal noch, das habe ich aber erst später erfahren, entstand Unruhe in der Familie, als im Jahre 1979 der Schah stürzte. Zum Staunen der Welt erhoben sich die Mullahs und Bazaris, und die Millionen in Teheran, Isfahan, Schiraz und Maschad folgten ihnen. Der Schah floh aus dem Land, das Volk raste vor Glück, und plötzlich holte auch der freigeistige Farid seinen Gebetsteppich aus dem Schrank, entrollte ihn im heimischen Wohnzimmer, um gen Mekka zu beten. Aber gottlob war das nur eine Episode. Als die Mullahs die neue Freiheit brachial niederkartätschten, packte Farid den Gebetsteppich wieder in den Schrank und kehrte in seine aufgeklärt-liberale Existenzform zurück.
Inzwischen waren die Töchter groß geworden. Rosa, Azila und Roxana befanden sich mittlerweile auf dem Gymnasium und besuchten ein- oder zweimal in der Woche das Studentenreferat der Universität, wo jeden Abend ein massenhaftes Circuit-Training stattfand. Gut und gerne einhundert kräftige junge Männer nahmen an dieser Veranstaltung teil, wo zum brausenden Klang mitreißender Musik die männlichen Körper gedehnt, gebeugt, gekräftigt, aber vor allem so effektvoll zur Schau gestellt wurden, dass dieser Termin für die Oberstufenschülerinnen der Umgebung zur allerheißesten Anlaufadresse wurde.
Dort habe ich Azila kennengelernt. Sie war ein prachtvolles junges Mädchen mit den pechschwarzen langen Haaren einer orientalischen Prinzessin, mit bronzefarbener Haut und dunklen Augen, die mir viel älter vorkamen als der Rest ihres Gesichtes. Die Einzelheiten, wie wir zusammenkamen, tun hier nichts zur Sache, allerdings verwunderte mich, wie direkt und gezielt sie mich erwählte. Alles vollzog sich schnell und unkompliziert, und obwohl ich ein gutes Stück älter war als sie, scheute sie sich nicht, mich ihren Eltern vorzustellen. Womit ich wieder beim Anfang bin und bei dem, was ich eigentlich erzählen wollte.
Denn jeden Sonntag, wenn ich mich am Vormittag bis zur Erschöpfung auf dem Fußballplatz verausgabt hatte, war ich Gast am Mittagstisch der Familie Katami. Das war zweifellos ein Privileg, denn der Sonntagstisch der Katamis war das üppige Zentrum des allwöchentlichen Familienlebens, bei dem aufgetragen wurde, was immer Wochenmarkt und Kühlschrank hergaben. Töpfe voller Reis, Gemüse, verschiedene Fleischsorten auf unterschiedlichen Platten, kleine Vorspeisenteller und jede Menge Knabberzeug standen zum Verzehr bereit, und als Konzession an Farids Heimweh nach dem Iran erklangen die melancholischen Töne einer iranischen Zitter über eine gediegene Stereoanlage. Das Gespräch bei Tisch hatte nichts Rituelles, nichts Weihevolles, alles plapperte durcheinander, und Azila, die sich in der Gegenwart meiner älteren Freunde oft um Stil und Ernsthaftigkeit bemühte, kreischte und lachte mit ihren Schwestern wie ein ausgelassenes Kind. Vater Farid saß derweil wie ein gütiger, glatzköpfiger Buddha am Kopfende des Tisches und nickte freundlich zu allem, was die Töchter über Schule und Leben so von sich gaben. Auch ich beschränkte mich überwiegend aufs Zuhören, denn ich war in erster Linie damit beschäftigt, den Speisen zuzusprechen, die Mutter Sabine auf den Tisch des Hauses gezaubert hatte.
Nach dem Essen aber kam das Tollste. Farid und mich überkam eine wohlige Müdigkeit, der Verdauungsvorgang setzte ein, und ehe wir uns versahen, waren wir bereits von den Mädchen in Wolldecken eingewickelt und wie zwei dicke Würste auf den beiden Diwanen des Wohnzimmers zum Mittagsschlaf abgelegt worden. Sabine und ihre Töchter räumten in Windeseile den Tisch ab, ich hörte noch ihr Lachen und das Klimpern des Geschirrs in der Küche, dann schlief ich ein.
Wenn ich es genau bedenke, kann ich mich an nur ganz wenige Momente meines Lebens erinnern, in denen mich eine derartige Entspannung bis in die letzten Fasern meines Wesens erfüllte, wie allsonntäglich auf dem Katami´schen Sofa im ersten Stock eines Wohnhauses in Bonn-Beuel. Jedes Mal versank ich übergangslos in einen tiefen Schlaf, in dem sich alle Verspannungen lösten und aus dem ich nach einer Stunde rundumerquickt und wie neu geboren erwachte. Inzwischen hatten Sabine und ihre Töchter den Samowar auf den Wohnzimmertisch gestellt und die Tschai-Gläser aus dem Schrank geholt. Farid und ich wurden aus den Wolldecken wieder herausgepult, nahmen eine ordentliche Sitzhaltung ein und tranken den Tee, der uns vor die Nase gesetzt wurde. Nun war die Zeit gekommen, in der der Hausherr und ich über die Lage der Welt diskutierten, was meistens so ablief, dass mir Farid seine Meinung zu den aktuellen Geschehnissen im In- und Ausland darlegte und ich nur hier und da leicht paraphrasierte, nicht zu viel, um nicht vorwitzig zu erscheinen, und nicht zu wenig, um nicht in den Ruf einer tauben Nuss zu kommen, die nur an dem Lammfleisch auf seinem Teller interessiert war. Ich weiß noch, wie kritisch Farid die Politik der Amerikaner und Briten beurteilte, verstand aber damals nicht die Berechtigung dieser Position, weil mir die Geschichte des Irans ein Buch mit sieben Siegeln war. Diese amerikakritische Haltung war im Hause Katami übrigens sakrosant, und selbst die Töchter schwiegen, wenn der Vater von dem Unrecht erzählte, dass die Briten den Iranern bei der Ausbeutung der Ölfelder angetan hatten. Vielleicht interessierte es sie aber auch gar nicht, denn Azila, Rosa und Roxana saßen nebeneinander auf dem Sofa und strickten an Shwals, Handschuhen oder Pullovern, was heute kaum glaublich erscheint, aber damals unter jungen Mädchen gang und gäbe war. Azila strickte für mich einen Pullover, von dem ich ahnte, dass er an meinem Körper wie ein Sack herunterhängen würde, den ich aber als Ausfluss ihrer Liebe in allerhöchsten Ehren halten würde. Ich habe ihn später in kalten Nächten schätzen gelernt und irgendwann in der Mongolei verloren.
Heute lebt Azila schon längst in einer anderen Stadt, ist glücklich mit einem guten Mann verheiratet – und hat wieder drei Töchter! Ich habe längst den Kontakt zu ihr verloren, doch geblieben ist mir die Erinnerung an die Sonntagnachmittage im Hause Katami, an ein merkwürdig wesenloses Glück, wie ich es nachher nie wieder in dieser Intensität empfunden habe. Auch wenn es im Hause Katami alles andere als traditionell-moslemisch oder iranisch zuging, auch wenn die sonntägliche Diaspora von allen Bedrängtheiten des Alltags als eine deutsch-iranische Melange daherkam, blieb die Erinnerung an diese paradiesische Behaglichkeit für mich immer mit dem Begriff des Irans verbunden. Essen, Trinken, Schlafen, Geborgenheit, Austausch und Liebe bildeten in ihrer Gesamtheit eine iranisch getönte Reminiszenz, die ich nicht mehr vergaß und die bei mir war, als ich Jahre später endlich den Iran bereiste.